- Sie sind hier:
- Kultur>
- Blick in das Gemeindearchiv :
Eschlkam – ein Blick in alte Protokolle
Obwohl wir in einer den neuesten technischen Errungenschaften sehr ergebenen Welt leben – gerade ist die vernetzte Digitalisierung aktuell, ein Thema das im beruflichen Alltag mittlerweile alle angeht – erwächst von selbst - offenbar als ein Gegenpart dazu - in uns Menschen immer mehr das Interesse an der Geschichte unseres Volkes, unserer Heimat. Nicht nur die großen, geschichtliche Abläufe prägenden Ereignisse stehen im Vordergrund, täglich dargeboten in einzelnen Kulturprogrammen des TV, sondern in erster Linie auch die regionale Geschichte: dort wo man seine familiären Wurzeln hat, wo man arbeitet und lebt.
Deshalb möge diese kommende Artikelreihe – ergänzend zu den bisherigen chronikalen Publikationen – beitragen, den Bewohnern im Hohenbogen-Winkel Einblick darin geben, was sich vor langer Zeit, an die die Erinnerung nicht mehr reicht, im Gemeindebereich von Eschlkam vor mehr als 100 Jahren abspielte, welche Probleme des Alltags zu bewältigen waren. Wohn- und Lebensverhältnisse sind ebenso interessant wie nicht alltägliche Vorkommnisse.
Hinweis: der zuletzt veröffentlichte Artikel ist stets oben eingefügt.
Das Marktarchiv - Basis und Quelle für die Geschichte von Eschlkam
+Eschlkam. Zunächst einige allgemeine Erläuterungen: Ein Archiv (lateinisch „archivum“ ‚Aktenschrank‘; aus altgriechisch „archeíon“‚ Amtsgebäude‘) ist - wie im vorangegangenen Artikel bereits angesprochen - eine Institution, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt im Rahmen der Zuständigkeit des Archivs oder des jeweiligen Sammlungsschwerpunktes aufbewahrt, benutzbar gemacht und erhalten wird. Archive gibt es weltweit und in nahezu allen Kulturen und Lebensbereichen. Sie entstanden mit den ersten schriftlichen Überlieferungen und dienten von Anbeginn der Sicherung wichtiger Informationen, vor allem zum langfristigen Nachweis von Eigentumsrechten oder vertraglichen Dokumenten.
Die Anfänge eines jeden Archivs beginnen mit der Aufnahme des Verwaltungsbetriebes einer Institution - in Eschlkam hat das ab der Verleihung der Marktprivilegien wohl noch im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts begonnen. Aus dieser frühen Zeit haben sich keine direkten schriftlichen Überlieferungen erhalten. Denn immense Schäden, die bis zur völligen Vernichtung von Beständen führten, erlitten solche Einrichtungen immer dann, wenn durch Brand und Plünderung ganze niedergelegte Zeitbereiche unersetzbar verloren gingen. Gerade das geschah in Eschlkam, ebenso auch in den benachbarten Orten während des Hussitenkriegs (z. B. im Jahr 1422) und im Dreißigjährigen Krieg, im Markt besonders bei dessen Niederbrennung im Frühjahr 1634. Erhebliche Brandschäden gab es aber auch zu Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges ab dem Jahr 1703.
Verhältnismäßig frühe Unterlagen
Trotzdem besitzt die Institution >Archiv< im Markt Eschlkam eine verhältnismäßig lange Tradition. Die Unterlagen beweisen uns, dass die Aufbewahrung von Akten und Protokollbüchern, seien es Bücher, gebunden in Schweinsleder, oder auch Urkunden, geschrieben auf Pergament, und einzelne Niederschriften bereits im 16. und 17. Jahrhundert einsetzen. Sie sind uns deshalb erhalten, da gerade in virulenten Zeiten von dem dafür verantwortlichen Personenkreis peinlich darauf geachtet wurde sie zu schützen und der Nachwelt zu erhalten. So beginnen die protokollarischen Niederschriften des ältesten Ratsprotokolls exakt im Jahre 1683. Das viele Seiten zählende Buch endet mit dem Jahr 1691. Die Kammerrechnungen beginnen noch während des für den Hohenbogen-Winkel teils verhängnisvoll verlaufenen Spanischen Erbfolgekriegs im Jahr 1709.
Vom Inhalt her beachtlich erweist sich auch das Pfarrarchiv, eingerichtet im benachbarten Pfarrhof. Erwähnt sei von dort nur die Sammlung an Kirchenrechnungen, die um das Jahr 1700 einsetzt. Insgesamt sind diese nach einem festgelegten Schema alljährlich sorgsam verfassten Protokollbücher, die dem Leser für das jeweils beschriebene Jahr einen tiefen Einblick in die Vorgänge und Aktivitäten in der Pfarrei geben - für den heimatgeschichtlichen Forscher ein außerordentlich wertvoller Fundus (siehe letzten Beitrag).
Die Basis für die Erforschung der Geschichte einer Kommune, ob Dorf, Markt oder Stadt, ist in erster Linie das jeweils vorhandene gemeindliche Archiv, geschützt eingerichtet im Rathaus des Ortes. Geordnet nach festen Vorgaben, mittlerweile auch mit Hilfe der modernen Medien einsehbar, stellt es den unschätzbaren Wert einer Kommune dar, wenn z. B. bei Erforschung der Geschichte die Inhalte über Jahrhunderte zurückreichen. Ein Archiv erfordert auch eine stete Pflege, verbunden mit Ordnungsmaßnahmen. So viel dazu im Allgemeinen.
Das Repertorium

Bürgermeister Florian Adam dankte Werner Perlinger für heimatgeschichtliche Forschungsarbeiten
Eschlkam. Obwohl wir in einer den neuesten technischen Errungenschaften sehr ergebenen Welt leben - gerade ist die vernetzte Digitalisierung aktuell, ein Thema das im beruflichen Alltag mittlerweile alle angeht - erwächst von selbst - offenbar als ein Gegenpart dazu - in uns Menschen immer mehr das Interesse an der Geschichte unseres Volkes, unserer Heimat. Das zeigte sich daran, dass es Werner Perlinger gelang im Zeitraum von Juni 2019 bis heute in der Reihe >aus alten Protokollen< in Ergänzung zu den bisherigen chronikalen Publikationen wie z. B. der neuverfassten Ortsgeschichte Eschlkams vom Jahr 2010, allein in 142 Artikeln den Bewohnern des Hohenbogen-Winkels einen weiteren Einblick zu geben, was sich im Gemeindebereich von Eschlkam in den letzten 300 Jahren abspielte, auch welche Probleme die damaligen Bürger des Marktes stets zu bewältigen hatten. Im Zuge der Erstellung einer sog. Häuserchronik gelang es zudem die Wohn- und Lebensverhältnisse der Marktbewohner in früheren Zeiten in mehrfachen einzelnen Publikationen darzustellen. Auch darf angeführt werden, dass es nun glückte den mittlerweile nicht mehr bekannten Tag zu finden, an welchem der Literat Maximilian Schmidt, genannt „Waldschmidt“, vom Markt die Ehrenbürgerwürde erhielt. Dies geschah am 19. Februar 1888 in München. Der damalige Bürgermeister und zwei bis drei Markträte fuhren eigens in die Landeshauptstadt und überreichten an Schmidt in dessen Privatwohnung die Ehrenurkunde - dies sei angeführt als nur ein Beispiel für neugewonnene Erkenntnisse auf dem weiten Feld der Heimatgeschichtsforschung. Nachdem die umfangreiche Artikelreihe nun abgeschlossen ist, ließ es sich Bürgermeister Florian Adam am Dienstag nicht nehmen an den Autor als Dank ein Präsent zu überreichen.
Das Archiv im Pfarrhof entwickelte sich ab dem Jahr 1859
+Eschlkam. Archive, vorhanden in Gemeinden, in Pfarreien oder in sonstigen Institutionen, dürfen inhaltlich als „Schatzkammern“ innerhalb dieser Einrichtungen angesehen werden. Nicht weil dort vielleicht irgendwelche herkömmlichen Schätze in Form von Münzen oder sonstigen Pretiosen lagern, sondern weil ein Archiv (von lateinisch „archivum“ für ‚Aktenschrank) eine Institution oder Organisationseinheit ist, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt im Rahmen der Zuständigkeit des Archivs oder des jeweiligen Sammlungsschwerpunktes aufbewahrt, erhalten, und benutzbar gemacht wird (Archivierung). Das lagernde Archivgut ist derjenige Teil von Unterlagen, der von Schriftgut führenden Stellen wie beispielsweise Behörden, Unternehmen, Vereinen, Familien oder Privatpersonen, der für die aktuelle Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt wird und vom zuständigen Archiv als unbefristet aufzubewahren bewertet wurde (archivische Bewertung).
Im Markt Eschlkam hat das Gemeindearchiv, untergebracht im UG des neuen Rathauses, eine lange bis in das 17. Jahrhundert zurückreichende Tradition. Daneben existiert in unmittelbarer Nachbarschaft im Pfarrhof das Pfarrarchiv. Wenn auch in den Büroräumen der jeweils amtierenden Pfarrer älteres Archivgut wie die einzelnen Matrikelbücher schon immer vorhanden war, so entstand die Einrichtung >Pfarrarchiv< eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Der jetzige Pfarrhof, nach dem Schwedenkrieg erst 1679/80 als stattliches Gebäude innerhalb des Marktzentrums erbaut, beherbergt die zur Kirche gehörenden archivischen Sammlungen ebenfalls im UG, gesichert vor Diebstahl und Schadensfeuer.
Am 12. März 1859 ließ der damals amtierende Pfarrer Karl Pittinger (1843-1859) durch „eine Weibsperson“ im Rathause einen Zettel vorbeibringen, in dem er um einen möglichen Besuch im dortigen „Registraturzimmer“ zusammen mit dem Kirchenpfleger bat. Er wolle Unterlagen zur Kirchenstiftung suchen. Der Besuch fand wohl statt, hatte aber zur Folge, dass Pittinger am 28. März in einem ausführlichen Brief den Magistrat bat, dass „alle Rechnungen der Kirche und Bruderschaften von 1730 angefangen bis zum letzten Jahrgang samt den dazugehörenden Unterlagen aus dem Registraturzimmer entfernt und in einen anderen der Kirche angehörenden Gebäude, nämlich im Pfarrhofe oder auf dem Sakristei-Oratorium ordentlich aufbewahrt werden sollen“.
Pittinger begründete seinen Wunsch mit den Hinweisen, „das Registraturzimmer im Rathause, welches nicht einmal gewölbt ist“, sei durch unmittelbar neben dem Rathause stehende „hölzerne Gebäude“ (Städel) einem möglichen Schadensfeuer besonders ausgesetzt. Dagegen sei „das Registraturzimmer im Pfarrhause feuerfest gewölbt“. Außerdem sei die Ost- und Nordseite des Pfarrhofes „in der Art frey, daß man von außen leicht durch die Fenster hineinsteigen und die Gegenstände (das Archivgut bei einem Brand) herausnehmen könne“. Auch sei, so Pittinger, „dieses Registraturgewölbe auf der Seite der Wohnung des Pfarrers mit einer eisernen Thür samt steinernen Thürstock versehen und beständig geschlossen, so daß von daher die Feuerflammen in das Gewölbe nicht hineinschlagen könnten“. Das Oratorium (hier das obere Stockwerk) der Sakristei stehe, so der besorgte Ortspfarrer, „ an drei Seiten frei“, wobei „durch die Fenster die (Kirchen)rechnungen leicht gerettet werden können“. Auch erwähnt Pittinger, dass „die Sakristei und die Kirche und der Thurm, auf dem sich der Wetterableiter (Blitzableiter) befindet von feuergefährlichen Gebäuden merklich weiter (als das Rathaus) entlegen sind“. Der Pfarrer führt noch an, dass „die meisten Pfarrkinder von den Dörfern auf die Rettung des dort vorhandenen Eigenthums der Kirche mehr bedacht sind, als auf die Gegenstände, die sich im Rathause befinden“. Letztlich wird in dem umfangreichen Schreiben darauf hingewiesen, dass „die Kirchenrechnungen samt Belegen und Aktenprodukte sowie inklusive der Registraturschrank im Rathause Eigenthum der Kirche allein sind“. Um baldige Trennung der Aktenbestände und Herausgabe wird gebeten. Neben dem Pfarrer unterzeichneten den Brief der Kirchenpfleger Pfeffer und als weitere Mitglieder der Kirchenverwaltung die Bürger Andre Späth, Andreas Plötz und Wolfgang Wurm. Letzterer stammte aus Großaign.
Der Marktschreiber als Kirchenschreiber
Hier erhebt sich die Frage wieso die zur Kirche gehörenden Akten damals im Rathause verwahrt waren. Das erklärt sich daraus, dass über Jahrhunderte hinweg in kleineren Städten, z. b. auch in Furth, die jeweiligen Stadt- oder in Eschlkam die Marktschreiber zugleich auch als „Kirchenschreiber“ fungierten. Der über die Zeit anfallende Schriftverkehr der Pfarrei, die Rechnungen gebunden in Protokollbüchern (das älteste der Pfarrei stammt aus dem Jahr 1692), wurden im Archiv des Rathauses abgelegt und so über lange Zeit hinweg dort aufbewahrt.
Das sollte sich nun ändern: Der Magistrat lehnte vorerst das Gesuch am 4. April rundweg ab, hauptsächlich mit dem Hinweis, es sei „seit unfürdenklichen Zeiten“ schon immer Praxis gewesen, die zur Kirche gehörenden Akten im Rathause auf zu bewahren. Pfarrer Pittinger ließ nicht locker. Er argumentierte, „daß die Kirchenverwaltung dem Magistrate nicht subordiniert (untergeordnet) ist. Wahr ist auch, daß früher die Kirchensitzungen im Rathause, in der Privatwohnung des Markt- und Kirchenschreibers abgehalten wurden“. Vor allem aber wies er darauf hin, dass „die Transferierung der Kirchenkasse vom Rathause in das Pfarrhaus curatellseits (behördlericherseits) bereits am 7. Januar 1852 genehmigt worden sei.
Diese Auszüge seien nur einige der über Wochen hin umfangreich sich gestaltenden Auseinandersetzungen zwischen Pfarrer Pittinger und dem Magistrate. Letztlich entschied in dieser Angelegenheit am 22. Juni 1859 das Landgericht Kötzting, „daß das feuerfeste Registraturlokal im Pfarrhause sowie auch die Sakristei und das Oratorium in der Pfarrkirche eine größere Sicherheit in Aufbewahrung von Registraturgegenständen gegen Feuersgefahr darbieten“. Der Umzug wurde angeordnet, jedoch mit der Einschränkung, dass „jene Akten welche gemischte Gegenstände (Themen) der Kirche und der Gemeinde enthalten, in der magistratischen Registratur zu belassen seien“. Pfarrer Karl Pittinger hatte den sog. „Archivstreit“ gewonnen. Im gleichen Jahr aber wurde er von Pfarrer Franz Kaspar Lutz in seinem Amte abgelöst.
Werner Perlinger
Wenn der Markt die Pflegschaft über halbwaise Kinder übernimmt
+Eschlkam. „Das Ableben der Inwohnerstochter Katharina Korherr und Pflegschaftübernahme deren uneheliches Kind Rupert betr, 1859“, so titelt ein Akt aus dem Gemeindearchiv, der von seinem Inhalt her einen tiefen Einblick gibt, wie ausgeprägt damals das soziale Empfinden der Behörden mit den damit betroffenen Personen war. So erlässt bereits am 12. Mai 1857 der Landrichter von Kötzting, Paur an den Magistrat die Weisung, „den nunmehrigen Aufenthalt der Katharina Chorherr binnen längstens sechs Tagen hierher zur Anzeige zu bringen“. Es scheint zunächst eine längere Pause eingetreten zu sein, denn eine erneute Anfrage des Landgerichts erfolgt erst am 22. Januar 1859 zum Thema „das Ableben der Katharina Korherr von Eschlkam“, es seien die nächsten Verwandten der am 14. Januar in Oberndorf, Landgerichts Landau verstorbenen 27 Jahre alten Bürgerstochter Katharina Korherr alsbald hierher zur Anzeige zu bringen. Dazu informiert der Magistrat, dass die Korherr die außereheliche Tochter der ledigen bereits verstorbenen Katharina Hastreiter sein solle. Der Vater „soll Adam Korherr geheißen haben“. Der damalige Pfarrer Pittinger ergänzt am 30. Januar dazu, „in der Taufmatrikel steht nebst vielen Individuen, die den Namen Korherr und Hastreiter führen, eine Katharina Korherr als uneheliches Kind des Adam Korherr, Inwohnerssohnes von Furth und der Katharina Hastreiter, Inwohnerstochter (nicht Bürgerstochter) eingetragen, geboren am 6. März 1832 zu Eschlkam. Die Pathin war Katharina Girschak, Inwohnerin l(edigen) St(andes). Die Mutter Katharina Hastreiter scheint jene Person zu sein, welche am 15. April 1856 unweit Eschlkam nahe beim Karpflingholz durch den Donnerkeil getötet wurde, angeblich 58 Jahre alt“.
Der „Donnerkeil“ als Blitz
Pfarrer Pittinger meint mit dem Begriff „Donnerkeil“, dass die Hastreiter durch Blitzschlag getötet wurde. Dazu sei ergänzend anzumerken, dass unsere Vorfahren lange noch im Glauben waren, der von den Germanen verehrte Gott Donar schleudere in einem Feuerstrahl (der Blitz) die nach ihm benannten Geschosse während des Gewitters vom Himmel auf die Erde. Immer wieder zufällig aufgelesene Faustkeile und Steinbeile, in Wirklichkeit steinzeitliche Geräte unserer Vorfahren, wurden mangels damaliger Kenntnis als die von Donar im Zorn auf die Menschen auf der Erde geschleuderten sog. Donnerkeile angesehen, daher auch der bezeichnende Name. Ebenso hat sich im Volksmund noch das Schimpfwort „Donnerkeil“ erhalten – im fränkischen Dialekt ausgesprochen auch als „Dunnerkeil“.
In einem weiteren Schreiben erfahren wir, dass der kleine Rupert am 25. März 1857 geboren wurde (daher die obige Anfrage des Landrichters) und bei der Häuslerswitwe Steinmeier in Pilsting untergebracht sei. Dazu machte der Armenpflegschaftsrat zunächst den Vorschlag, „das Kind der Defunctin“ (der Verstorbenen) möge in Pilsting belassen oder bei den Eltern des außerehelichen Vaters Adam Liebl aufgezogen werden. Schließlich einigte man sich, das Kind doch nach Eschlkam zu holen. Mit dieser Aufgabe wurde die Polizeidienerstochter Barbara Pinzinger beauftragt. Sie hatte den kleinen Rupert in Pilsting bei der „Hirtenswitwe“ Staimer abzuholen und sie kam am Samstag, 19. März mittags 12 Uhr „mit dem befraglichen Kinde“ in Eschlkam an. Zugleich berichtete die Pinzinger, „daß der Kindsvater sich beim Wirte Werinberger in Pilsting im Dienste befinde“. An Reisekosten und sonstigen Auslagen erbat die Pinzinger 9 Gulden, die sie aus der „Armenkasse“ auch sofort erhielt.
Noch am gleichen Tage, am 21. März 1859, beschloss der Armenpflegschaftsrat, dem Bürgermeister Schmirl vorstand, das Kind Rupert dem verheirateten Zimmerergesellen Michl Zellner gegen „eine jährliche Entschädigung von 23 Gulden zur Erziehung und Verpflegung zu überlassen“. Zellner, Mieter wohl noch in Nr. 71, geb. 1794 und seit 1836 verheiratet mit A. Maria Rötzer, bürgerliche Bäckerstochter von Nr. 19, verpflichtete sich „das Kind ordentlich und christlich zu erziehen und für das leibliche und geistige Wohl nach bestem Gewißen zu sorgen“. Auch versprach er den kleinen Rupert „fleißig in die Schule zu schicken und demselben überhaupt die nöthige Wart und Pflege angedeihen zu lassen“.
Zugleich stellte man fest, dass sich „bei der Hausbesitzerswitwe Katharina Fischer von hier (wohl Haus Nr. 57) noch mehrere Effekten (Sachen) der verlebten Katharina Korherr befinden“, Daraufhin ließen sich Bürgermeister Schmirl und der Marktschreiber Reitinger diese Gegenstände zeigen und aushändigen. Die Fischer erklärte auch, dass „ihr diese Effekten die Defunctin bei ihrer Abreise zur Aufbewahrung gegeben habe.“ Es waren dies „ein kleines unangestrichenes Tischchen, eine alte Bettstatt, eine alte Truche (Truhe), die wegen Fehlen des Schlüssels der Schlosser Joseph Römisch öffnen musste“. In ihr waren verschiedene Textilien, darunter ein Ober- und ein Unterbett. Sämtliche Gegenstände wurden sofort dem Michl Zellner übergeben um sie bei Bedarf für den Knaben Rupert nutzen zu können.
In nächster Zeit wurden noch einzelne ausstehende finanzielle Fragen gelöst, wie beispielsweise die Begleichung der „Funeralkosten“ (Kosten der Beerdigung), die vom Pfarrer Müllner aus Pilsting an den Magistrat gemeldet wurden. Sie beliefen sich auf 2 Gulden 32 Kreuzer. Auch erfahren wir, dass die Korherr bis zu Ihrem Tode in Oberndorf bei dem Bauern Xaver Steinbeisser als Magd in Diensten war. Dieser ließ den von der Magd Korherr benützten Kasten (Schrank) samt Inhalt an die Gemeinde Eschlkam schicken. Insgesamt beinhaltete der Schrank 49 Gegenstände, die vom Magistrat zur Finanzierung der Erziehung des kleinen Rupert versteigert wurden. Der Erlös betrug am Versteigerungstage, dem 26. Januar 1860, über 32 Gulden.
Werner Perlinger
Der Magistrat Eschlkam hatte auch polizeiliche Aufgaben zu erfüllen (1855/56)
+Eschlkam. Im Bereich des Marktes und der bürgerlichen Gründe besaß der Marktrat auch die Polizeihoheit. Daher hatte er stets energisch gegen Trunkenbolde, Spieler und auch gegen Personen vorzugehen, die es mit der Moral nicht genau nahmen. Zur Ausführung von Anordnungen der Marktbehörde war stets der sog. Marktdiener verpflichtet, in den jeweiligen Fällen auch als Polizeidiener bezeichnet. Wurde bereits etwas früher über einzelne Ereignisse aus dem Polizeibericht von 1821 geschildert, so seien in dieser Abhandlung dem Leser einzelne Vorkommnisse aus dem Jahreszyklus 1855/56 unterbreitet.
So wurde am 4. Oktober 1855 der „nicht in bestem Rufe stehende“ Dienstknecht Martin Gmach von Schwarzenberg aufgrund einer Anzeige der Gendarmerie, erfolgt durch den Gendarm (alte, sprachlich französische Bezeichnung für einen Polizisten auf dem Lande) Kilian Meier vom 27. August, zu Bürgermeister Simon Moreth und dem Marktschreiber Beutlhauser in das Rathaus bestellt, „wonach er am Sonntag, den 26. August an einem öffentlichen Platz und zwar während des Gottesdienstes mit einem bei sich führenden spitzigen, im Griffe feststehenden Messer betreten worden ist, vorgehalten und er sofort zur Verantwortung dagegen aufgefordert“. Gmach gab an, „er wolle nicht in Abrede stellen, am bezeichneten Tage ein im Griff feststehendes Messer bei sich getragen zu haben, weil er ein solches Messer stets bei sich führen müsse, da er Pferdeknecht sei“. Dazu sei erklärt, dass die Pferdeknechte, auch die Kutscher in der Regel solche Messer stets mit sich führten, um in einem Notfall, sollten beispielsweise die Pferde einmal „durchgehen“, sofort die Zugstränge eines Gefährts durchschneiden zu können, um so einen schlimmen Unfall zu verhindern.
Dieses an sich plausible Argument half dem Gmach nicht. Er wurde mit einem dreitägigen Polizeiarreste belegt und zwar deshalb, weil er an einem Sonntag und nicht während seiner Arbeit am Werktag mit dem Messer aufgegriffen wurde. Auch sei das von der Gendarmerie abgenommene Messer „zu confiszieren“ (zu beschlagnahmen). Dazu hatte Gmach auch noch die Kosten des Verfahrens zu tragen. Begründet wurde die Strafe mit dem Hinweis, „das Tragen spitziger, im Griff feststehender Messer ist verordnungsgemäß verboten.“ Gmach akzeptierte den Beschluss des dreitägigen Freiheitsentzugs, bat aber zugleich diesen Arrest an drei für ihn freien Arbeitstagen absitzen zu dürfen, was auch gewährt wurde. Das Urteil unterzeichnete er mit einem +, da er des Schreibens unkundig war. Bürgermeister Moreth und Marktschreiber Beutlhauser beglaubigten das „Handzeichen“ des Gmach mit ihrer Unterschrift.
Das Urteil ist insoweit zu verstehen, als in früheren Zeiten bei vielen Raufereien in den Wirtshäusern, oder auch bei Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen Messer zum Einsatz kamen, was für manche Beteiligte oft furchtbare Folgen hatte. So manches junge Leben endete bei Raufereien jäh und stürzte davon betroffene Familien in ein großes Unglück. Noch heute wird manchmal an derartige Ereignisse erinnert. Insoweit ist auch das Urteil des Magistrats gegenüber Martin Gmach zu verstehen.
Die Zugochsen geschlagen
Ein weiterer Fall hatte den Magistrat bereits einige Tage vorher am 1. Oktober beschäftigt. So hatte Gendarm Kilian Meier an den „löblichen Marktsmagistrat dahier“ einen Fall von Tierquälerei gemeldet. Demnach habe er schon öfters den Bäckermeister Georg Hastreiter (damals in Nr. 23/ nun Marktstraße 2) bei „Mißhandlung seiner Ochsen an diesem Berge getroffen und zwar da allgemein bekannt ist und nicht selten vorkommt, daß Hastreiter mit einem derartigen schwerbeladenen nur mit zway Ochsen bespannten Wagen ohne Beihilfe von Personen diesen Berg nicht befahren konnte, und hierwegen Hastreiter seine Ochsen durch gewaltsames Schlagen und Stoßen über die Füße, auf den Kopf und Rücken mit dem unteren Theile seines Peitschenstockes, dann durch Stoßen mit dem Stiefel oder Holzschuh auf die Füße und auf das Maul seine Ochsen, respektive seine armen Thiere auf die grausamste Art und Weise mißhandelte“. Bei dieser Situation eilten gerade anwesende Personen und auch die Nachbarn „in aufbrausender Hitze (deshalb wütend) herbei und halfen aus Erbarmen um die armen Tiere tatkräftig, dass die Fuhre des Hastreiter endlich die Anhöhe des Berges erreicht hatte“.
Zugleich meldete Meier, dass er und sein Kollege Ritzinger sich heute vom Fenster des Gendarmerielokals aus persönlich überzeugten, dass der Bäckermeister Hastreiter „auf seinem Wagen (wiederum) eine solche Fuhr Streu hatte, daß es bereits unmöglich war, daß dieselbe ein Paar Ochsen über den hohen Berge heraufziehen konnten, was auch durch das wüthende Schlagen mit einem Briegel (nicht gelang), und als ihm derselbe genommen wurde, er sofort mit den Füßen“ die Tiere traktierte. Nur mit Hilfe mehrere Nachbarn gelang es die schwere Fuhre über den Berg zu bringen. Hastreiter wurde nach diesem Vorfall sofort vor den Magistrat zitiert. Zu seiner Entlastung gab er an, er habe die Tiere nicht misshandelt, sondern nur „wie er es immer tun müsse, mit Schlägen zum Zuge angetrieben, da sie ohne Anwendung der Peitsche gar nicht ziehen wollen“. Der Magistrat zeigte sich von den Angaben Hastreiters unbeeindruckt. Eben weil er „mit einem Prügel sein Zugvieh geschlagen und so mißhandelt habe“ sei er „für den diesen Fall mit einem Verweis (hier eine Abmahnung) zu bestrafen“. Außerdem müsse er die Verfahrenskosten tragen.
Tierquälereien dieser Art kamen beim Fuhrverkehr bis weit in das 20. Jahrhundert hinein immer wieder und nicht selten häufig vor. Erst mit dem Einzug der Technik, z.B. mit der Einführung des LKW für den Fuhrverkehr oder den Traktor in der Landwirtschaft, endeten diese in keiner Weise hinnehmbaren Vorkommnisse.
Werner Perlinger
Das Armenhaus wurde gründlich renoviert
+Eschlkam. Das Armenhaus, einst Bestandteil einer jeden Siedlung, ob Stadt, Markt oder Dorf, entwickelte sich in der Frühen Neuzeit aus dem mittelalterlichen Hospiz und Spital. Oft war es gekoppelt mit einem Waisenhaus, einem Gefängnis, einem Krankenhaus oder einem Arbeitshaus. In Armenhäusern lebten vor allem ältere Menschen, die nicht mehr selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten. Sie erhielten dort einen Wohnplatz und tägliche Verpflegung. Die Armenhäuser gehörten früher zum Stadtbild und nahmen nur verarmte Bewohner aus der eigenen Stadt auf. Auch in fast jedem Dorf gab es ein eigenes Armenhaus. Fremden wurde diese Altersversorgung nicht zuteil. Im Gegensatz zu den Arbeitshäusern waren die Armenhäuser in der Regel keine geschlossenen Anstalten und die Aufnahme war - zumindest formal - freiwillig.
Finanziert wurden Armenhäuser in der Regel durch Zuwendungen wohlhabender Bürger sowie durch Zuschüsse von Kommune und Kirche. Auf dem Land wurde die Armenversorgung teilweise auch aus dem gemeinschaftlichen Gut (die Allmende) beglichen. Der Begriff „Armenhaus“ wird in nichthistorischen Kontexten praktisch nur noch im übertragenen Sinne benutzt, beispielsweise indem ein besonders armes Land als das „Armenhaus des Kontinents“ charakterisiert wird.
Verschiedene Nutzung
Auch der Markt Eschlkam besaß ein solches Armenhaus in dem bedürftige Mitbürger wohnen konnten, wo völlig mittellose Personen des Marktes eine Herberge fanden. Dieses Anwesen hatte früher die Hausnummer 49. Die Einrichtung war sicher sehr alt. Im Jahr 1806 wird es bei der Assecuranzversicherung als „Hüthaus“ tituliert, da das Gebäude zugleich als Wohnstätte für die Gemeindehirten diente. Im Jahr 1860 wurde die Einrichtung am Fuße der sog. „Hadergasse“, heute Steinweg 6, ebenso als „Hiethaus“, zugleich aber auch als Arrestlokal der Marktgemeinde für Vaganten und Bettler genutzt (siehe dazu Artikel: „kein taugliches Arrestlokal im Markt“). Mittlerweile ist das alte Gebäude abgebrochen und durch einen Neubau mit drei Eigentumswohnungen ersetzt – Steinweg 6.
Wir schreiben das Jahr 1856. Das Armenhaus befindet sich in einem sehr baufälligen Zustand. Eine Reparatur der gefährdeten Bereiche ist dringendst nötig. In einem im Monat April dafür aufgestellten Kostenvoranschlag wird darüber detailliert berichtet. Demnach droht die nördliche Haupt- oder Giebelmauer, ausgeführt mit Bruchsteinen und Lehm, einzustürzen. Sie müsse abgetragen, neu und anstatt mit Lehm mit guten Kalkmörtel und Bruchsteinen wieder hergestellt werden. Sie maß in der Länge 30 ½ Fuß, 10 Fuß in der Höhe und 2‘ Mauerdicke. Ein >Fuß< entspricht etwa 30 cm. Dafür wurden Kosten in Höhe von 58 Gulden errechnet. Auch sei die südliche und östliche Seite des Gebäudes „gut zu verspannen und mit gutem Kalkmörtel zu verputzen“ - Kosten etwa 12 Gulden. Auch sei „der Kamin bis auf das Hauptmauerwerk abzutragen und müssen 2 Kamine nebeneinander wegen des Druckes des Rauches neu 7 Fuß hoch aufgeführt werden.“ Die Kosten wurden auf 16 Gulden geschätzt.
Als nächstes wurden die nötigen Zimmermannsarbeiten berechnet. Dabei erfahren wir, dass die nördliche Giebelmauer aus Holz „aufgezimmert ist“. 16 Gulden wurden dafür veranschlagt. Ferner sei „das Legschindeldach umzulegen und mit neuen Legschindeln zu ergänzen“; geschätzt auf 15 Gulden. 20 Gulden wurden von den Kostenschätzern errechnet für die Schreiner-, Schlosser- und Glaserarbeiten. So seien allein 10 Fensterstöcke aus Föhrenholz mit den dazu nötigen Fenstern aus Glas herzustellen. Dieser Aufwand wurde ebenso auf 20 Gulden geschätzt.
Aus diesen Angaben lässt sich auch erahnen, welches Aussehen das Armenhaus des Marktes im 19. Jahrhundert hatte. Insgesamt kamen die Schätzer für die grundlegende Renovierung des Gebäudes auf etwa 147 Gulden an aufzuwendenden Ausgaben.
Die Eschlkamer haben sich offenbar Zeit gelassen, denn am 8. Juli wendet sich die königliche Bauinspektion Deggendorf an das Landgericht Kötzting mit dem Hinweis, „der Kostenvoranschlag für Baureparaturen an dem Armenhause enthält allerdings nur die allernotwendigsten Baufälle, deren Wendung umso notwendiger erscheint, als der Einsturz der Giebelmauer in nächster Zeit zu gewärtigen ist.“ Das Haus befand sich offenbar schon länger in einem sehr ruinösen Zustand. So seien auch die „Bretterböden unten durch, welche zugleich die Decken für das untere Stockwerk bilden, gleichfalls gänzlich verfault und das betreten derselben mit Gefahr verbunden“. Daher wird gefordert den Magistrat anzuhalten im Rahmen weiterer Sanierungsmaßnahmen „hierauf Bedacht zu nehmen“.
Am 17. Juli wendet sich das Landgericht Kötzting wegen dieser „Baufälle an dem Armenhause“ an den Magistrat und forderte unverzüglich die Reparaturarbeiten zu beginnen und darüber regelmäßig Vollzug zu melden. „In Ermangelung eines Armenfonds wird bis zum veranschlagten und festgesetzten Betrage von 147 Gulden die „Kuratelgenehmigung (von Amts wegen) ertheilt“ und genehmigt. Auch habe die Bauausführung durch einen „Werkmeister zu geschehen, dessen Wahl dem Magistrate überlassen ist, doch ist der Gewählte anzuzeigen“.
Am 2. August wird vom Magistrat „gehorsambst berichtet, daß mit den Reparaturarbeiten bisher noch nicht konnte begonnen werden, da die nötigen Baumaterialien erst herbei geschafft werden müssen“. Gehofft wurde, dies in kommender Woche zu schaffen. Als „Werkmeister“ für die Arbeiten wurde der Further Stadtmaurermeister Anton Großer ausersehen. Die Renovierungsarbeiten konnten endgültig beginnen. Darüber gibt es eine detaillierte Abrechnung, so dass die einzelnen Leistungen aller daran beteiligten Handwerker einzeln nachvollzogen werden können.
Werner Perlinger
Wurde eine harte Strafe für die Beleidigung des Marktschreibers verhängt?
+Eschlkam. Eine zentrale und gehobene Stellung in einer Stadt oder einem Markt hatte über die Zeiten hinweg - wie in unserer Reihe schon mehrfach erwähnt - der jeweilige Stadt- oder Marktschreiber, der stets eine für das zu bewältigende Amt ausgerichtete, juristisch orientierte Ausbildung genossen hatte. In heutiger Zeit nennen wir ihn den „geschäftsleitenden Beamten“ einer Gemeinde.
Wir befinden uns noch in der Zeit der sog. Aufklärung, einer Epoche in der bei der Bevölkerung auch die Ehrerbietigkeit vor allem gegenüber Personen nachgelassen hatte, die als Vertreter von Behörden ihre Aufgaben wahrzunehmen hatten. Es sei daher ein Fall geschildert, der sich im Jahr 1782 in Eschlkam zugetragen hatte. So klagte am 19. Hornung (die alte Bezeichnung für Februar) Wolfgang Andrä Pach, churfürstlicher Kirchen- und Marktschreiber, contra Georg Brändel (Brandl) des Rats alldort“: So habe der Beklagte Brandl am 8. dieses Monats den Kläger (Pach) in seiner eigenen Behausung (im Rathaus) in Anwesenheit vieler Leute ohne „mindest gegebener Ursach erweißlichermaßen einen Schlifl, Kalfack, Hurnbuben (geheißen), und daß sich derselbe einstmals von seiner Hur abgeschworen habe, injuriert (beleidigt)“. Zu diesen Schimpfworten sei erklärt: ein „Schlifl“ bedeutet große Geringschätzung, besonders was in diesem Fall die berufliche Tätigkeit betrifft. Damit wurde Pach wohl als für die Marktgemeinde „unnützer Mensch“ tituliert. Als „Kalfakt“ wird eine Person bezeichnet, die nur niederste Arbeiten verrichten könne, keineswegs aber anspruchsvolle. Beim dritten Schimpfwort erübrigt sich die Erklärung. Gerade die ersten beiden Schimpfworte waren für den Beamten Pach, was seine Tätigkeit betraf, eine besonders schwere Beleidigung. Der dritte Begriff ist für sich allein moralisch besonders schwer beleidigend.
Wer war nun Georg Brändel, eigentlich Brandl. Er findet sich damals als Besitzer des Anwesens Nr. 20/Marktstraße 1. 1776 übergibt Katharina, Witwe von Thadee Leitermann, Kramer, die Behausung - zwischen Johann Georg Hastreiter, Bürgermeister und Weißbäcker und Wolfgang Hausladen, „Würth“ - an Hans Georg Brandl, lediger Krämersohn von Rimbach - er heiratet sie. Im gleichen Jahr am 26. März verkaufen Hans Georg Brandl, Kramer und Katharina an „Joseph Späth, Inwohner und Fleischhacker, das Burgerhäusl - mit dazu 1 Tisch, 1 eisernen Höllhafen und 1 Kupferkessel“.
Die beleidigenden Worte empfand der Marktschreiber gerade von seiner Position her als äußerst schwerwiegend, wenn es heißt, „da nun (der) Kläger greuliche und in der That durch Mark und Bein dringende Injurien, da besonders auch derselbe mit kurfürstlichen Pflichten begabet ist, zur Abscheuch (Abschreckung) anderer Personen, nicht erdulden kann“. Gemeint ist hiermit, dass sich Pach aufgrund seiner Position und seines Berufes besonders verletzt fühlte, wenn er gegenüber den Ratsherren und dem Bürgermeister vorbringt, dass ihm diese „Injurien (Beleidigungen) so schwer am Herzen liegen müssen, daß er lieber 500 Gulden verloren haben würde, als dergleichen zu erdulden“. Auch würde er seine im Gegensatz zu den Vorwürfen gegebene Unschuld „mittels (eines) körperlichen Eydes bestätigen (wozu er) nicht ungeneigt ist“, wohl wegen des Vorwurfes er sei ein „Hurnbube“.
Pach stellte daher an den „löblichen Magistrat das gehorsame Belangen, den Brandl in das eingeklagte Quantum zu condemnieren“ (entsprechend zu verurteilen), wobei er hinsichtlich des Strafmaßes keinen Einfluss nehmen wolle. Selbst gewusst (habe) er, daß er nicht zugleich Actuarius (Schreiber während der Verhandlung) und Partei sein könne“.
Die Zwischenantwort
Der Magistrat äußerte sich dahingehend, dass „gegenwärtiges Judicium (der Streitfall) nicht nach Vorschrift des Codex iuris (Gesetzbuches) bestellet seye, weil der (dafür) erforderliche Actuario (Schreiber) fehlet“. Da der beklagte Brandl mittels „obrigkeitlicher Signatur“ für heute vorgeladen worden sei „und der Herr Kläger wegen seiner besitzenden Einsichten und gerichtlichen Erfahrenheit selbst gewußt (habe), daß er nicht zugleich Actuarius und Parthey sein könne, sondern (ihm) die Bestellung dessen allein obliege (nötig sei), so muß der beklagte Brandl bis dahin all seine Einwendungen in Salvis setzen (von Verdacht reinigen) und den bittlichen Antrag dahin machen, daß man den H. Kläger ob culpam commissam (wegen des begangenen Vergehens) in die heutige gerichtlichen expensen (Kosten) und auch dahin condemnieren (verurteilen) möchte, daß er dem Brandl’schen Rechts Freund (dessen) Rat: der Reiß, und in anderweg befriedigen sollte, geschieht nun dieses, so wird sich Beklagter schon vernemen lassen“.
Eine Resolution darauf
Ob dieser nicht einfachen Rechtslage gab der Magistrat folgende Stellungnahme ab: Man wolle demnächst von „obrigkeitswegen den Bedacht dahin nehmen, daß ein ohnehin in Pflichten stehender Actuarius beygezogen“ (wird), damit so das „Judicium (das Urteil, der Urteilsspruch) rechtmäßig hergestellt werde. Indessen bleibt die Sach wie auch die von dem Brandl anverlangten Kösten in Suspense (vorläufig nur festgestellt), welches den beiden Theilen zur Nachricht“ gebracht wird.
Welchen Verlauf die ganze Angelegenheit noch nahm, bzw. wie es für den beklagten Brandl ausgegangen ist, kann nicht dargestellt werden, da gerade für das Jahr 1782 die Niederschriften im Rats- und Verhörsprotokoll ab dem Monat August bis zum Jahresende fehlen. Angenommen darf werden, dass für Brandl eine empfindliche Strafe folgte.
Werner Perlinger
Der Magistrat Eschlkam hatte auch polizeiliche Aufgaben zu erfüllen (1821)
+Eschlkam. In seinem Gemeindebereich besaß der Marktrat einst die Polizeihoheit. Daher hatte er stets energisch gegen Trunkenbolde, Spieler und gegen Personen vorzugehen, die es mit der Moral nicht genau nahmen. Zur Ausführung einzelner Anordnungen der Marktbehörde war der sog. Marktdiener verpflichtet, in den jeweiligen Fällen meist als „Polizeidiener“ bezeichnet. Zu seinen Aufgaben gehörte u.a. die Überwachung der im Markte bei einzelnen Bürgern in Diensten stehenden Personen, wie uns eine überlieferte Liste beispielsweise vom 19. April 1821 mitteilt.
Tituliert ist sie als „Verzeichnis der hier sich befindlichen Dienstbothen, welche mit keinem Wanderbüchlein versehen sind“. Gemeint sind damit nur die Knechte und Mägde, nicht aber Personen, die eines Handwerks kundig sind. Aufgelistet sind sie nach einer festen Rubrik, und demnach wird genannt der derzeitige, dann der vorherige Dienstherr. Als letzter sehr wichtiger Punkt gilt die Beurteilung nach „Aufführung, Fleiß und Treue“.
16 Personen, die bei der Bürgerschaft von Eschlkam im Jahr 1821 in Diensten standen, sind aufgelistet. Als erster wird ein Paul Schamberger aus Warzenried erwähnt, arbeitend bei Joseph Schreiner, Ökonomiebesitzer. Schreiner bewirtschaftete damals den „Hoamaterhof“ Nr. 37/38, jetzt Marktstraße 11. Vormalig war Schamberger bei Jakob Baumann in Großaign in Arbeit. Seine Arbeitsleistung wie auch sein allgemeines Verhalten wurden als „gut“ gewertet.
Als dritte Person nennt die Liste eine Barbara Pomann. Sie arbeitete bei dem Metzger Anton Riederer, Haus Nr. 24, seit 1896 Standort des alten Schulhauses, Waldschmidtstraße 1. Ihr vorheriger Brotgeber war der Mesner Joseph Zirngiebl. Er wohnte im „Mesnerhaus“ (Nr. 27/Kirchstraße 3). Geboren am 21. Januar 1783 war er seit 23.11.1808 verheiratet mit Anna Maria Januel, Lehrerstochter von Rimbach. Zum Witwer geworden will er 1844 Therese Stauber, Bräumeisterstochter (28 Jahre alt) heiraten. Die Genehmigung wird ihm zunächst versagt, da er als „veraltert und abgekarpfet“ gilt. Auf seinen Einspruch hin erlaubte jedoch das Landgericht Kötzting als höhere Instanz die Heirat. Nomen est Omen - der Name „Zirngibel“ bedeutet sprachetymologisch den „Raufbold“, eben einen streitbaren Menschen. Barbara Pomann diente 1821im Mesnerhaus als Magd und Hausangestellte.
Knechte und Mägde aus Böhmen
Aus dem Nachbarland Böhmen kamen einzelne Bedienstete wie Maria Weißenburger aus Maxberg/Maxov. 1821 arbeitete sie im Gasthaus des Wolfgang Hausladen (einst Nr. 21). Es war üblich, dass oft die Bewohner aus den grenznahen böhmischen Dörfern bei den Bauern und in den Märkten im Hohenbogen-Winkel um Arbeit nachsuchten und sie auch fanden, da gerade diese Leute allgemein als arbeitsam und fleißig galten. Das traf z. B. für Michl Böhm zu, der aus Weißensulz nach Eschlkam kam und bei dem Bäcker Wolfgang Nachreiner in Diensten war. Nachreiner betrieb kurzzeitig eine Bäckerei im Anwesen Hsnr. 61/jetzt Großaignerstraße 1. Aus St. Katharina im Nachbarland war Anna Vogl bei dem Metzger Joseph Späth tätig und dies schon seit längerer Zeit. Metzger Späth bewirtschaftete das Anwesen Nr. 5/ heute Further Straße 3. Dieser Metzgermeister hatte einen ökonomischen Weitblick, als er in den Jahren 1826/27 in eigener Initiative neben seinem eigenen Anwesen das sog. „Mauthaus“ erbaute. Dieses Haus diente über lange Zeit den in Eschlkam im Zollamt tätigen Beamten als Wohnstätte. Erwähnt sei noch, dass seit frühesten Zeiten, mindestens aber seit dem 16. Jahrhundert bis heute die Familie Späth stets auf dem Anwesen Further Straße 3 ansässig war und ist.
Im Walde das Vieh hüten
Im Jahr 1788 sollte Geld in die stets klamme Kommunalkasse fließen. Daher wurde am 16. Februar die Marktführung beauftragt die gesamte Bürgerschaft auf das Rathaus einzuberufen und zu fragen, „ob sie den mittlerweile auf 72 Lüst (Lose, Anteile) vertheilten Kammerwald“ kaufen wolle. Der „Karpfling“ ist die breit sich dehnende Waldfläche nördlich des Hohenbogen, seit 1972 zur Oberpfalz gehörend. Der Verkauf bzw. die Versteigerung klappte und die Eschlkamer Bürger erhielten Waldanteile zur Mehrung ihres Grundbesitzes (siehe dazu den Beitrag "Als der „Cameralwald Karpfling“ im Jahr 1788 an die Eschlkamer Bürger verteilt wurde"). War die Waldung vorher in kommunalen Besitz, so war sie nun auf viele Bürger aufgeteilt. Vorher war es üblich in den dem staatlichen Fiskus oder den Gemeinden gehörenden Waldteilen in der Zeit, als die über das ganze Jahr gängige Stallhaltung noch nicht üblich war, das eigene Vieh zum Futterfraß in die Wälder zu treiben. Nachdem aber sämtliche Waldbereiche des Karpfling in Privatbesitz gekommen waren, konnten diese „Hütgewohnheiten“ nicht mehr geduldet werden, da das Vieh nicht nur im Anteil ihres Besitzers das Futter suchte, sondern auch in den benachbarten Gefilden. Die gewiss nicht leichte Aufgabe dies zu verhindern oblag dem Polizeidiener Franz Pinzinger.
So erstellte er am 31. Juli 1820 eine Liste mit den Namen der Ökonomiebürger, die sich an die neuen Gegebenheiten offenbar nicht hielten. Zwei Tage vorher, am 29. Juli hatte Pinzinger im Karpfling den „Hoamater“ Joseph Weber (heute Penzkofer) mit 18 „Stück Rindvieh“ angetroffen; und den „Hoamater“ Franz Leitermann Waldschmidtstr. 10) mit 12 Rindern. Anton Kolbeck, „Hoamater“ (Waldschmidtstr. 8), hatte 10 Stück, Joseph Schreiner (Marktstr. 11) als letzter „Hoamater“ 12 Stück Rindvieh im Karpfling weiden lassen. Mit geringeren Stückzahlen folgten noch der Gastwirt Wolfgang Hausladen, der Bäcker Anton Hastreiter und der Hutmacher Jakob Fischer. Über das Strafmaß, das die Marktbehörde zu erheben hatte, berichtet die Akte nicht. Ein striktes Hüteverbot war gewiss die unmittelbare Folge.
Werner Perlinger
Eine Erbaufteilung im Jahre 1806 - aus einem Briefprotokoll
+Eschlkam. Ein wesentliches Element der zivilen Gerichtsbarkeit des Marktes Eschlkam war bis zum Jahr 1808 die Erledigung aller anfallenden notariellen Aufgaben. Die Marktbehörde, hier der Marktschreiber als juristisch vorgebildete Persönlichkeit, protokollierte im Einvernehmen mit dem Amtsbürgermeister und den Ratsherren sämtliche Kaufverträge und Übergaben der Häuser und Grundstücke, Heiratsverträge und Testamente, Bürgschaften, Leihverträge. Mit dem Siegel erlangten die Niederschriften ihre amtliche Gültigkeit. Die darüber ausgefertigten originalen Urkunden erhielten die beiden an einem dinglichen oder sonstigen Rechtsgeschäft beteiligten Parteien. Jeder Vorgang wurde für eine spätere Überprüfung und zur amtlichen Erinnerung für die Marktbehörde selbst eigens in einem sog. Briefprotokoll niedergeschrieben. Von Eschlkam sind sie uns ab dem Jahr 1691 bis 1808 erhalten. So arbeitete die Führung des Marktes - vorrangig der Marktschreiber - auch als Urkundenbehörde und erledigte so die Aufgaben der heutigen Notariate.
Neben dem genannten Aufgabenbereich gab es auch Erbauseinandersetzungen zu regeln. Als ein Beispiel dafür sei ein sog. „Verteilungsbrief“ aus dem Briefprotokoll des Jahres 1806 angeführt, wobei die Inhalte der Verständlichkeit halber sprachlich angeglichen wurden. Diese Niederschrift wurde am 9. Januar nach dem Ableben von Elisabeth Hausladen, „verwittibte burgerliche Ausnahmsnießerin (Austräglerin) allhier wegen ihrem zurückgelassenen Vermögen“ verfasst. Zunächst zur Familie Hausladen in Eschlkam: Urspünglich aus dem Dorf Grabitz stammend, hatte sie an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert das Anwesen Nr. 21 an der Marktstraße inne. 1796 übergab der Viehhändler Wolfgang Hausladen das Anwesen an seinen Sohn Wolfgang, geführt als Handelsmann und Gastgeber. Des Vaters zweite Frau Elisabeth verstarb laut Sterbematrikel am 3. Januar 1806 „als bürgerliche Gastgeberein“ an Entkräftung im Alter von 73 Jahren, 6 Tage vor Erstellung des Verteilungsbriefes. Medizinisch betreut hatte sie der „Chyrurg“ (damals der Wundarzt, auch Bader) Schöpperl aus Furth. Der Hausname des Anwesens lautete bis in die Neuzeit herein „beim Schmausn“, erinnernd an die Vorbesitzer der Familie Hausladen. Das Haus ist schon lange abgebrochen, heute der Hofbereich der Firma Georg Wanninger.
Einleitend werden in dieser Niederschrift die möglichen Erben vorgestellt. Es waren dies Christoph Hausladen, „Metzgerknecht (Geselle) derzeit (des) Landes abwesend“; Anton Hausladen Bürger und Riemermeister „allhier in Person zugegen“ - er war 1802 bedingt durch seine Heirat nach Eferding bei Linz in Österreich gezogen; Katharina Schreiner, Bürgerin und „Bankmetzgerin“ (Freibank) zu Neukirchen b. Hl. Blut - sie entsagte zugleich etwaigen Erbansprüchen. Als letzter in der Erbenreihe wird der Hausinhaber Wolfgang Hausladen, Bürger und Viehhändler, aufgeführt.
Als nächstes nennt das Protokoll das Vermögen der verstorbenen Witwe. Es belief sich nach Abfassung eines „Inventariums“ (Bestandsaufnahme der hinterlassenen Gegenstände) am Tage vorher lediglich auf 16 f (Gulden) 5 Kr. (Kreuzer), bestehend aus dem „Gewand“ der Witwe und noch weiteren Textilien. Mit dem Begriff „An Schulden herein“, sind Gelder gemeint, die die Witwe Hausladen einst an Mitbürger verliehen hatte. Diese konnten nun von den Erben als neue Gläubiger eingefordert werden. So schuldete der Müller Andreas Maurer von der „Jakobsmihl“ der Witwe 130 f; ebenso der jetzige Hausbesitzer Wolfgang Hausladen laut Übergabebrief vom 29. Juli 1796 von ursprünglich 100 f der verstorbenen Stiefmutter noch 30 f. An „Baarschaft“ wurden lediglich „in einem Kasten (Schrank) 4 Kr(euzer), dann in der Truche 30 Kr. also erfunden“. Das ergab ein Gesamtvermögen von 176 f 39 Kr.
Die Funeralkosten abgezogen
Davon abzuziehen waren Ausgaben, die sich auf die Beerdigung der Witwe Hausladen bezogen. So hatte die „Freundschaft“ (die nächsten Verwandten) bei dem „Miterb“ Wolfgang Hausladen „an Bier und Brod verzehret 5 f 47 Kr“. Auf diesen Betrag beliefen sich die Ausgaben für den sog. „Leichenschmaus“, in unserer Gegend auch „Gralles“ genannt, der für die nahestehenden Trauergäste selbstverständlich im eigenen Gasthaus abgehalten wurde. Für „1 ½ Pfund Körzen mußten ausgelegt werden 42 Kr.“ Die Kerzen brannten bei der Aufbahrung der Toten, damals noch im eigenen Haus. Für die letzte medizinische Betreuung erhielt der Bader (obiger Schöpperl) 32 Kr., die Anna Maria Kehlnerin, bekam „daß sie der Entseelten wehrend der Krankheit Dienste geleistet (hat) 1 f 30 Kr.“ Die „Funeralkosten“ (für die Beerdigung) verteilten sich auf den Pfarrer, Totengräber und Schreiner (für den Sarg) in Höhe von 39 f 49 Kr. 2 Pf. Nach Abzug noch weiterer Kosten verblieben „dennoch zum Vermögen (siehe oben - 176 f 39 Kr.) mithin zu verteilen übrig 101 f 15 Kr.“ Da die Tochter Katharina Schreiner schon vorher auf ihren Anspruch verzichtet hatte, wurde diese Summe an die Söhne Christoph, Anton und Wolfgang verteilt. Zum Schluss wurde festgestellt: „Mit dieser Vertheilung sind die Erben allerdings content (sich begnügend) und zufrieden, umso mehr als die Ausgabsposten alle hinaus bezahlt sind und einem jedem Erbsstam seine Portion verwiesen worden ist“. Als Zeugen fungierten Anton Pach (Markt)schreiber und der Bürger Wolfgang Lehrnbecher. Der Vorname >Anton< des protokollierenden Schreibers scheint nicht zu stimmen, denn im Jahre 1806 war Franz de Paula Pach Marktschreiber. Dessen Vater aber hatte den Vornamen „Andrä“.
Werner Perlinger
Schuster Hastreiter musste Klage einreichen um heiraten zu dürfen
+Eschlkam. Wir schreiben das Jahr 1851. Da erscheint am 8. Juli beim Magistrat Eschlkam der Schuhmachergeselle Franz Xaver Hastreiter mit folgendem Anbringen: „Meine Mutter hat heute beim Magistrat dahier auf seine Schuhmacherconcession, welche sie seit dem Tode meines Vaters, also seit 14 Jahren, durch geprüfte Werkführer ausübte und bisher für das fragliche Gewerbe auch die Gewerbesteuer zahlte, unter der Bedingung verzichtet, daß mir dasselbe vom Magistrate verliehen werde“. Zugleich legte Hastreiter damals die für sein Verlangen nötigen Unterlagen vor wie eine Tauf- und eine Impfbescheinigung (gegen Pocken), den Schulentlaßschein, seinen Lehrbrief, ein sog. Wanderbuch, den Militärabschied und letztlich Zeugnisse über seine Meisterprüfung. Der Vater des Gesuchstellers, der Schuster Michael Hastreiter, war selbst kein Hausbesitzer sondern ein sog. „Inwohner“ (in Miete), und lebte und übte sein Handwerk in Anwesen Nr. 50, nun Blumengasse 20, bis zu seinem frühen Tode im Jahr 1837 aus. Er starb mit 48 Jahren am 24. September an Wassersucht, einer damals sehr häufigen Krankheit. Der Sohn Franz Xaver arbeitete im Laufe seiner damals nötig abzuleistenden Wanderlehrjahre z.B. bei dem Schuhmacher Anton Koller in der Stadt Furth im Jahr 1843, auch bei einem Meister in Cham.
Am 7. August befürworteten die Gemeindebevollmächtigten das „Ansässigmachungsgesuch“ und die Bitte um Erhalt der „Concession“ (Zulassung) als selbstständiger Schuhmacher uneingeschränkt. „Die Unterzeichneten (acht an der Zahl) erklären, daß sie den Nahrungsstand des F.X. Hastreiter, wenn derselbe sich als Schuhmacher in loco Eschlkam ansässig macht, in nachhaltiger Weise für gesichert erachten“. Ebenso uneingeschränkt stimmte der Armenpflegschaftsrat dem Anliegen des jungen Schuhmachermeisters zu. Die sog. Erteilung der Concession erfolgte von Seiten des Magistrats bereits einen Tag später, am 8. August 1851. Eine Urkunde dazu wurde dem Hastreiter eigens ausgehändigt.
Der Wunsch eine Familie zu gründen
Zugleich hatte der junge Meister vor im Jahr darauf zu heiraten. Am 10. Mai 1852 ersuchte Hastreiter den Magistrat um die dafür nötige Heiratserlaubnis. Seine auserwählte „Hochzeiterin“ war Crescentia Stöberl, Schneiders- und Inwohnerstochter von Großaign. Sie verfügte über ein „Vermögen“ (hier die Ersparnisse) in Höhe von 150 Gulden und zugleich auch, und das war damals besonders wichtig, über einen „sehr guten Leumund“. Hastreiter nannte 450 Gulden sein Eigen, so dass die finanzielle Grundlage für eine Heirat 600 Gulden betrug. Außerdem erwähnte er, „daß sein Schuhmachergewerbe in besten Betriebe stehe“, die Geschäfte gingen also gut, der Start für eine gemeinsame Zukunft erschien zunächst ungehindert.
Einspruch der Gemeindebevollmächtigten
Seine Bitte erfüllte der Magistrat jedoch nicht mit dem Hinweis, er habe bereits eine Geliebte mit einem Kind. „welche eine Häuslerstochter von Eschlkam ist, und deren Kind er alimentieren (versorgen) muß und zwar namentlich eine große Alimentationssumme von jährlich 18 f bezahlen muß. So wäre es dem Hastreiter nicht möglich, eine Familie durch sein Gewerbe allein zu ernähren“. Betont wurde auch, dass seine Braut, die Inwohnerstochter Stöberl höchstens über ein Vermögen von 50 f verfüge. Auch habe er seine alte Mutter zu verpflegen. Daher verweigerten die neun Gemeindebevollmächtigten, darunter auch der Bürgermeister Moreth, allein aus diesen ökonomischen Überlegungen heraus ihre Zusage. Ebenso verfuhr der Lokalarmenpflegschaftsrat. Seinen abschlägigen Beschluss begründete der Magistrat u.a. mit dem Hinweis, dass mit der Absicht, die Stöberl zu heiraten, er „keinen ordentlichen Nahrungsstand für die Zukunft zu gründen im Stande wäre“. Darüber hinaus seien die 18 f, die er für sein mit der Helene Hornik von Eschlkam vor zwei Jahren erzeugten Kinde zu zahlen habe, „für einen Schuhmacher gewiß eine große Ausgabe“, da er keine andere Erwerbsquelle habe. Letztlich wurde noch erwähnt, „Hastreiter könnte sich also, da er noch seine alte Mutter zu alimentieren habe, bei solch großen Lasten nicht mit Ehren in der Gemeinde fort bringen“.
Erfolgreich Berufung eingelegt
In diesem Beschlusse, wie im 19. Jahrhundert in zahlreichen anderen ähnlich formulierten auch, die damals übliche Sorge der Gemeinden zu erkennen, bei stets gegebener schwacher Haushaltslage sog. Ortsarme auf Dauer unterstützen zu müssen. Der Magistrat unterrichtete und eröffnete dem Hastreiter zugleich, dass er gegen diesen Beschluss in Berufung gehen könne und dies tat er auch. Sein Anliegen begründete er mit den Hinweisen, der Magistrat habe seine Ansässigkeitsmachung, auch die Ausübung seines Gewerbes uneingeschränkt befürwortet und erlaubt. Er bringt auch vor, seine Braut habe wirklich ein Vermögen von 150 Gulden, außerdem müsse er für die „Kindsalimentation“ nicht 18 f sondern nur 12 f entrichten. Hastreiter betont, dass der geforderte „Nahrungsstand durch den Besitz meines Schuhmachergewerbes gesichert ist, dasselbe ist in besten Betriebe, da ich mir stets einen Gesellen und einen Lehrling halten kann, und weiter bin ich auch noch im Besitze einer Wiese, so daß ich mir eine Kuh halten kann und sohin die zum Hauswesen nöthige Milch und Schmalz nicht zu kaufen brauche“.
Offenbar überzeugten die von Hastreiter in einem Schriftsatz vorgebrachten Argumente die Beamten der Regierung in Landshut, so dass sie am 17. Juni 1852 „in Namen seiner Majestät“ gemäß rechtlicher Vorgaben kurz und bündig entschieden, dass „dem bereits als Schuhmacher ansässigen Xaver Hastreiter die Bewilligung zur Verehelichung nicht versagt werden kann, indem keine der dort angeführten Hindernisse entgegenstehe, ihm daher die nachgesuchte Eheschließungsbewilligung zu ertheilen sei“. Hastreiter wohnte und arbeitete offenbar weiterhin in Anwesen Nr. 50/ Blumengasse 20 nachdem er in den zeitlich folgenden Hausbesitzerlisten nicht erscheint. Das Haus hatte bereits 1838 Joseph Rötzer, Bäckersohn von dem Schuster Joseph Hastreiter, wohl einem Onkel käuflich erworben. Allein die Wohn- und Arbeitsverhältnisse dürften sehr beengt gewesen sein.
Werner Perlinger
Fast hätte der Marktdiener Reiser seinen Posten verloren
+Eschlkam. Im Archiv des Marktes, wohlgeordnet sich dem forschenden Besucher anbietend, finden sich unter den älteren Vorgängen neben den Kammerrechnungen auch Rats- und Verhörsprotokolle. Ein reichhaltiger Fundus, der uns teils sehr anschaulich das Leben der Bürger im Markt vor über 200 bis 300 Jahren und darüber hinaus vor Augen führt.
Die sog. „Niedere Gerichtsbarkeit“, ausgeübt von Richter und Rat seit der Marktwerdung im frühen 13. Jahrhundert, umfasste im Gegensatz zur Hohen- oder Blutgerichtsbarkeit nur Vergehen wie Beleidigungen, Raufereien ohne schlimmen Ausgang, kleine Eigentumsdelikte, Schuldenfragen, auch sog. „Leichtfertigkeiten“ (wegen ledig oder nach der Eheschließung zu früh geborener Kinder). Vor allem Raufereien und Schmähungen (Verbalinjurien, Beleidigungen) sind in den Protokollen sehr zahlreich niedergeschrieben, wobei in den meisten Fällen der Alkohol eine wesentliche Rolle gespielt hatte. Nicht enthalten sind die Auseinandersetzungen bei denen Messer oder sonstige „Waffen“ eingesetzt waren. Denn schwere Verletzungen mit Todesfolge, Totschlag oder gar Mord wurden allein vom Landgericht in Kötzting abgehandelt. Daher finden solche Taten in den Ratsprotokollen keinerlei Erwähnung, obwohl auch sie vorgekommen sind.
Wir wollen einen Blick in das „Rath: und Verhörsprotokoll des Markts“ aus dem Jahr 1775 werfen. Da galt es am 5. Juli die „durch den Johann Reiser Marktdiener alhier beschehene Dienstaufkündtung magistratsseits“ zu behandeln. Das Entscheidungsgremium bildeten Franz Antoni Schmirl, Andre Prickl, Johann Georg Hastreiter, Andre Meidinger (alle Mitglieder) „des Innern Rats“, sowie Mathias Bartl und Christoph Neumayr, Mitglieder „des Äußeren Rats“. Schmirl bringt als amtierender Bürgermeister vor, dass der Marktdiener Johann Reiser „gestern früh zu ihm gekommen sei und seinen Marktdieners Dienst aufgekindet habe mit dem Beysatz, daß man magistratsseits bis negst Jacobi um einen anderen Markt Diener (sich) umsehen könne“.
Reiser war offenbar mit seiner Arbeit, zu der auch die Erfüllung ortspolizeilicher Aufgaben gehörte, gänzlich unzufrieden geworden. Wie es aber soweit hatte kommen können, erklärt die Stellungnahme von Andre Prickl. Er bringt vor, der Ratsdiener Reiser sei gestern um die Mittagszeit bei dem Schuhmacher Hans Georg Bartl gewesen. Dort habe er „in Gegenwart mehrerer disortiger Bürger die Aufkündtung seines Marktdiener Dienstes (nicht nur) öfters repetiert (wiederholt), sondern Salvo reffactn (mit Verlaub) widerholtermaßen in seinen Dienst coherirt (mit seinem Dienst in Zusammenhang gebracht) und er bleibe nit mehr, anbey erzeigend die größten Grobheitten“. Prickl unterschrieb seine Aussage.
Der Magistrat fasste in seinem „Rhats Conclusum“ einen Beschluss: Da Reiser selbst seinen Dienst gekündigt habe und er als Termin dafür „bis auf negst Jacobi (25. Juli) gesetzet hat; also wird diese „seine Markt Dieners Dienst aufkündtung magistratsseits“ akzeptiert und genehmigt. Er habe deshalb bis „Heyl. Jacobi“ die Maktdienerswohnung und auch den Markt cum suis (mit seiner Familie) zu räumen (verlassen).“ Mit dieser doch schnellen und für ihn schwerwiegenden Entscheidung hatte Reiser offenbar nicht gerechnet – wahrscheinlich hoffte er, der Marktrat möge ihn weiter anhören und ihm bei seinen vorerst nicht genannten Problemen helfen – und er gab unmittelbar eine schlüssige Erklärung für sein doch unüberlegtes Verhalten ab, vor allem was seine Zukunft betreffe.
„Gehorsame Bitte“ des Markdieners
Demnach erklärte der Marktdiener Reiser nun „ganz gehorsam, daß weil ihm dies alles mehreren Theils in Bedrunkenheit herausgerumppelt und dies ihm von Herzen leid ist.“ Zugleich versprach er „künftighin sich des Trunckhs zu enthalten und seine Obliegenheiten (Aufgaben) fleissiger zu verrichten. Auch wolle er in Ansehung seines Weibs und seiner fünf Kindlein unterthenig gebeten haben“ ihn im Dienste zu behalten.
Die Stockstrafe verhängt
„In Ansehung des gehorsamen Abbitten und versprochener Besserung, dann (und da er) habent Weib und 5 Kinder“ entschloss sich das urteilende Gremium des Marktrats den Reiser „zu behalten, anbey aber (wurden) nit nur seine excessiv erzeigten Grobheiten alle negst verwiesen, (und er wurde) einer mehrerer Venerations erzeugung (Ehrerbietung) gegenüber den Ratsmitgliedern als (auch der) übrigen Bürgerschaft allen Ernstes eingebunden, für dermal aber und zwar zur letzten Gewahrung öffentlich vor dem Rathaus 3 Stunden mit Händen (und) Füßen im Stock condemniert (verurteilt zu) haben“. Somit wurde Reiser zur Strafe „in den Stock gespannt“. Der Stock war entweder im Rathause selbst oder öffentlich davor auf Marktgrund aufgestellt. Jeder, der vorbeikam, konnte so den mit Füßen und Händen jeweils zwischen zwei Balkenriegeln eingespannten Delinquenten hänseln und verspotten. Gerade diese Strafe war für den Marktdiener Reiser persönlich sehr hart, denn diese zur Schaustellung kostete ihm bei den Marktbürgern sicher viel an Autorität. Schließlich gehörte es u.a. zu seinen dienstlichen Aufgaben gerade die strafbaren Handlungen wie Trunkenheit, Schmähungen und Raufereien vor das Marktgericht zu bringen, für die die „Stockstrafe“ zur Ahndung vorgesehen war. Trotzdem versah Reiser vielleicht noch an die 20 Jahre seinen Dienst, denn er verstarb am 29. August 1796. Seine Tochter Anna Maria heiratete im Jahr 1800 den an seiner Stelle neu „aufgenommenen Marktdiener“ Franz Pinzinger, der aus Altrandsberg stammte.
Werner Perlinger
Gemeinde musste für ihre Mitbürger auch dann aufkommen, wenn sie auswärts verstarben
+Eschlkam. Wer glaubt, dass in frühen Zeiten der soziale Bereich im Gemeindeleben eine eher untergeordnete Rolle im Rahmen der täglichen Verwaltungsarbeit gespielt hätte irrt, denn am Beispiel von Eschlkam zeigt sich bei Durchforstung des bis in unsere Zeit überlieferten Aktenfundus, dass sich gerade mit sozialen Fragen und Problemen der Marktbürger die Gemeindeverantwortlichen immer wieder beschäftigen mussten. Ein Beispiel unter mehreren sei dafür angeführt:
So hatte sich die Marktführung in den Jahren 1846/47 mit den Folgen des erkrankten und dann verstorbenen Hutmachergesellen Joseph Lippl auseinander zusetzen. Am 3. Oktober 1846 informiert das Landgericht Kötzting als höhere Verwaltungsbehörde den Magistrat Eschlkam, dass nach Zuschrift des Landgerichts Vilshofen der plötzlich erkrankte Hutmachergeselle Joseph Lippl in das dortige Krankenhaus aufgenommen worden sei. Die Art der Krankheit ist nicht überliefert.
Vorweg sei zur Herkunft Lippls ausgeführt, dass eine Familie Lippl, in der längere Zeit das Hutmacherhandwerk ausgeübt wurde, im 18./19. Jahrhundert in Eschlkam nachgewiesen werden kann. 1783, am 25. Januar, übergibt Anna Wirnhier, Witwe und Hutmacherin, ihre am 8. Januar 1779 durch Verteilung erworbene Behausung an die Tochter Anna Maria und den zukünftigen Ehemann Georg Lippl, Hutmacher, geboren in Viechtach. Der Familienname >Lippl< stellt eine Kurzform des Vornamens >Philipp< dar. Das Hutmacheranwesen trug früher die Hausnummer 55, heute Blumengasse 10 – der alte Hausname lautet folglich „beim Huaterer“.
Das „Heimatrecht“ bleibt erhalten
Jahrzehnte später, 1802, stirbt Georg Lippl und die Witwe verlobt sich noch im gleichen Jahr mit dem Hutmacher Jakob Fischer von Oberrappendorf. So kam das Anwesen in andere Hände und Joseph Lippl, bereits wohl der Enkel, der das Handwerk seines Großvaters erlernt hatte, befand sich vielleicht als Geselle auf Wanderschaft, als ihn eine schwere Krankheit heimsuchte, die zu seinem Tode führte. Am 2. Dezember informiert das Landgericht Kötzting, Lippl sei am 20. November „mit Hinterlassung einer auf 40 Kreuzer gewertheten Mobilienschaft gestorben“. Die Verpflegungskosten wie auch die für die Beerdigung würden 59 f (Gulden) 26 Kreuzer (Kr.) betragen. Da nun Lippl „notarisch keine vermöglichen alimentatsionspflichtigen (die für ihn einzustehenden) Verwandten hat, so ergeht an die Armenpflege Eschlkam hiermit die Aufforderung die obige Summe binnen 8 Tagen“ zu begleichen. Auch wird gefragt, „ob der fragliche Nachlaß versteigert oder in natura ausgehändigt werden soll.“ Das Schreiben unterzeichnete der damalige Landrichter Paur. Diese Behörde wandte sich deshalb an den Markt, da Lippl, trotzdem er vielleicht lange schon seiner Heimat Eschlkam den Rücken gekehrt hatte, bis zu seinem Tode das sog. „Heimatrecht“ nicht verloren hatte.
Am 26. Dezember antwortete Eschlkam mit dem Hinweis, dass „alimentationspflichtige Verwandte des Defuncten (Verstorbenen) zur Tilgung dieser Kosten“ nicht vorhanden seien und auch die Armenpflege diesen Betrag keinesfalls begleichen könne. Daher wurde gebeten, das Landgericht Vilshofen „wolle in Berücksichtigung der Vermögenslosigkeit der hiesigen ohnehin sehr in Anspruch genommenen Armenpflege „von den geforderten 59 f 26 Kr. den Betrag von 29 f 26 Kr. nachlassen. Man sei bereit 30 f sofort bar zu übersenden. Auch verzichte man auf den Nachlass des „Defuncten“.
Die ganze Angelegenheit zog sich ein halbes Jahr lang hin. Im Juni 1847 wandte sich das Landgericht Kötzting an den Magistrat mit dem Hinweis, „da gar keine Aussicht vorhanden ist, daß die Krankenhausverwaltung Vilshofen auf den magistratischen Nachlaßantrag eingehen werde, somit ergeht der erneuerte Auftrag der landgerichtl. Verfügung entsprechend die in Frage stehenden 59 f 26 Kr. unter Rückäußerung was mit dem Lipplschen Nachlaß geschehen soll, nunmehr binnen 8 Tagen anher einzusenden“. Zwischen den Behörden wurde die Angelegenheit noch mehrmals hin und her behandelt. Letztlich zahlte der Magistrat Eschlkam zunächst 30 Gulden an Vilshofen.
Vorher noch hatte das Landgericht Vilshofen die Versteigerung „der geringfügigen Effekten des Joseph Lippl“ durchzuführen, jedoch ohne Erfolg, es fand sich kein daran interessierter Bieter.
Die dortige Krankenhausverwaltung ließ nicht locker, und so wandte sich Kötzting erneut an den Magistrat, „die noch restigen 28 f 46 Kr. in Zeit (von) 4 Wochen zu bezahlen“. Davon wurden 20 f bezahlt. Die Angelegenheit nahm schließlich am 27. Dezember 1847 ein Ende. Das Landgericht Kötzting schrieb an diesem Tag an den Magistrat, „derselbe wird auf Requisition des Landgerichts Vilshofen somit aufgefordert die rückständigen Verpflegungs- und Beerdigungskosten zu 8 f 46 Kr. für den Hutmachergesellen Joseph Lippl in Zeit (von) 8 Tagen bei Vermeidung von Zwangsmaßnahmen anher zu bezahlen“. Allein wegen des rechtlich existenten Heimatrechts zahlte der Markt auch diese Summe am 17. Januar 1848, und die Angelegenheit fand ein Ende.
Bei Betrachtung des Ganzen erschließt sich die Erkenntnis wie klamm damals die kommunalen Kassen waren, da selbst wegen verhältnismäßig kleiner Beträge ein fast nicht endender Schriftverkehr zwischen den Behörden nötig war, um endlich eine Angelegenheit so abzuwickeln, dass die fordernde Seite zufrieden sein konnte. Ein Ende solcher Auseinandersetzungen war erst gegeben als am 15. Juni 1883 unter Reichskanzler Otto von Bismarck die „Gesetzliche Krankenversicherung“ für Industriearbeiter und Beschäftigte in den Handwerks- und Gewerbebetrieben eingeführt wurde.
Werner Perlinger
Bei „Vergantungen“ wurden die Häuser vom Marktrat veräußert
+Eschlkam. In frühen Zeiten geschah es häufig, dass die Besitzer von Anwesen in wirtschaftliche Not gerieten, sich daraus nicht mehr befreien konnten und somit der Besitz zur Befriedigung der Gläubiger letzten Endes veräußert werden musste. Für einen solchen Fall kennt man noch heute den Ausspruch: „der ist auf die Gant gekommen“. Der folgende Rechtsakt dafür wurde nicht Privatpersonen überlassen, allein der Marktrat, bestehend aus dem amtierenden Bürgermeister und den Markträten, konnte gestützt auf rechtlicher Grundlage, die Veräußerung oder öffentliche Versteigerung durchführen.
Diese Verfahren wurden ebenso wie herkömmliche dingliche Geschäfte in einem Briefprotokoll niedergeschrieben und so als Beweisdokumente für später auftretende „Erinnerungen“ (hier: z. B. bei Einwänden oder Widerspruch) für lange Zeit festgehalten. Als ein Beispiel von vielen sei aus den Protokollen ein Fall herausgegriffen und dem Leser präsentiert:
Wir befinden uns im Jahr 1725. Eine Niederschrift vom 19. November trägt den für Laien nicht leicht verständlichen Titel: „Obrigkeitliche Kaufseinräumung pro 440 f (Gulden) Hauptsache und 2 f Leykauf “ (Der „Leykauf“ ist der Betrag, der vom Käufer zur Festigung und Bestätigung des Rechtsakts noch eigens gegeben wird). Übertragen in die heutige Sprache ist damit die von Amtswegen geschaffene Möglichkeit gemeint eine Immobilie zu kaufen. Gleich anfangs wird klar betont, dass „Burgermaister und Räte alhier für sich selbsten und auf ainfölliges einstimbten (einstimmig) des zu gegen seyenden sambentlichen Johann Hastreiter seel: des Jungen Bürger und Schuhmachers alhier privilegierten Creditoren (Gläubiger) wie selbe in dem: und heutig dato verfaßten Ganturtl specifice (Urteil für Veräußerung) und mit Namen vorgetragen, bekennen und übergeben von Gantrechtswegen, das demselben in solutum (einzig allein) haimbgefallene Hastreithersche Vermögen, nemblichen Haus, Hofrat (sämtliche Gerätschaften) Stadl, Stallung und beim Haus vorhandenen Wurz- und Grasgarten an Wolfgang Späth, Bürgerssohn und Maria Barbara dessen „Hauswürthin“ um den Preis von 440 Gulden (f) „Hauptsach und 2 f paar bezahlten Leykauf“.
Als Zahlung leistete Späth laut Protokoll im Rathaus bar 217 f 49 Kreuzer sofort „zur Abledigung (Befriediung) der (gleichzeitig) vorhandenen Creditorn (Gläubiger des Hastreiter). An das „Gottshaus“ (Kirche) gab er 22 Gulden 11 Kr. als „ausstendiges Interesse“ (ausstehende und bisher angelaufene Zinsen). Die übrigen 200 Gulden als Teil der Finanzierung der Übernahme lieh sich Späth vom „Lobwürdtigen Gottshaus“ mit dem Versprechen von „landtsgebreichiger Gewehrschaftslaistung“ (diese so abzusichern wie es Brauch im Lande ist). Bei dem hier erörterten Hausverkauf handelt es sich um das Anwesen Nr. 35, jetzt Marktstraße 7. Seit einigen Jahren beherbergt das Anwesen ein Ärztehaus.
Eine „Schuldverschreibung“
In Folge sei auch eine sog. „Schuldverschreibung“ aus dem Jahr 1726 erörtert. Nicht allein die weniger bemittelten Marktbürger liehen sich zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse Geld, sondern auch Bürger, die damals vor 300 Jahren eine ökonomisch gehobene Stellung im Markte einnahmen. Franz Schmirl, Mitglied des Rates und „Gastgeber“, war seit 1715 Eigentümer des Anwesens Nr. 1 - Waldschmidtstraße 14, heute der Gasthof Penzkofer. Im Ehematrikel vom Jahr 1715 wird sein Vorname ausführlich mit „Franz de Paula“ angeführt. Dieser Vorname erinnert an den Franziskanermönch Franz von Paola, der um die Mitte des 15. Jahrhunderts den Franziskanerorden der „Mindersten Brüder“ gründete, bezeichnet als die „Paulaner“. Gerade im 18. Jahrhundert war dieser Vorname bei der höheren Gesellschaft beliebt, wie Beispiele zeigen. Als eines dafür sei der ehemalige Further Stadtpfarrer Franz de Paula Maximilian Joseph Freiherr von Edlmayr erwähnt, der von 1734-1785 sehr zum Wohle der Further Bürger als Priester wirkte.
Familie Altmann aus Neukirchen b. Hl. Blut
1715, am 7. Juli übernahm Franziskus de Paula Schmirl, Wirtssohn und Metzger aus Stachesried durch Heirat der Tochter Anna Regina von Wolf Sighardt Altmann und Rosina den oben genannten Gasthof mit der dazu gehörenden Ökonomie im Schätzwert von 5.375 Gulden. Nur einige Tage vorher, Anfang Juli hatte Schmirl Regina Altmann geehelicht. Der Eheeintrag im Matrikelbuch erwähnt als Heiratszeugen Johann und Wolfgang Altmann, beide Bürgermeister aus Neukirchen b. Hl. Blut. Das lässt den Schluss zu, dass der Großvater des Schwiegervaters von Schmirl wohl aus dem benachbarten Wallfahrtsort Neukirchen stammte und nach Eschlkam geheiratet oder vielleicht auch das stattliche Anwesen gekauft hatte. Es war dies ein Johann Altmann, der im Jahr 1630 bereits als Inhaber und Bürgermeister von Eschlkam genannt wird.
Elf Jahre später, am 11. Januar 1726 bekennen die Eheleute 70 Gulden bares Geld schuldig zu sein, „welche er Herr Schmirl und seine Eheconsortin von der Johann Lährnbecherischen Wittib, Millerin (Müllerswitwe), zu ihrer unentpöhrlichen Hausnotdurft übernommen, hierumben (und deshalb) verschrieben sie zu einem Pfandt in genere (im Allgemeinen) ihr gesamtes Vermögen, in specie aber das Äckerl beim Schusterbergl - zinszeitlich zu hl. Weihnachten und anno 1724 ebnermaßen den Anfang genomben“, d.h. die 70 f wurden an Weihnachten 1724 geliehen, wonach ab diesem Zeitpunkt die Verzinsung einsetzte. Durch diese nun erfolgte Niederschrift wurde die noch bestehende Schuld nicht nur bestätigt sondern auch abgesichert.
Werner Perlinger
Wenzl Schneiders vergeblicher Versuch sich als Drechslermeister niederzulassen
+Eschlkam. „Gesuch des Drechslergesellen Wenzl Schneider von Eschlkam um Verleihung einer Drechsler-Concession“, so lautet der Titel eines Aktes aus dem Jahre 1854, niedergelegt im Marktarchiv. Laut dessen Inhalt erschien am 12. Juni dieses Jahres der Drechslergeselle Schneider im Rathaus vor Bürgermeister Moreth und dem damaligen Marktschreiber Beutlhauser und brachte vor, es sei dem Magistrate bekannt, dass ich das Drechslerhandwerk erlernte, mehrere Jahre als Geselle gearbeitet und schließlich vor der Prüfungskommission für Gewerbe in Kötzting meine Prüfung abgelegt habe. Als Beweis für sein Vorbringen legte er seinen Lehrbrief, das Buch für abgeleistete Wanderjahre und letztlich sein Zeugnis als geprüfter Drechslermeister vor. Zugleich stellte er an den Magistrat die „gehorsame Bitte mir eine Drechsler-Concession verleihen zu wollen“.
Zu diesem Handwerkszweig selbst: Das Drechslerhandwerk war bereits in der Antike bekannt aber erst im Mittelalter und danach erlangte es bei uns eine größere Bedeutung. Überwiegend stellten die Drechsler Gebrauchsgüter her, beispielsweise Becher, Teller, Schüsseln, Büchsen, Kerzenleuchter, Spinnräder, Kugeln, Fasshähne, Pfeifen und Knöpfe, um nur einige Gegenstände aus dem vielfältigen Produktionsbereich aufzuzählen. Dieses Handwerk war, wie andere Handwerke, auch namengebend, wie z. B. bei Namen wie: Traxler, Drachsler oder Drexler.
Wenzl Schneider wurde als Sohn des Viehhändlers Andreas Schneider am 23. März 1827 in Anwesen Nr. 17/Kleinaignerstraße 4, geboren. Dieses Anwesen hatte aber bereits im Jahr 1846 sein Bruder Joseph übernommen. Also konnte er sich in seinem Elternhaus als Drechsler mit Werkstatt wahrscheinlich aus Platzmangel nicht niederlassen. Darum betonte er vor dem Magistrat, dass dieser wohl wisse, dass er mittlerweile elternlos sei und für ihn „keine andere (berufliche) Aussicht gegeben wäre, als mich stets in der weiten Welt als Handwerksbursch herumzuschlagen“. In der Hoffnung, dass sein Gesuch berücksichtigt werde, „und zwar umso mehr, als ich als Drechslermeister zu Eschlkam voraussichtlich mein ordentliches Fortkommen finden würde, weil sich dahier kein derlei Concessionierter (als Drechsler im Markt zugelassen) zur Zeit befindet“. Schneider führt weiter an, dass der „Nahrungsstand“ (hier das Einkommen) des Drechslermeisters in Furth durch ihn nicht gefährdet werde, er also zu ihm keine Konkurrenz wäre. Zudem betont er, dass „im benachbarten Neukirchen kein Drechsler vorhanden ist.“
Im öffentlichen Aushang
Daraufhin verfügte der Magistrat, dass das Gesuch Schneiders an der Anschlagstafel des Rathauses öffentlich bekannt zu machen sei, was auch geschah. Mittlerweile erfahren wir über Schneider mehr. Demnach hatte er seine Ausbildung vom 7. Dezember 1841bis 9. Juli 1844 bei Paul Auzinger (wohl in Kötzting) abgeleistet. Sechs Jahre und drei Monate stand er dann in Arbeit und legte die notwendige Fähigkeitsprobe vor der Prüfungskommission III. Klasse in Kötzting am 10. Juni 1854 ab. Technische Lehranstalten besuchte er nicht; dafür aber leistete er seinen zweijährigen Militärdienst bis 1850 ab.
Am 14. Juli 1854 entschieden die Gemeindebevollmächtigten (heute die Gemeinderäte), neun an der Zahl, dass dem Schneider „die nachgesuchte Drechslers-Concession nicht ertheilt werden solle, weil Schneider sein ordentliches Auskommen wegen Mangel an Absatzgelegenheiten als Drechsler zu Eschlkam keineswegs finden würde“. Ebenso ablehnend entschied der Rat der Lokalarmenpflege, wozu auch Pfarrer Karl Pittinger gehörte. Dem schloss sich noch am gleichen Tag der Magistrat des Marktes an, nämlich dass „Schneider mit diesem seinem Gesuche abzuweisen und in die Verhandlungskosten zu verurtheilen sei“. Begründet haben dies die Magistratsräte mit dem Hinweis, „dass zur Zeit kein Bedürfnis nach einem Drechsler besteht, denn die hiesigen Bewohner werden in ihren Bedürfnissen nach Drechslererzeugnissen – welche Bedürfnisse übrigens kaum nennenswerth sind – von den in den benachbarten Orten Furth und Kötzting concessionierten Drechslern hinlänglich befriedigt“. Freigestellt wurde dem Schneider gegen diesen Beschluss innerhalb von 14 Tagen Berufung an die königliche Regierung von Niederbayern, Kammer des Innern einzulegen. Eine Niederschrift dazu wurde am 18. Juli angefertigt. Darin bat er um Aufhebung des Magistratsbeschlusses, erinnerte an die im Bayerischen Wald „großartig betriebene Flachsspinnerei, so dass ein Drechsler durch Verfertigung von Spinnrädern und stete Absatzgelegenheiten allein schon seinen Nahrungsstand sich zu begründen gereicht“. Auch weist er darauf hin, dass die Bewohner des Hohenbogen-Winkels sich „ihre Spinngeräthschaften bisher aus Neumark in Böhmen geholt hätten, da dieser Ort näher liege als die Stadt Furth oder der Markt Kötzting. Er nennt noch die Palette an Geräten, die er neben den Spinnrädern sonst noch fertigen würde wie Krüge, Kegel, Pfeifenröhren, Pulverhörner; dann auch Löffel und Gabeln aus Holz, Bein und Horn; Würfel, Zahnstocher etc. und er begründet damit, dass er so sein Auskommen fände.
Eigens schriftlich bemerkte dazu Bürgermeister Moreth, dass er die Meinung Schneiders, allein schon mit dem Verkauf von Spinnrädern seinen Nahrungsstand sichern zu können, als ein „Phantasiegebilde“ betrachte. Auch brächte der Handel mit den übrigen von Schneider erwähnten Erzeugnissen „in dieser Gegend, wo kein Luxus herrscht, nicht den geringsten Gewinn…und es wäre ein wahres Unglück, wenn Schneider eine Concession hierher erhalten würde, da er vermögenslos bald der Gemeinde zur Last fallen würde“. Am 20. September 1854 lehnte auch die Regierung das Gesuch Schneiders ab. Er musste sich um eine andere Erwerbsgrundlage bemühen. Wäre Schneider Besitzer eines Hauses zusammen mit einer bescheidenen Landwirtschaft gewesen, so wäre die Entscheidung wohl zu seinen Gunsten ausgefallen, da in Notzeiten mit einer kleinen Ökonomie der amtlich geforderte „Nahrungsstand“, die Grundversorgung, gegeben gewesen wäre.
Werner Perlinger
Wenn Häuser vor über 200 Jahren ihre Besitzer wechselten
+Eschlkam. In Folge des Artikels "Aus dem Briefprotokoll von 1719-1726" seien nun einzelne Übergaben von bürgerlichen Anwesen, geschehen im 18. Jahrhundert, dem Leser vorgestellt. Dazu sei erklärt: ein wesentliches Element der zivilen Gerichtsbarkeit des Marktes Eschlkam war bis zum Jahr 1808 die Erledigung der anfallenden notariellen Aufgaben. Die Marktbehörde, hier der Marktschreiber als juristisch vorgebildete Persönlichkeit, protokollierte im Einvernehmen mit dem Amtsbürgermeister und den Ratsherren sämtliche Kaufverträge und Übergaben der Häuser und Grundstücke, Heiratsverträge und Testamente, Bürgschaften, Leihverträge. Auch die „Aufdingung“ (Aufnahme) von Lehrjungen im Handwerk wurde vom Marktschreiber abgefasst, niedergeschrieben und gesiegelt. Mit dem Siegel erlangten die Niederschriften ihre amtliche Gültigkeit.
Die darüber ausgefertigten originalen Urkunden erhielten die beiden an einem dinglichen oder sonstigen Rechtsgeschäft beteiligten Parteien. Jeder Vorgang wurde für eine spätere Überprüfung und zur amtlichen Erinnerung für die Marktbehörde selbst eigens in einem sog. Briefprotokoll niedergeschrieben. Von Eschlkam sind sie uns ab dem Jahr 1691 bis 1808 erhalten.
Im Jahre 1722, am 19. Januar veräußerte der Bürger Hans Stephl dem „ehrbaren Andreas Würnhir, Hutmacher derorten (und) Caecilia, seinem Eheweib seine bisher ruhig ingehabte genuzte“ und bereits am 12. Februar 1711 „übernommene Burgersbehausung“ um den Betrag von 160 Gulden. Das Haus war das Vorgängeranwesen von Blumengasse Nr. 10. Früher trug es die Hausnummer 55. Geregelt in diesem Vertrag wurde auch die uneingeschränkte und nun gemeinsame Nutzung wie auch Instandhaltung des Hausbrunnens durch den Käufer. Der Brunnen befand sich an einem Eck des verkauften Hauses.
Am 12. April des Jahres 1763 erscheint der Metzger Hans Dimpfl vor dem Marktrat. Er will sein Anwesen, das er im Jahr 1721 von der Witwe des Metzgers Simon Wilhelm käuflich erworben hatte an seinen Sohn Hans Georg Dimpfl übergeben. Wegen seines hohen Alters und „Leibs Zerbrechlichkeit“ ließ sich der alte Metzger von einem weiteren Sohn, Ignatii Dimpfl, „burgerlicher Metzger zu Közting als Bevollmächtigten“ vertreten. Ihn begleitete seine Frau Anna Maria. Beide bekennen, dass sie zu ihrem Nutzen, hauptsächlich aber ihres hohen Alters wegen „aufrecht und redlich als Kaufsübergab, Recht, Sitt und Gewohnheit ist, ihrem freundlichen geliebten eheleiblichen Sohn Hansen Georgen Dimpfl, noch ledigen doch bereits vogtbaren Standes, nemblichen ihre einige Zeit ingehabte, genuzte und genossene, auch am 4. März 1721 an sich gebrachte Burgers Behausung“ im geschätzten Wert von 510 Gulden übergeben. Dazu gehörte auch ein „am Gässlweg situierter Kraut Gartten“. Das übergebene Anwesen Dimpfls erhielt später die Hausnummer 34, heute Marktstraße 5, seit 2020 die Senioren-WG „Ludwig Weber Haus“.
Zugleich aber ließen die Übergeber sich „auf dem beyder Leben lang die ober Stuben, Cammer und Flez, dann den freyen Zutritt zum prunnen als eine freye Wohnung reservieren und vorbehalten“. Als sog. „Leibthumsgenießer“ (Austrägler) ließen sie vertraglich noch festschreiben, dass ihnen wöchentlich „4 Pfund Fleisch und 20 Kreuzer in Geld“ gegeben werde. Damit sicherten sich die Ruheständler den weiteren Lebensunterhalt. Sollte einer der beiden „mit Todt abgehen, so solle der überlebende Partner nur die Hälfte an Fleisch und Geld erhalten, „dahingegen aber iährlich 6 Clafter Holz ohnentgeltlich zur Stehl gefahren werden“..
Bedacht wurde auch die Tochter Theresia. Sollte sie ihren „Stand verändern (z. B. durch Heirat), so müßten derselben das Hochzeit Kleydt vor dem Altar, dann ein 4 Wasser Eimer haltender neuer kupferner Köstl (Kessel) nebst allen kupfernen Geschürr geschaffet und verabfolgest werden“. Der Übergabevertrag war somit abgeschlossen. Als Zeugen bestätigten diesen Rechtsvorgang der Weißbäcker Wolfgang Lährnpecher (Nr. 60/Marktstraße 15) und der Schuhmacher Antoni Hastreiter (Nr. 59/Marktstraße 13).
Geld aufgenommen
Um all diese vertraglich gegenüber seinen Eltern übernommene Verpflichtungen auch erfüllen zu können, bekennt noch zur gleichen Stunde der junge Metzger Hans Georg Dimpfl, dass „er aufrecht und rechtlich schuldig worden seye, auch getreulich wiederum Gelder bezahlen solle und wolle, dem lobwürdigen St. Jacobs Pfarrgotteshaus alhier zu Eschlcamb benanntliche 200 Gulden Capital welche er ab hodierno (von heute an) in käuflicher Übernehmung seiner nunmehr besitzenden burgerlichen Metzgersbehausung cum Pertinentiis (mit allem Zubehör) schuldig worden ist.“ Zugleich versprach der junge Dimpfl als „Debitor“ (Schuldner) an das „St. Jacobs Gottshaus oder den Zöchpröbsten (Mitglieder der Kirchenverwaltung) alljährlich an Georgi 10 Gulden an Zins zu zahlen, was 10 % entsprach. Zur Sicherheit für den Geldgeber „verschreibt er hans georg Dimpfl sein und heute käuflich an sich gebrachtes Vermögen in genere und specie so und dergestalten, daß sich das creditierende Gottshaus oder dessen Zöchpröbst…bis sowohl das Capital als Interesse in allem richtig seyn würdet“.
An dieser Stelle sei erörtert, dass der Geldverleih in sehr früher Zeit nur den im Lande ansässigen jüdischen Bank- und Geschäftsleuten vorbehalten war. Erst mit der Landesverordnung Herzog Albrecht V. von Bayern-München vom Jahre 1553 mussten sämtliche im Lande noch ansässigen Juden Bayern verlassen und die katholische Kirche übernahm nun ausschließlich den Geldverleih für die nächsten Jahrhunderte, wobei der nicht veränderbare Zins als Gebühr für das geliehene Geld stabil 5 % betrug. Erst mit Einführung der Sparkassen, vor allem auf dem Lande etwa ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, wurde es üblich nötiges Geld als Kredit nicht mehr von der Kirche sondern bei den Geldinstituten aufzunehmen, z. B. um Geschwister auszahlen oder wichtige Anschaffungen tätigen zu können.
Werner Perlinger
„Fürstenbilder“ als Preise für gute Schüler konnten nicht gekauft werden
+Eschlkam. Unter den Akten des Marktarchivs fand sich auch ein Schreiben der „Königlichen Lokalschulinspektion an die Lokalschul-Fondsverwaltung des Marktes aus dem Jahr 1852. Im 19. Jahrhundert und auch noch danach oblag in Bayern innerhalb einer Gemeinde die Inspektion, hier die Überprüfung der Schulen innerhalb eines vorgegebenen Pfarrsprengels dem jeweiligen Ortspfarrer. Jede Schule sollte von ihm innerhalb einer gewissen Zeitspanne wenigstens einmal revidiert (überprüft) werden; das hieß auch, dass der Pfarrer den Unterricht und auch das sonstige Verhalten des oder der Lehrer innerhalb der Pfarrei gegenüber den höheren Amtsstellen zu beurteilen hatte.
Und so war es im Jahr 1852 auch in Eschlkam, als Pfarrer Karl Pittinger - er stand der Pfarrei von 1843-1859 vor - am 25. November als Vorsitzender der Lokalschulinspektion um einen möglichen Ankauf von bayerischen Fürstenbildern, nämlich Portraits der herrschenden Regenten, für die Schule Eschlkam warb. Er versuchte die dafür zuständige Schulfondsverwaltung des Marktes zu gewinnen. Pittingers Schreiben hat in wichtigen Bereichen folgenden Wortlaut: „Veranlaßt durch eine lithographierte besondere Ausschreibung, welche von der kgl. Kreis-Regierung an alle Distriktsschulinspektionen u. durch diese an die Lokalschulinspektionen unlängst erlassen wurde im betreffe derjenigen Fürstenbilder, von denen im Kreis-Intelligenzbl. die Rede ist, wird unter Hinweisung auf Letzteres hiermit an die Verwaltung des Lokalschulfonds Eschlkam das Ansinnen gestellt, sich schriftlich darüber auszusprechen, auf welchen Kostenbeitrag sie sich in der nächsten Etats-Periode einlassen will, um bei jeder Prüfung der sechs Jahre von 1852/53-1857/58 eine Sammlung von 12 solchen Fürstenbildern im Sinne der höchsten und allerhöchsten Stellen als Preise unter den besten Werktagsschülern vertheilen zu können. Die hierauf ehebäldest erwartete Erwiderung der hiesigen Schulfondsverwaltung wird sodann nebst den Erklärungen der sämtlichen Lokalschulfonds-Verwaltungen und Lokalschul-Inspektionen durch die kgl. Distriktsschulinspektion an die hohe Kreis-Regierung übersendet werden“.
Kein Geld für die Bilder
Zwei Wochen später antwortete das Organ des Schulfonds, also die Verwaltung der für die Schule Eschlkam auszugebenden Gelder kurz und bündig. „In Erledigung der Zuschrift vom 25. d(es) M(onats) wird erwidert, daß die Schulfondverwaltung auf den Ankauf von Fürstenbildern für die hiesige Schule sich leider nicht einlassen könne, weil das Vermögen derselben laut Grundetats nicht ausreicht“.
Wie ernst Pfarrer Pittinger seine zu erledigenden Aufgaben als „Schulinspektor“ nahm, beweist sich wenige Jahre später, als er am 14. Februar 1856 einen sog. „Brandbrief“ an den Magistrat verfasste und darin monierte, „bereits bei der Schulvisiation im Mai 1855 wurde von Seite der Schulkommission der Auftrag gegeben, damals schon die augenfälligen Baugebrechen“ am bestehenden Schulhaus zu beheben. Zur Erklärung: Die damalige Schule war ab dem Jahr 1824 aus dem Anwesen des Metzgers Anton Riederer durch Ankauf der Gemeinde und entsprechenden Umbau entstanden. Es trug damals die Hausnummer 24. Die jetzige sog. „alte Schule wurde an gleicher Stelle erst 1896 erbaut. Demnach war der Schulbau bereits gute 30 Jahre alt.
In seinem Brief bemängelt Pfarrer Pittinger in sechs Punkten den Mörtelbewurf an der Westseite des Schulhauses, den Zustand der Dachrinnen, der Gartenmauer sowie eine Kellermauer nebst der Stiege. In schlechtem Zustand war auch die „Außenseite des Kuhstalles“, wo die jeweiligen Lehrer sich für ihre Grundversorgung wenigsten eine Kuh halten konnten. Letztlich forderte er, „die Planke“ des hinteren Hofraumes baldigst zu reparieren sowie die Einmauerung eines neu gesetzten Fensterstocks im Nebenzimmer des Lehrers. Seinen Appell untermauerte der Pfarrer noch mit dem Hinweis, „die Frühlingszeit nahe und daß die eben erwähnten Baugebrechen sobald als möglich solid (ab)gewendet werden“. Weiter betonte er, „eine längere Verzögerung könnte nicht mehr stillschweigend mit angesehen werden. In einem Nachtrag erwähnte Schulinspektor Pittinger, „vor der östlichen Hausthür des Schulhauses befindet sich häufig eine Pfütze welche beseitigt werden muß“, auch sei der „Bretterverschlag“ auf der nördlichen Seite des Stadels zu reparieren.
Die Beseitigung der angemahnten Schäden wurde wohl vorgenommen, denn Monate später, am 18. August wurde von dem engagierten Schulinspektor und Pfarrer Pittinger „unmaßgeblich (nebenbei) noch bemerkt, daß in dem revidierten Kosten-Anschlage die Reparatur der 2 alten s.v. (salva venia = mit Erlaubnis, benützt bei unsauberen Gegenständen) Abtritte und Herstellung eines neuen, dessen Nothwendigkeit schon früher anerkannt wurde, nur wohl aus Versehen außer Ansatz geblieben sind“. Außerdem forderte er im sog. großen Schulzimmer mehrere Schulbänke neu aufzustellen.
Allein aus diesen Inhalten erkennen wir, dass sich die damaligen Pfarrer nicht nur um die Eignung der Lehrkräfte am Ort zu kümmern hatten, sondern in erster Linie um all die Voraussetzungen, die es ermöglichen, über das Jahr einen geregelten ordentlichen Schulunterricht in einem auch baulich in gutem Zustande befindlichen Schulhause zu gewährleisten. Schließlich, so die Inhalte der Akte, kam der Magistrat als rechtlich zuständig für die Schule in Eschlkam, den Wünschen ihres Schulinspektors nach. Abschließend sei gewürdigt welch großen Arbeitsaufwand der ehemalige Domkapitular Joseph Wurm (+ 1866 - siehe Artikel "Ein Bauernbub aus Großaign wurde Domkapitular im Erzbistum München-Freising") als Distriktsschulinspektor zu leisten hatte, wenn er neben seiner priesterlichen Tätigkeit die Schulen und deren Lehrer nicht nur in einer Pfarrei, sondern in einem Distrikt (Landkreis) zu prüfen und zu beurteilen hatte.
Werner Perlinger
Lehrer Franz Xaver Dobler
+Eschlkam. Am 23. Dezember 1802 wurde durch Verordnung des Kurfürsten Max IV. in Bayern die >Allgemeine Schulpflicht< und ein Jahr später ein allgemein verbindliches Lehrerbildungsgesetz eingeführt. Mit der ab diesem Zeitpunkt einsetzenden Lehrerausbildung kamen neue Ideen und konkrete Lehrmethoden in die Schule. Erstmals konnten die Kinder die doch so notwendigen Schulbücher benützen. Im Laufe der nächsten Jahre kamen die Markträte zur Erkenntnis, es müsse nun endgültig auch ein geeignetes Schulhaus gebaut werden. Dafür wählte man einen im Markt von den Straßenführungen her zentral liegenden Platz. Es war dies der, wo damals das „Metzger-Flore-Haus“ Nr. 24 stand. 1824 erwarb nun der „Schulsprengel Eschlkam“ das für die Schulkinder günstig gelegene Anwesen für ein künftiges Schulhaus von dem Metzger Riederer. Dieser kaufte sich aus dem Verkaufserlös das Anwesen Nr. 61, heute Großaigner Straße 1. Die lange schon gewünschte Schule mit Lehrerwohnung konnte endgültig gebaut werden. Sie ist der Vorgänger des an gleicher Stelle gebauten und heute noch stehenden sog. „alten Schulhauses“, der aber erst 1896 an gleicher Stelle entstand.
Gerade in diesem Jahr 1824 wurde in Eschlkam der bisherige Lehrer Bär nach Zwiesel versetzt. Sein Nachfolger wurde ab dem Monat Juli der Lehrer Franz Xaver Dobler. Es scheint für Dobler zunächst alles auch zu seiner wirtschaftlichen Zufriedenheit abgelaufen sein. Aber im Jahr 1837 war er mit der Höhe seiner laufenden Einkünfte nicht mehr zufrieden, denn am 5. Februar stellte er an den Magistrat ein Gesuch um eine zusätzliche Zahlung von 11 Gulden (abgekürzt: f), die er seit 1824 bekommen hatte. Die Summe erscheint auf das Jahr bezogen gering. Aber man muss wissen, dass in diesen frühen Zeiten der Verdienst eines Lehrers gewiss nicht üppig war.
Dobler schreibt, „der Magistrat hat mir gehorsamst Unterzeichneten den im verwichenen Etatsjahr 1835/36 fälligen Stiftsbetrag von 11 Gulden eigenmächtig entzogen, der aus einem der Gemeindegrundantheile erzielt wird“. Dobler weist darauf hin, dass „der ehemalige Ortspfarrer und Lokal-Schulinspektor Huber im Jahre 1803 zu einer besseren Stellung des zeitlichen Schullehrers zu Eschlkam (diese Summe) cedierte (an einen Dritten abtrat)“, was auch 1810 „gefälligst bestätigt worden ist“. Der Magistrat meinte dazu: „aus dem Briefprotokoll vom Jahre 1804 geht hervor, dass der jährliche Pachtvertrag von zwei vom ehemaligen Pfarrer Huber auf Erbpacht verliehenen Grundstücken im Gesamtbetrage von 16 f ursprünglich dem Schulfond von Eschlkam zugewendet wurde. Er ist nicht als ein Teil des Schullehrer Einkommens bezeichnet. Gemäß der Schuldienstgehalts-Fassion sei der erwähnte Geldbetrag bisher auch kein Theil des Erträgnisses, auf welchen Schullehrer Dobler nach seinem Anstellungsdekrete (Anstellungsvertrag) vom 17. Juli 1824 Anspruch machen kann“, so die Vorstellung des Magistrats.
Dazu ein Auszug aus dem Briefprotokoll des „Grenzbannmarktes“ Eschlkam vom 17. April 1804: „Zu vernehmen sei, dass seine Hochwürden, Titl. Herr Pfarrer Philipp Jakob Huber, dem bei der Gemeindeweidenschaftsverlosung der Antheil Nr. 36 im Einberg zugegangen ist, so haben hoch derselbe den Entschluß gefaßt, den hiervon hergehenden jeweiligen Stiftbetrag (Geld aus der Verpachtung) für immer dem dießortigen Schulfonde zu widmen“. Daraufhin hat Pfarrer Huber mit Kaspar Schifferl, „churfürstlicher Kloster Seligenthalischer Hofmarksverwalter zu Schwarzenberg und Bürger allhier“ (damals in Haus Nr. 63/Großaigner Straße 9) zusätzlich die Übereinkunft getroffen, den Pachterlös aus den Anteilen des Florian Schmid, damals als Metzger noch in Nr. 24 (Waldschmidtstraße 1) und Andre Vogl, (Nr. 9/Kleinaigner Straße 7) dem Schulfonde zukommen zu lassen.“
Lehrer Dobler gab sich damit nicht zufrieden und so entschied in dieser Angelegenheit in Folge sogar die höchste Instanz, die damalige Regierung des Unterdonaukreises in Passau, wozu damals unsere Region politisch gehörte, am 24. November 1838, dass „nachdem endlich Schullehrer Dobler von der treffenden Lokalschulinsprektion, nun resp. Verwaltungsbehörde, auf die fragliche Pacht nicht ferner praetendieren (Anspruch erheben) zu wollen, ausdrücklich erklärt, und die Niedercuratel-Behörde diese Erklärung stillschweigend genehmigt hat, so liegt ein Grund, das erwähnte Erträgnis als ein Theil des Schullehrergehalts zu erklären, nun (um) so minder vor, als der Letztere ohne Bezug darauf, dass sich sein Einkommen auf 525 Gulden 3 Kreuzer 3 Pfennige beläuft, also die Congrua (das Mindesteinkommen) 300 f bei weitem übersteigt“. Die Regierung entschied weiter: „Nachdem übrigens das Fundations-Vermögen der Schule Eschlkam, insoweit solches nicht als ein Theil des Lokal-Stiftungsvermögens des Marktes Eschlkam erscheint, auch den übrigen Inclaven (die Schulen in Stachesried und Schwarzenberg) des Schulbezirkes Eschlkam zu Gute geht, so versteht es sich von selbst“ – und nun der Kern des Urteils der Regierung – „daß bei Verwendung des fraglichen Erträgnisses von 16 f für arme Schulkinder auch jene der nach Eschlkam eingeschulten Landgemeinden participieren (daran teilhaben können)“. Die Entscheidung der Regierung war nun für beide Parteien bindend, vor allem für den Lehrer Dobler, der seinen Anspruch nicht durchsetzen konnte, schließlich auch weiterhin darauf verzichtete.
Das Jahresgehalt des Lehrers Dobler, angegeben mit über 500 Gulden jährlich, erscheint auf den ersten Blick zunächst hoch. Bedenken wir, dass um 1850 ein Gulden (f) etwa der Kaufkraft von 13-14 Euro entsprach, so hätte Lehrer Dobler, umgerechnet auf heute, etwa 7.350 Euro jährlich verdient, was monatlich etwa einen Verdienst von nur knapp über 600 Euro entsprochen hätte. So gesehen erinnert man sich unwillkürlich an die alte landläufige Äußerung vom „armen Schullehrer“. Daher war es bis in die jüngere Zeit herein für manchen Schulmann üblich, meist aber auch dringend nötig, für sich und seine Familie mit Nebentätigkeiten ein Zubrot zu verdienen, beispielsweise als Organist oder Gemeindeschreiber.
Werner Perlinger
Aus dem Briefprotokoll von 1719-1726
+Eschlkam. Ein wesentliches Element der zivilen Gerichtsbarkeit des Marktes Eschlkam war bis zum Jahr 1808 die Erledigung der anfallenden notariellen Aufgaben. Die Marktbehörde, hier der Marktschreiber als juristisch vorgebildete Persönlichkeit, protokollierte im Einvernehmen mit dem Amtsbürgermeister und den Ratsherren sämtliche Grundstücksveränderungen und Hausverkäufe. Auch wurden für die einzelnen Bürger bei Bedarf und Antrag Testamente und Heiratsverträge sowie sog. Geburtsbriefe niedergeschrieben.
Die darüber ausgefertigten originalen Urkunden erhielten die beiden an einem dinglichen oder sonstigen Rechtsgeschäft beteiligten Parteien. Der Vorgang wurde für eine spätere Überprüfung und zur amtlichen Erinnerung für die Marktbehörde eigens in einem sog. Briefprotokoll niedergeschrieben.
Es seien nun als Beispiele damaliger notarieller Verbriefungen einige Vorgänge aus dem ältesten Briefprotokoll des Marktes Eschlkam angeführt, wobei die Inhalte der Verständlichkeit halber sprachlich angeglichen wurden (Quelle: Marktarchiv Eschlkam, Briefprotokolle).
Es sei nun für eines der zahlreichen Beispiele ein Hausverkauf angeführt, der einen Tag nach heilig Drei König, am 7. Januar 1722 im Beisein der Marktbehörde abgeschlossen wurde:
Kaufsübergab für 35 Gulden
Maria, weiland des Herrn Johann Lährnbecher des Rats Bürger und Müller allhier hinterlassene „Wittib“ bekennt und übergibt auf geleisteteten Beistand (von) Herrn Georg Tenzl`s, (Mitglied) des äusseren Rats, ihrer geliebten Tochter Maria Emma, auch all ihren Erben und Nachkommen, nämlich ihre bisher ruhig innegehabte genutzte und genossene vermög BriefsProtokoll de dato 4. Februar 1707 durch Kauf an sich gebrachtes „Burgers Heusl am Schlossgraben“ gleich neben dem „gemainen Marckhts Rhathaus entlegen“, samt all den rechtlichen Ein- und Zugehörungen, nichts hiervon besondert noch ausgenomen, um und für obige 35 f (Gulden) Hauptsache, also und dergestalten, dass die Übernehmerin für solche Kaufsumme die Übergeberin gesund und krank mit aller Notdurft versehen, sie nach ihrem Absterben christ-katholischen Brauchs nach zur Erde bestatten lassen wolle und solle; was mit landgebräuchlicher Gewehrschaftsleistung versprochen wurde.
Actum, den 7. Januariy anno 1722.
Testes (Zeugen)
Hans Hastreiter, Schuhmacher und Hans Vogl, Bäcker,beide Bürger allhier.
Demnach erhielt die Tochter von ihrer Mutter das kleine Haus zu der Bedingung überschrieben, dass sie ihrer Mutter dem herkömmlichen Brauch nach beim Ableben die Beerdigung mit allen Ehren ausrichte. Das war wohl der sehnlichste Wunsch der alterenden Mutter.
Auch sei an dieser Stelle ein Testament auszugsweise vorgestellt:
Der Metzger Simon Wilhelmb wurde krank und sah sein Ende nahen. Er ließ daher sein Testament aufrichten. Beginnend mit der damals herkömmlichen Anrufung als formale Einleitung: „Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit Gott Vater, Sohn und heiliger Geist“ und nichts gewisser sei als der Tod, dessen „Zeith und Stundt hingegen ganz ungewiß“ ließ Wilhelm seinen letzten Willen protokollieren, um künftige Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden.
- Zu allererst befahl er dem allein seeligmachenden Erlöser und Schöpfer als dem geber und Urheber seiner Seele, dann der Mutter Gottes und der „ganzen himlischen Gesellschaft meine gedaht arme Seell“.
- Weiter ordnete er an, dass „mein Todter Leichnamb in das geweyhte Erdtreich der aalhiesig lobwürdigen St. Jacobs Pfarrkürchen Christ Catholischen Gebrauch nach begraben: und zur Erden bestettiget (werde)“. Ferner befahl er wie es Gewohnheit war, drei heilige Gottesdienste nebst einer „iedsmalligen heyl. Beimess sambt einer gesungenen Vigill“ zu abzuhalten.
- Zusätzlich mögen um 14 Gulden 28 heilige Messen „ohne Aufdringlichkheit gelesen und verricht werden“.
- 30 Gulden gab der Metzger Wilhelm an das „St. Jakobi Gottshaus“, damit für ihn, seine Ehefrau und für die beiderseitige ganze „Freindtschafft“ alljährlich zwei hl. Quatembermessen gelesen werden.
Erst jetzt folgen die weltlichen Bereiche:
- Zu Punkt 5 verfügte Wilhelm letztwillig, dass von seinem hinterbeliebenden Vermögen an die nächsten Verwandten jeweils 25 Gulden sogleich hinausgezalt werden.
- Weiter betont der Erblasser ausdrücklich, dass sein „nunmahliges Eheweib“ Magdalena während der ganzen Ehe ihm nur alles leibe und gute erwiesen und in der Hauswirtschaft und ihm in der Hauswirtschaft stets sehr „erspriesslich beygesprungen“ sei.
- Demnach setzte er gemäß der „Erbsatzung“ seine Ehefrau über das Haus und die Grundstücke zu seinem Haupterben ein.
- Sollte sein vorgebrachter Wille als ein „Testamentum sollemne nit gilig oder crefftig sein“, so ist es sein ausdrücklicher Wille, dass dieses als eine „Codicillhandlung“von Todes wegen oder anderer letztwilliger Disposition... bekräftiget werde.
- Ausserdem nahm Simon Wilhelm sich vor, seinen nun geäusserten letzten Willen zu Lebzeiten jederzeit noch ändern oder ganz aufheben zu können. Wenn dies nicht geschehe, so seien um 2 Uhr nachmittags Zeugen seiner letztwilligen Verfügung als bürgerliche Obrigkeit der Bürgermeister und die Markträte des „Churfürstlichen Pannmarckhts Eschlcamb“ wie die Weißbäcker Hans Vogl der Jüngere und Georg Hastreiter; dann die vier Schuhmacher Andre Hastreiter, Hans Zilckher der Jüngere, Wolf Pärtl und Hans Hastreiter der Jüngere; dann Paulus Fritz, Weber. Für gesamte Bürgerschaft werden genannt Wolfgang Lährnbecher als „verpflichter Burgermaister“ und Georg Andre Aicher, Marktschreiber.
- Letztlich bestätigen die sieben Zeugen den mündlich ausgesprochenen letzten Willen des testierenden Simon Wilhelmb am „1. Monatstag Juliy in 1720“.
Der Metzger Simon Wilhelm verstarb bald, denn am 4. März 1721 verkaufte die Witwe Magdalena an den „Ehrbahren Hansen Dimpfel, Burger und Fleischhackhern alhier“ die ihr durch Testament vom 1. Juli „anni praeteriti“ (des vorlaufenden Jahres) testamentarisch zugegangene „Burgersbehausung“ zwischen Hansen Schmausen und Hansen Hastreiters beiden Häusern liegend“ mit allem mobilen und immobilen Zubehör um 570 Gulden und 8 Gulden „Leykauf“ (was bei einem Kauf zur Befestigung und Bestätigung des Rechtsakts vom Käufer noch eigens gegeben und vetrunken wird). Darunter war auch das gesamte Werkzeug des Metzgers samt einer „kupfernen Waag und denen darzu gehörigen Gewichtern“.
Eine „Heurats Beschreibung“
Tod und Leben liegen nahe beisammen, daher wurden neben testamentarischen Verfügungen auch jederzeit Heiratsveträge geschlossen, um bei einem unvorhergesehenen Ableben eines Partners klare Verhältnisse in Erbangelegenheiten zu haben. So schlossen am 12. Februar 1724 der ledige aus Rimbach stammende Hans Georg Pichelmayr (Pielmeier) und Anna Emma Lährnbecherin, ledige Bürgerstochter vor der Marktbehörde einen Heiratsvertrag. Folgende Abmachungen wurden getroffen.
- Der Hochzeiter bringt zu „ainen wahren Heurat guett“ 150 f (Gulden) mit in die Ehe.
- Die Hochzeiterin bringt „auf Zufriedenheit des Hochzeiters“ mittel ihres am 7. Januar 1722 übernommenen „Heusls“ und wegen des Unterhalts der „eheleiblichen und respective Schwihermuetter underhalt“.
- Im Falle der unausbleiblichen Todesfälle wurde verabredest, dass wenn der Ehemann ohne vorhandene „Leibserben“ vor der Ehefrau sterben sollte, diese seinen „nechst Befreindten“ von den gegebenen 150 Gulden nicht mehr als 25 Gulden und dazu die besten „3 Stuck Halsklaider hinauszegeben“ hätte.
- Sollte die Ehefrau vor ihrem Mann unter den genannten Bedingungen sterben, so müsste der Mann an ihre nächste Verwandtschaft 20 Gulden bezahlen und ebenso die besten drei „Halsklaider“ rausgeben.
- Im letzten Punkt sollte bei Uneieinigkeit nach dem geltenden Landrecht und dem üblichen Herkommen entschieden werden.
An „Heurats Zeuch“ (Heiratszeugen) waren von seiten des Bräutigams aufgeboten Wolf Garz von Offersdorf, Georg Seidl und Franz Pichelmayr von Rimbach, Untertanen der Hofmak Lichtenegg. Zeugen der Braut waren von Eschlkam die Ratsherren Georg Tenzl und Franz Schmierl sowie der Bader Stephan Mauser. Als „Siglsgezeugen“ fungierten die Bürger Hans Penzkhover, Müller und Andre Hastreiter.
Werner Perlinger
Seifensieder Franz Pfeffer bittet erfolgreich um Senkung einer Steuerschuld
+Eschlkam. „Gesuch des Seifensieder Franz Pfeffer um einen Nachlaß an seiner Gilt von jährl. 11 f (Gulden) zur Schulstiftung Eschlkam betreff.“, lautet der Titel eines Aktes, datierend aus dem Jahr 1857. Am 20. Januar erscheint Pfeffer im Rathaus des Marktes und bringt gegenüber Bürgermeister Moreth und dem Marktschreiber Beutlhauser vor, „bei meinem Anwesen Nr. 60 (heute Marktstraße 15-Metzgerei Lemberger) befindet sich seit dem Jahre 1803 ein Gemeindetheil Nr. 18, welcher vom H. Pfarrer Huber (1800-1811) der hiesigen Schule für immer überlassen worden ist, für dessen Benützung eine jährliche Gilt (steuerliche Abgabe) von 11 Gulden (in Folge abgekürzt mit >f<) an die Schulstiftung bezahlt werden muß.“ Seit 53 Jahren, eben seit 1803, werde diese von ihm und seinen „Vorfahren“, hier die Vorbesitzer seines Anwesens, an den Schulfond bezahlt, was schließlich bisher die stolze Summe von 583 Gulden ergeben habe. Auch sei, so Pfeffer, seither „von uns die Grundsteuer und der Zehent, respektive der Bodenzins bezahlt worden“. Das Grundstück, 1 Tagwerk und 65 Dezimal groß, sei laut Katasterauszug nur in die Bonitätsklasse 4 eingestuft. Daher stünden die Erträgnisse in keinem Verhältnis zu den Steuern und Abgaben, und er begründet dies mit dem Hinweis, „der Boden ist lehmig und das Grundstück selbst ist höchst ungünstig situiert, da es nur von der Morgen- und Mittagssonne bescheint“ werde. Auch habe mehrmals der Hagel die „angebaute Frucht“ zerstört, auch sei sie infolge heftiger Regenfälle „auf dem lehmigen Boden zu Grunde gegangen“. Nun wage er auf „einen Nachlaß an der Gilt von 11 f nachzusuchen, weil diese zu hoch angesetzt ist“, so Pfeffer gegenüber dem Magistrat.
Zur Person des Gesuchstellers: Pfeffer (geb. 06.11.1818 in Nr. 59/Marktstr. 13), von Beruf Seifensieder, war im Jahr 1845, am 26. Mai durch Heirat der Seifensiederstochter Katharina Schreiner in den Besitz des mit Grund und Boden auf 5000 Gulden geschätzten unmittelbar benachbarten Anwesens gekommen. Daher lautet der ältere Hausname „beim Seifensieder“.
Der Kürzung der „Gilt“ widersprochen
Am 5. Februar beschloss die „Schulfondverwaltung“, damals gebildet von Bürgermeister Simon Moreth und den Markträten Carl Müller, Mathias Späth und Georg Forster, den Betrag von 11 f, der jeweils an die Schule zu zahlen sei, um 4 f zu reduzieren. Gar nicht einverstanden mit dieser Entscheidung zeigte sich jedoch Pfarrer Karl Pittinger (1843-1859). Noch im 19. Jahrhundert waren die jeweiligen Ortspfarrer zugleich „Schulinspektoren“, d.h. ihnen oblag die „Schulrevision“ im Bereich ihrer anvertrauten Pfarrei. Jede Schule musste „revidiert“ (überprüft) werden, d.h. der Pfarrer stand damals über der Lehrerschaft. Am 20. Februar reagierte er als Vorsitzender der „Königlichen Lokalschulinspektion Eschlkam“ in einem längeren Schreiben auf den Beschluss des Marktrats, mit dem deutlichen Hinweis, dass man damit „nicht einverstanden sein könne“. Er begründete diese seine Ansicht ausführlich in acht Punkten. Unter anderem führte er an, das fragliche Grundstück („das damals noch gar nicht kultiviert war“) sei am 17. April 1804 dem ehemaligen Besitzer von Nr. 60, dem Krämer Anton Prückl überlassen worden verbunden mit der Pflicht, „die 11 f jeden Jahres zum Schulfonde richtig zu erlegen“. Auch sei der Einwand Pfeffers, „die Erträgnisse dieses Grundstücks stünden in keinem Verhältniße mit dem Pachtgelde u. mit den Steuern“ sei nicht stichhaltig. Auch habe sich „die Zahl der armen Schulkinder, für die bezahlt werden muss, im Schulsprengel Eschlkam nicht vermindert, vielmehr müsse mit einer Zunahme gerechnet werden“. Zudem betonte Pfarrer Pittinger, sollte Pfeffer dieses Feld nicht mehr behalten wollen, so werde sich auf dem Versteigerungswege hierfür gewiss ein Käufer finden. Auch habe dieser Acker „als Gemeindeantheil nicht als Privateigentum dem Pfarrer Philipp Jakob Huber sondern zum Pfarrwiddum gehört“ (das sind die landwirtschaftlichen Gründe, die einst zu einem Ökonomiepfarrhof gehörten). Er konnte und wollte also nicht in seinem Namen allein, sondern auch im Namen und mit Zustimmung aller folgenden Pfarrpfründe-Besitzer zur Unterstützung der armen Schulkinder, beziehungsweise ihrer Eltern im Schulsprengel Eschlkam „als fortwährendes stets freiwilliges Almosen des jeweiligen Pfarrers das für immer festgesetzte, bedingte Stiftgeld vom berechtigten Nutznießer dem Schulfonde abtreten“.
Schließlich schaltete sich in dieser Angelegenheit als die dem Magistrat übergeordnete Behörde das Landgericht Kötzting ein. Am 29. Mai 1857 wurde dieser angewiesen, bezüglich seines Beschlusses vom 5. Februar nachträglich die Erinnerung der Gemeindebevollmächtigten einzuholen, was am 5. Juli auch geschah. Diese erklärten, „daß sie den fraglichen Beschluße des Magistrats ihre Zustimmung ertheilen“, und somit dem Pfeffer ein Nachlass von 4 Gulden zu gewähren sei. Schließlich wurde die Sache zur endgültigen Entscheidung der höchsten Instanz, der Regierung von Niederbayern in Landshut vorgelegt. „Im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern“ wurde entschieden, dass den „zur Schule Eschlkam stiftbaren sog. Schulacker auf der Trad Pln. 413 ½ zu 1 Tagw. 65 Dez…. die Minderung der auf diesem Grundstücke zur erwähnten Schule zu reichenden jährl. Stiftverzeichnis von 11 Gulden auf 7 Gulden hiermit von Obercurentel (die oberste Pflegschaftsverwaltung) wegen genehmigt werde“. Die Bemühungen des Seifensieders Pfeffer um Minderung seiner Steuerschuld hatten somit Erfolg. Zugleich wurde der Beschluss des Magistrats vom 5. Februar bestätigt. Diese Entscheidung fiel wohl auch deshalb nicht so schwer, als seit 1832 bereits die Schulfondstiftung des Andreas von Ritter bestand.
Werner Perlinger
Als aus der Kreishilfskasse dem Bürger Joseph Harlander nicht geholfen werden konnte
+Eschlkam. Im Archiv des Marktes befindet sich ein Akt mit dem Titel: Gesuch um ein Darlehen aus der Kreishilfskasse des Joseph Harlander, Wagner und Bürger zu Eschlkam. Zunächst über den Gesuchsteller: Joseph Harlander, von Beruf Wagner (geb. 24.02.1805) stammte aus Michaelsbuch nahe dem Kloster Metten. Er verehelichte sich am 20. August 1832 mit Therese, der Tochter des Wagners Wolfgang Pachmeier und heiratete so in das Anwesen Nr. 65 ein, jetzt Großaigner Straße 13. Bei der Familie Pachmeier fehlte offenbar der männliche Erbe, um das Gewerbe weiter zu führen. So kam es, dass die Tochter Therese bereits 1830 nach dem Tode des Vaters das Anwesen übernommen hatte.
Die Lage des Handwerksbetriebes war an sich günstig, denn unmittelbar am Hause führte die Handelsstraße vorbei, auf der damals der Fuhrverkehr zwischen Bayern und Böhmen pulsierte. Und manchmal waren die Fuhrleute gezwungen plötzlich auftretende kleine Schäden an den schweren Transportwägen noch vor Ort von einem Wagner reparieren zu lassen. Daneben gehörte zum Anwesen eine sehr bescheidene Landwirtschaft, nachdem im Jahr 1828 im Rahmen einer statistischen Erhebung an Vieh nur eine Kuh, ein Jungrind und ein Schwein im Stalle gezählt werden konnten.
Untertänig ein Gesuch gestellt
Am 7. Februar 1842 erschien der Wagnermeister Harlander im Rathause bei Bürgermeister Kaufmann und bat „sein unterthänigst gehorsamstes Gesuch um gnädigste Erlangung eines Vorlehens von 250 f (Gulden) aus der Kreishilfskasse zu Protokoll zu nehmen“. Als Gründe dafür nannte der Wagnermeister im Jahr 1832 die Übernahme des Anwesens im Schätzwert von 700 f, ferner die vorher nicht erkannte aber nun gegebene erhebliche Baufälligkeit des Hauses, so dass „meine Familie aus Mangel anderen Obdaches dort der Gefahr des Erschlagens ausgesetzt ist und ich mir dort mein Vieh nicht einmal unter zu bringen getraue“. Auch sei er bisher „in der Ausübung seines Gewerbes ganz und gar beschränkt“ gewesen, und so habe er „hierdurch seine Kunden verloren“. Weiter gibt Harlander an, „er selbst (ist) immer etwas kränklich und wie mein Habitus zeuget, nicht recht fest“.
Um seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können, bat er inständig, dass ihm aus der Kreishilfskasse geholfen werde (damals eine Art Kreditinstitut, geschaffen für den Landgerichtsbereich Kötzting, zur gegenseitigen Hilfe für im Falle von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Tod etc. in wirtschaftliche Not geratene Bewohner). So wolle er sein Haus reparieren lassen und „die mir zum Betriebe meines Wagnergewerbes – meiner und meiner Familie einzigen und alleinigen Erwerbs- und Einkommensquelle die unumgänglichen nötigen Gewerbs: Vor- und Einrichtungen beischaffen könnte, wodurch allein schon ich imstande wäre, das gnädigste Darlehen fristenweise zurückzuzahlen“. Er wolle das Darlehen innerhalb von 15 Jahren zurückzahlen.
In Berufung gegangen
Der Armenpflegschaftsrat des Marktes kam nach Prüfung der Lage Harlanders in einem „Resolutum“ (endgültiger Beschluss) zu dem Ergebnis das Gesuch wegen Mangels einer geeigneten „Bürgschaft“ abzuweisen. Harlander gab jedoch nicht auf. Er ging in Berufung und nahm sich dazu auch Rechtshilfe bei einem Advokaten namens Müller. Am 16. Februar 1842 wiederholte er wortgetreu in den einzelnen Ausführungen sein Anliegen um eine finanzielle Hilfe zu erhalten und richtete so sein Gesuch an die Regierung von Niederbayern, der „Kammer des Innern“ mit Sitz in Landshut.
Wenige Wochen später, am 30. März 1842, übermittelte das Landgericht Kötzting die Entscheidung der Regierung an den Armenpflegschaftsrat in Eschlkam. Demnach wurde von der höchsten Instanz am 11. März das Gesuch Harlanders mit folgender Begründung abgewiesen:
„Es sei dem Joseph Harlander zu eröffnen, daß seine Berufung v. 14. und 16. Febr. 1842 darin keine Folge gegeben werden könne, weil er nicht durch einen besonderen Unglücksfall, sondern durch eine unkluge Ansäßigmachung ohne Vorerwägung seines Nahrungsstandes in Noth geraten sei, und weil selbst, wenn davon Abgang genommen werden dürfe, nicht abzusehen wäre, wie er bei seiner selbst angegebenen Kränklichkeit im Stand sein würde, die Annuitäten (jährliche Zahlungen zur Tilgung einer Schuld) gehörig zu leisten“.
Das Landgericht gab demnach der Armenpflege Eschlkam den Auftrag, die für das Protokoll vom 7. Februar 1842 erhobene Taxe (Gebühr) zurückzubezahlen. Es werden in diesem Schreiben noch einzelne Paragraphen rechtsbegründend angeführt. Es waren bei Betrachtung der wirtschaftlichen und vor allem auch der persönlichen Situation Harlanders nicht die Sicherheiten vorhanden, die Voraussetzung gewesen wären, den gewünschten Kredit zu gewähren.
Der Wagner Harlander hatte wenig später sein Handwerk und den Besitz des Anwesens aufgegeben, denn im Jahr 1843 erscheint als neuer Eigentümer von Nr. 65 der Wagner Joseph Greil aus Arrach. 1847, am 28. September erwarb das Anwesen mit den dazu gehörenden Gründen der noch junge Sattlermeister Joseph Pfeffer (von Nr. 59/Marktstraße 13) um den Preis von 1475 Gulden. Greil verzichtete zugleich auf die Wagnerkonzession, und der bisherige Hausname „beim Wongner“ wechselte infolge des neuen Besitzers, des Sattlers Pfeffer später zu „beim junga Sodla“, denn das Anwesen seiner Herkunft hatte den damaligen Hausnamen „beim oltn Sodla“ - dies weil bereits der Vater Pfeffers als Fuhrmann zugleich das Sattlerhandwerk ausübte. Der Name „Harlander“ taucht in späteren Dokumenten nicht mehr auf. Er dürfte aus Eschlkam weggezogen sein.
Werner Perlinger
Regierung prüfte gründlich die Verwaltungsarbeit des Kommunaladministrators
+Eschlkam. Im Marktarchiv haben sich u.a. auch Akten erhalten, mit dem für Laien kaum verständlichen Titel >Revisionserinnerungen<. Sie stammen aus napoleonischer Zeit und sind das Ergebnis grundlegender staatlicher Neuerungen in der Verwaltung für Städte und Märkte. Dabei müssen wir auf das Jahr 1808 zurückblicken: das politische Streben, ausgehend vor allem vom damaligen Innenminister Graf von Montgelas zu Anfang des 19. Jahrhunderts, war, das Land Bayern zu einem zentralen Einheitsstaat werden zu lassen, allein ausgerichtet auf den gerade herrschenden Monarchen, den von Napoleons Gnaden eingesetzten 1806 König Max I. Joseph. Auf regionaler Ebene war es Absicht des zentralen Staates, dem jeweiligen Landrichter in seinem Landgerichtsbezirk, für Eschlkam war es Kötzting, alle Gewalt zu übertragen und, damit er seine Aufgaben optimal durchführen könne, die ihm anvertraute Region in Gemeinden einzuteilen. Eine zunächst empfindliche Einbuße hat durch diese eingeleiteten staatlichen Reformen unser märktisches Gemeinwesen erhalten, als die bayerische Regierung unter Minister Montgelas daran ging, den Gemeinden ihre Selbstständigkeit zu nehmen und sie zu letzten Werkzeugen des Staates zu machen. In diesem Sinne wurde die dem Markt Eschlkam seit dem frühen 13. Jh. zustehende und stets ausgeübte „Niedere Gerichtsbarkeit“ (diese befasste sich mit den geringeren Delikten des Alltags, sühnbar mit Geldbußen oder leichteren Leibstrafen) entzogen und an das Landgericht Kötzting verlegt, sowie auch die Verwaltung des Gemeinde- und Stiftungsvermögens genommen.
Der Verwalter
Sämtliche bisherige Aufgaben wurden landesweit nun eigenen von der Regierung aufgestellten „Kommunaladministratoren“ übertragen. Für Eschlkam war, wie in anderen Gemeinden auch, für diesen neu geschaffenen Posten der entsprechend dafür gebildete Marktschreiber als „Kommunaladministrator“ (Verwalter der Gemeinde) bestimmt. Kgl. bayer. Kommunaladministrator in Eschlkam durfte sich nun der gerade amtierende Marktschreiber Franz de Paula Bach nennen. Er führte die Rechnungsbücher der Marktgemeinde und bestimmte allein den Verlauf der für den Markt Eschlkam wesentlichen Initiativen. Nicht er wurde wie bisher vom Marktrat und dem Bürgermeister angewiesen, sondern er traf kraft seines nunmehrigen Amtes allein die Entscheidungen. Damit war er, politisch betrachtet, der mächtigste Mann in der Gemeinde. Der jeweilige Bürgermeister rückte vom Status her an die zweite Stelle und mit ihm die Markträte. Dem Marktschreiber Pach wurde, das sei her nur am Rande erwähnt, am 12. Dezember 1809 im Hause Nr. 33/Waldschmidtplatz 2 (Rathaus) der Sohn Alois (P)Bach geboren, der im 19. Jahrhundert als Freund und Kollege des Malers Carl Spitzweg eine der berühmten Malerpersönlichkeiten in Ostbayern werden sollte.
Alles wurde überprüft
Die Tätigkeit des Administrators Bach wurde vom Landgericht Kötzting penibel überwacht und im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Überprüfungen, damals bezeichnet als „Revisionen“, aktenmäßig dokumentiert. So wurde z.B. für das Rechnungsjahr 1809/10 festgestellt, dass laut Inhalt der Kommunalrechnung die Einnahmen des Marktes sich auf 2040 f (Gulden) beliefen; dagegen die Ausgaben nur auf 914 f, so dass der sparsamen Gemeinde ein „Aktivwert“ von 1126 f verblieb. Da das Landgericht Kötzting selbst keine Regierungsblätter „an die Administration abfolgen ließ, so wurde der Jahrgang 1810 vom Mautschreiber Weigl beigekauft“ und die von ihm dafür ausgelegten 7 Gulden 48 Kreuzer rückerstattet.
In der Rechnung des folgenden Jahres, 1810/11, wird erörtert: „nachdem zur Berichtigung der Kriegsumlagen“ – wir befinden uns in der Zeitspanne der von Napoleon geführten Kriege - „eine ganze Bürgersteuer erhoben wurde, und während die Kriegsumlage nur ¾ der Bürgersteuer beträgt, so hätte zur Berichtigung der Polizeikordons (für die Bewachung der Grenze) Umlagen, welche ¼ der Bürgersteuer beträgt, nicht erhoben werden dürfen“. Peinlich genau wurde so jede finanzielle Angelegenheit der Gemeinde geprüft. Ebenso verhielt es sich bei Überprüfung der sog. „Bothenlöhne“. Die Post wurde damals mittels eigens eingesetzter Boten nach Waldmünchen gebracht oder von dort auch abgeholt, denn die oberpfälzische Stadt war damals eine wichtige Station der sog. Thurn- und Taxis-Post, die hierfür landesweit das Monopol innehatte. Für den doch häufigen Briefverkehr mit dem Landgericht Kötzting war im Markte zudem ein eigener Bote tätig.
Das Feuerlöschwesen oblag noch vor Gründung der Freiwilligen Feuerwehren allerorten wegen der oft verheerend sich auswirkenden Brandkatastrophen bereits einer besonderen Beachtung. So wird im Rechnungsjahr 1810/11 festgestellt: „In der Inventur über die Feuerlöschrequisiten hieß es, der als Bürger aufgenommene Johann Hastreiter bringt 1 Feuerhacken nach.“ Jedoch, so wurde festgestellt, „nach der Bürgeraufnahms Tabelle hat er (Hastreiter) eine Feuerleiter herzustellen – der Rechnungsvortrag ist also irrig“, so die Erkenntnis der amtlichen Prüfung. Ähnlich wie die geschilderten beinhalten die weiteren Protokolle oft gleiche oder auch so ähnliche Inhalte. Letztlich lautet der Auftrag der Prüfstelle an die Gemeinde: „die Revisions-Erinnerungen (Anmahnungen) sind genau zu befolgen und zu beantworten, dann mit der berichtigten Etatsrechnung zur Vorlage zu bringen“. Diesen Hinweis zu befolgen galt für alle Kommunen im damaligen Bayern.
Resumee: So mächtig oder auch bedeutend für die Gemeinden in den Jahren 1808-1818 die Stellung der eingeführten sog. Kommunaladministratoren auch erscheinen mag. Ihnen waren enge Grenzen gesetzt. Ihr Verwaltungshandeln für die anvertrauten Kommunen oblag bis ins Detail einer gewiss stärkeren Beobachtung als in den Zeiten vorher. Mit der zweiten sog. Bamberger Verfassung wurde die Institution >Kommunaladministrator< abgeschafft und den Gemeinden wieder ihre Selbstständigkeit zurückgegeben.
Werner Perlinger
Ein Bauernbub aus Großaign wurde Domkapitular im Erzbistum München-Freising
+Eschlkam. Nach Andreas von Ritter sei nun eine weitere berühmte Persönlichkeit aus dem Gemeindebereich dem Leser vorgestellt: Am 13. Dezember 1786 wurde in Großaign ein Joseph Wurm geboren. Der Eintrag im Taufregister von Eschlkam lautet übertragen aus der lat. Sprache: „Von Herrn Joseph Müllner wurde getauft Joseph, legitimer Sohn des Johann Wurm, Söldners (Kleinbauer) und der Maria Walburga; deren Vater war Georg Singer, Söldner von Ritzenried: Pate (war) Michael Brey, Söldner von Großaign“. Dieser Joseph Wurm verstarb am 29. Juni 1866 als Domkapitular des Erzbistums München-Freising. Aufgrund der hohen kirchlichen Stellung, die der Waldlerbub in der Diözese München-Freising einst bekleidete, sei es angebracht, diese Persönlichkeit der Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen. Vorweg, das Domkapitel ist ein Kollegium von Priestern, darunter Weihbischöfe, das den Bischof in der Leitung eines Bistums unterstützt.
Über den Domkapitular und erzbischöflich geistlichen Rat Joseph Wurm, der seine Wurzeln in der in Großaign noch heute mehrfach vertretenen Familie gleichen Namens hat, allgemein bekannt mit dem Hausnamen „Wastl“, findet sich im Pastoral-Blatt für die Erzdiözese München Freising ein „Nekrolog“ (Nachruf), der den interessanten und vielfältigen Lebensweg dieses verdienten Priesters nachzeichnet. Davon sei auszugsweise berichtet: Joseph war der Sohn des Söldners (Kleinbauer) und Webers Johann Wurm und seiner Ehefrau Maria Walburga, eine geb. Singer von Ritzenried. Seine Mutter verlor der junge Joseph bereits im Alter von fünf Jahren. Deren Schwester Theresia Singer führte das Hauswesen weiter. Als tief religiöse Frau gab sie nun „dem kleinen Joseph jene Richtung, die er mit so großer Entschiedenheit sein langes Leben hindurch festhielt.“ Der Vater wollte zunächst von dem Willen des Knaben, den Priesterberuf zu ergreifen nichts wissen. Trotzdem hielt der Knabe an seiner Absicht fest denn er „schien zur ländlichen Arbeit so gar kein Geschick und gar keine Lust zu besitzen“. Nun bot der Onkel des Vaters, der Pfarrer Michael Wurm von Gimpertshausen (Bistum Eichstätt) seine Unterstützung an, so dass er nach halbjährlicher Vorbereitung im Pfarrhof zu Eschlkam im Herbst 1798 an das Gymnasium in Straubing wechseln konnte. Es folgte dann der Besuch des Lyzeums in München von 1805 bis 1807, dann das Georgianische Clericalseminar in Landshut.
Von berühmten Lehrern geprägt
Seine dortigen Lehrer waren u.a. Johann Michael Sailer (Bischof von Regensburg 1829-1832) und Patrik Zimmer (Prof. für Dogmatik), die den werdenden Theologen entscheidend prägen sollten. 1810, am 16. September in Regensburg zum Priester geweiht, wurde er 1811 zunächst Hilfspriester bei dem Pfarrer von Oberviehbach (Ldkr. Dingolfing-Landau), Franz Xaver Schwälbl, dem späteren Bischof von Regensburg (1833-1841). „Dort und in der nahen Pfarrei Loiching“, so im Nachruf, „lernte er im Geiste Sailers und Wittmanns (Bischof v. Regensburg, 1832/33) arbeiten und wirken“.1815 wurde Wurm das Schulbenefizium in Kronwinkl (bei Landshut) übertragen. Dort wirkte er beispielgebend zehn Jahre als Schullehrer und Seelsorger. 1825 wechselte er auf die Pfarrei Wartenberg (Ldkr. Erding). „Die Seelsorge in Wartenberg nahm, da er sie ganz allein zu versehen hatte, die Kräfte Wurms in hohem Grade in Anspruch“. Zugleich wurde er 1827 Distrikts-Schulinspektor „und 1829 zum Dekan des Landcapitels Erding gewählt“. Da dem Erzbischof von München-Freising Lothar Anselm (von Gebsattel, 1821-1846) die „bedrohten Gesundheitsverhältnisse des von ihm in hohem Grade geschätzten Pfarrers bekannt wurden“ erhielt er die Pfarrei Tölz übertragen. 1835, am 10. März, wurde Wurm zum Pfarrer von Riedering (Ldkr. Rosenheim) ernannt, dort „besserte sich sein körperliches Befinden bald und rasch“, so dass er auch wieder die Schulinspektion übernehmen konnte. Einem Districts-Schulinspektor oblag die Schulrevision in seinem Distrikt. Jede Schule sollte von ihm innerhalb von drei Jahren einmal revidiert (überprüft) werden – eine Menge Arbeit bei der damals gewiss nicht geringen Größe der Distrikte.
Den Pfarrer in den genannten drei Orten „zeichnete vor allem die kräftige Energie aus, mit der er in allen Zweigen Ordnung hielt und Ordnung schaffte“, so der Bericht im Nachruf. „Sein Tun verschaffte ihm Respekt und milderte auf der anderen Seite die natürliche Derbheit, die bisweilen wohl etwas durchleuchten mochte“. Vor allem „die Wiederaufrichtung des Schlossbenefiziums in Riedering“, zerstört im Jahr 1803 im Zuge der Säkularisation (die staatliche Einziehung kirchlichen Besitzes) - „ein niedliches Kirchlein und das damit in Verbindung stehende Schul- und Benefiziatenhaus sind ein bleibendes Denkmal“ an den Pfarrer Wurm.
Politiker geworden
Von 1840 bis 1843 war er Mitglied der Kammer der Abgeordneten der Bayerischen Ständeversammlung, wo er in München an den Sitzungen teilnahm. „Seine Gesinnungen wurden dem monarchischen Prinzip entsprechend und in religiöser Beziehung (als) streng katholisch“ beurteilt. Er selbst wurde als „wissenschaftlich gebildet, eifrig, als sehr guter Schulmann“ gewürdigt. Dabei „zeigte er klarste Einsicht in die wahren Verhältnisse des Volkes, auch nach der materiellen Seite hin“. Sein Hobby war die Imkerei. Pfarrer Wurm galt in den ersten vierziger Jahren allgemein als einer der würdigsten und fähigsten Pfarrer der Erzdiözese, so dass der Oberhirte Lothar Anselm, der Wurm schon am 30. September 1840 zu seinem geistl. Rath ernannt hatte, durch Dekret vom 7. März 1844 in das Metropolitankapitel in München berief“. Nun war Joseph Wurm Domkapitular geworden.
Auch in den damaligen höchsten Kreisen wurden die Verdienste des Priesters Wurm anerkannt, so dass ihm das Ritterkreuz des St. Michaelsordens und das Ehrenkreuz des Ludwigsordens verliehen wurden. „Einer der letzten Lichtpunkte war die Feier seiner Secundiz (Goldenes Priesterjubiläum-1860),“ die er in Riedering abhielt, wo mittlerweile sein Neffe Franz Xaver Wurm als Pfarrer wirkte. „Die Heiterkeit war überhaupt ein hervorstechender Zug im Charakter des sonst so strengen und ernsten Mannes“, so das Urteil über sein Wesen. Seine Sommeraufenthalte verbrachte Wurm in Obermais bei Meran oder in Obladis im Oberinntal. Nach einer Messe im Dom, die er feierte, „tath er auf dem Heimwege einen harten Fall. Seit dieser Zeit verließ er sein Gemach nicht mehr…Nachdem er all sein Vermögen seinen emeritierten (in den Ruhestand versetzten) Mitbrüdern zugewandt hatte,… äußerte er sich mit ruhiger Sicherheit am Morgen seines Todestages: Heute werde ich die große Reise antreten.“ Das war am Tage Peter und Paul, den 29. Juni 1866. Zu erwähnen sei noch, dass für die Pfarrkirche von Eschlkam Barbara Wurm, eine nahe Verwandte des Domkapitulars, im Jahr 1888 das Fenster vor dem rechten Seitenaltar stiftete.
Werner Perlinger
Verpachtung der Gemeindejagd von Eschlkam im 19. Jahrhundert
+Eschlkam. Zunächst zur Geschichte des Jagdwesens einige allgemeine Ausführungen: Die Verbindung von hohen Wildschäden und Jagdfrondiensten für die adeligen Herren im Mittelalter und der Folgezeit war schließlich einer der Gründe für das Aufbegehren der Bauern im Deutschen Bauernkrieg von 1524 bis 1526. Mit der Niederlage der Bauern gingen jedoch auch deren Forderungen, betreffend das Jagdwesen, wieder unter.
Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts wurde den Bauern in manchen Herrschaften sogar das bloße Vertreiben des Wildes von ihren Feldern verboten und schwerste Strafen, bis hin zur Todesstrafe für Wilderei verhängt. Die herrschaftliche Jagd erhielt einen weiteren Bedeutungszuwachs als gesellschaftliches Ereignis und Repräsentationsmittel der Landesfürsten. In Folge der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert verloren zwar viele Fürsten ihre Souveränität, jedoch behielten und benutzten sie vielerorts weiterhin ihre herrschaftlichen Privilegien, auf fremdem Grund und Boden zu jagen. Neben den unmittelbar betroffenen Bauern verlangte nun aber auch das erstarkende, liberale Bürgertum die freie Verfügungsgewalt an privatem Grundbesitz, die rechtliche Unabhängigkeit des Einzelnen sowie den Schutz des produktiven Eigentums.
System der Revierjagd
Die deutsche Revolution von 1848/49 stellte eine Zäsur dar und brachte grundlegende Veränderungen für die Jagd in den Ländern des deutschen Bundes. Das Gesetz zur Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden und über die Ausübung der Jagd vom 31. Oktober 1848, stellte eine jagdrechtliche Zeitenwende dar, indem es das Jagdregal des Adels sowie alle Jagdfrondienste ohne Entschädigung aufhob und das Recht zur Jagd an das Eigentum von Grund und Boden band. Zu einer bedeutenden Korrektur kam es durch später erlassene Regelungen die das bis heute bestehende sogenannte Revierjagdsystem begründeten. Grundeigentümer wie Gemeinden mussten das Jagdausübungsrecht, in der Regel in einer Gemarkung, an einen Jäger verpachten.
In dieser Lage befand sich auch die Marktführung von Eschlkam im Jahre1850: Am 4. Juli wurde vom Marktschreiber protokolliert, dass „im Betreffe der Ausübung der Jagd beschloßen wurde, daß der Gemeindebezirk Eschlkam als ein Jagdbezirk zu verpachten und nicht in mehrere derlei Bezirke abzutheilen sei“. So wurde zunächst bekannt gemacht, es bestehe „das Pachtobjekt in dem 1400 Tagwerk großen Eschlkamer Jagdbezirk und daß dazu noch 400 Tagwerk Hohenbogener Waldung gehören, welche in den 1400 Tagwerk schon begriffen sind “. Diese 400 Tagwerk wurden einige Jahre später als eigener „Schwarzenberger Jagdbezirk“ abgetrennt, so dass der Eschlkamer Bezirk von nun an „nur“ 1000 Tagwerk betrug.
Feste Regeln bestimmt
Die „Verpachtungsbedingnisse“ wurden minitiös genau in eigens niedergeschriebenen 13 Paragrafen festgelegt. So wurde die Dauer einer Pacht auf drei Jahre begrenzt. Das gewährte Jagdprivileg endete vorzeitig mit dem Tode des Pächters oder dessen Wegzug. Allein nur der Pächter durfte im zugewiesenen Bereich jagen. Trotzdem durfte er „jagdkartenbesitzende Individuen (die den Jagdbereich genau kannten) als Jagdgäste einladen“. Genau einzuhalten war vom Pächter „die Schuß- und Hegezeit der verschiedenen Wildgattungen“. Ferner durfte der Jagdausübende die „Grenzen des Jagdbezirks nicht überschreiten“. Auch wurden Vorkehrungen getroffen, „für den Fall, wenn der Pächter die verpachtete Jagd durch übermäßiges Ausschießen in Abnahme gebracht hätte“, dass der Pächter „bei seinem Austritte aus der Pacht eine angemessene Vergütung zu leisten (hatte), welche in die Gemeindekasse fließt“. Auch wurde die Zahlung des „Pachtschillings“ jährlich stets am 4. Juli fällig. In diesem Jahr 1850 erhielt der Bürger Anton Maurer (Hsnr. 1 ½ /Further Straße 12) für sein Gebot von 10 Gulden, 6 Kreuzer die Gemeindejagd zugesprochen. Zugleich erhielt er als amtlichen Ausweis eine sog. „Jagdkarte“ ausgehändigt. Für die gewährten drei Jahre musste er 30 Gulden 18 Kreuzer erlegen. All diese Entscheidungen überwachte als die dem Markte Eschlkam übergeordnete Behörde das Landgericht Kötzting, wie der Schriftverkehr beweist.
Jagdrecht für den Pfarrer
Nachdem Maurer drei Jahre später die „Jagd nicht mehr behalten wollte“ wurde das Jagdrevier 1853 erneut versteigert. Bieter waren der Kaufmann Carl Müller (Hsnr. 25/Waldschmidtplatz 8) und der Zolloberinspektor Weigl, der damals wohl im sog. Mauthause (Nr. 5 ½ /Further Straße 1) wohnte. Weigl erhielt den Zuschlag mit 10 Gulden 30 Kreuzer, da er 6 Kreuzer mehr als Müller geboten hatte. Ein Jahr später, am 23. März 1854, beendete der Zollbeamte Weigl, er war in dieser Zeit Vorsteher des Zollamtes in Eschlkam, die Pacht, da er dienstlich nach Neumarkt versetzt worden war. Nachfolger in der Pacht wurde ab 1. Mai, aber nur für acht Monate bis Ende 1854 zunächst der Bürger Sebastian Würz, als ihm die Jagdkarte als Berechtigung eingezogen wurde.
Letztlich wandte sich am 19. März 1855 Karl Pittinger als „Pfarrer und Ökonom“ an den Marktmagistrat von Eschlkam, mit der Bitte ihm drei Tage später, am 22. März, die Gemeindejagd pachtweise zu überlassen. Hier sei anzumerken, dass bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhundert in Eschlkam die Pfarrökonomie noch vorhanden war. Als sog. „Mitpächter“ habe sich Pittinger, der als Priester selbst kein Jäger war, den Herrn „Anton Multerer, Privatier dahier“ ausgesucht. Da er an diesem Tage nicht in Eschlkam sein könne, habe er dem Multerer, dem er „unbedingte Vollmacht“ eingeräumt hatte, aufgetragen, die Jagd „um jeden ihm gutdünkenden Preise“ zu pachten. Pittingers Gesuch hatte Erfolg, aber mit der Einschränkung, dass sein Mitpächter nicht Multerer sondern der Privatier Anton Maurer wurde. Mit der Pacht, die bis 22. März 1858 festgesetzt war, wollte der Pfarrherr wahrscheinlich u.a. auch die Versorgung seines Haushalts mit Wildbret sicherstellen.
Werner Perlinger
In Eschlkam geboren - dem bayerischen Königshause als hoher Beamter gedient
+oder
Sohn des Marktes machte im 18./19. Jahrhundert eine beispiellose Karriere
Eschlkam. Der Markt Eschlkam darf sich rühmen im 18. Jahrhundert eine Persönlichkeit hervorgebracht zu haben, die in der Zeit ihres beruflichen Wirkens in der Landeshauptstadt München eine der höchsten Stellen im damals noch jungen Königreich Bayern innehatte. Von der einstigen Bedeutung her darf trotz gänzlich verschiedenen Wirkens ein Vergleich mit dem Literaten Maximilian Schmidt genannt Waldschmidt gewagt werden. Dazu folgende Ausführungen:
Im Archiv des Marktes Eschlkam befindet sich eine Menge sorgsam gebundener Hefte mit kartonierten blauen Umschlag die den Titel tragen: „Staatsrat v. Ritter’sche Stiftungs-Rechnung Eschlkam“. In all diesen Rechnungsbüchern ist jeweils einleitend folgende Erklärung niedergeschrieben: „Vorbericht - Der kgl. Staatsrat und Oberappellationsgerichts-Präsident Andreas v. Ritter hat durch Testament v. 29. Mai 1831 der Schule Eschlkam ein Legat von 1000 Gulden = 1714 M 28 & zu dem Zwecke vermacht, daß aus den Kapitalzinsen für die Schulkinder dürftiger Eltern die erforderlichen Schulbücher u. andere Requisiten, dann zur Winterszeit Schuhe u. Strümpfe angeschafft werden sollen“. Dazu sei vorerst erläutert: Das „Oberappellationsgericht“ war seit 1815 in Bayern das höchste Rechtsprechungsorgan und so auch in Streitfällen die letzte Berufungsinstanz.
Aus diesen wenigen Zeilen erfahren wir, dass eine Persönlichkeit, die auf juristischer Ebene im damaligen Königreich – wir schreiben das Jahr 1831 – als der höchste juristische Beamte in der Regierungszeit König Maximilian I. Joseph (1806-1825) und noch bei dessen Nachfolger König Ludwig I. (1825-1848) der Schule in Eschlkam ein Legat (Vermächtnis) zukommen ließ, verbunden mit dem konkreten Auftrag, das vorgegebene Schulwesen im Markte alljährlich finanziell zu unterstützen.
Eine familiäre Suche
Es erhebt sich die Frage, was motivierte den hohen Staatsbeamten, der doch seinen Wohnsitz berufsbedingt über Jahrzehnte in München hatte, in sein Testament die Schule von Eschlkam miteinzubeziehen? Was verband ihn mit Eschlkam? Eine Familie Ritter kann unter den Hausbesitzern des Marktes im 18. und 19. Jahrhundert nicht ausgemacht werden. Fündig aber werden wir bei einzelnen Bediensteten der Kirche. So informiert das Sterbebuch der Pfarrei, dass am 2. Januar 1782 der Chorregent und Organist Andreas Ritter, Sohn des Schulmeisters und Mesners Gregor Ritter aus Eslarn, im Alter von 54 Jahren verstorben ist. Die weitere Recherche ergab, dass Ritter bereits im Jahr 1750 von Eslarn aus in den Markt zugezogen war und im gleichen Jahr am 23. November die am Ort ansässige Organistenwitwe Katharina Schmid, eine geb. Hitzinger heiratete. Damit erhielt er die begehrte Stelle, denn ein Organist war nach Abgang des Vorgängers für die feierlichen Gottesdienste dringend nötig geworden und deshalb auch rasch zu finden. Diese erste Frau Katharina starb am 14. Juni 1762 im Alter von 44 Jahren. Organist Ritter verehelichte sich am 8. Februar 1763 ein weiteres Mal mit Margarethe Wittmann. Der Eintrag im Ehematrikel der Pfarrei Eschlkam lautet verkürzt: „Honestus viduus (der ehrengeachtete Witwer) Andreas Ritter, organieus (Organist) et pudica (und die sittsame Jungfrau) Margarethe (Tochter des) Johann Georg Wittmann, plumbisutoris (Bleigießer ?) et Margaretha uxoris eius (und seiner Gemahlin) aus Lohberg“ schlossen die Ehe. Beiden wurde vier Jahre später am 13. Januar 1767 in Eschlkam der Sohn Andreas geboren, der spätere Staatsrat und Gerichtspräsident. Dazu der Eintrag im Taufbuch: R(everendus-der ehrwürdige). D(ominus-Herr) Wittmann, coop.(Kooperator, spendete das Sakrament der Taufe dem) Andreas leg(itimus-ehelicher Sohn des) Andreas Ritter, organieus hic (Organist am Ort) et (und der) Margaretha, nata Wittmannin (geb. Wittmann) pl(umbisutoris): Lamb (von Lam). Patrinus (Taufpate war): D(ominus – Herr) Stephan Hastreither sutor (Schuster) et consul emerit(us) hic (ehemaliger Ratsherr am Ort; zeitweise war er auch Bürgermeister – damals wohnhaft in HsNr. 36/Marktstraße 9).
Wohnung im „Kobel“
Die Mutter Margarethe segnete das Zeitliche am 8. Januar 1802. Für das Jahr 1819 kann aus den Protokollen des Marktes eine Margarethe Ritter als Organistin ausgemacht werden. Sie starb am 14. Oktober 1841. Ihre Wohnung hatte sie im sog. Kobel oberhalb des alten Toreingangs in den Friedhof – ein sehr bescheidener und engfängiger Wohnbereich, über lange Zeit stets bereitgestellt für die jeweiligen „Diskantisten“ (die alte Bezeichnung für Organist). Dort dürfte auch der junge Andreas seine Kindheit verbracht haben.
In Eschlkam erfuhr der junge Andreas die erste schulische Ausbildung, wurde dann – wie damals üblich – aufgrund seiner Begabung an ein klösterliches Gymnasium gegeben, vielleicht nach Gotteszell, Metten oder Niederaltaich. Nach erfolgreichen Abschluss hatte Andreas Ritter Jura studiert, die juristische Laufbahn eingeschlagen, wobei er – wie der Vorbericht aussagt – beruflich eine der höchsten Stellen im damaligen bayerischen Staate erlangte. Für seine Verdienste, erworben während seines erfolgreichen Berufslebens, wurde er als Staatsrat und Präsident des höchsten Gerichts von König Maximilian I. Joseph am 21. August 1813 in den Adelsstand erhoben.
So gesehen hatte der „Waldlerbub“ aus dem Hohenbogen-Winkel eine erstaunliche Karriere hingelegt. Aus den Protokollen des Bayerischen Staatsrates erfahren wir zusammengefasst einzelne berufliche Stationen Ritters: „1802 Landesdirektionsrat in München; 1808 Oberfinanzrat bei der Ministerialsektion der Steuer und Domänen; 1809 Finanzfachmann bei der Hofkommission für Tirol; 1813 geadelt (von König Maximilian I. Joseph); gestorben 1832“. Eine weitere Quelle informiert ähnlich über Staatsrat Ritter. Demnach fungierte er u.a. wie oben als „Oberfinanzrat , dann als Vorstand des Kgl. Generalfiskalrats und des Obersten Lehenshofes. Er nahm ebenso im Verein mit dem damaligen Finanzminister (Emanuel Maximilian von)Lerchenfeld und Justizminister (Georg Friedrich von) Zentner an allen Sitzungen teil; geb. 1766/67 (aus Altbayern )“. Das genaue Geburtsdatum war dem Verfasser dieser Quelle offenbar nicht bekannt.
Seine Herkunft nicht vergessen
Trotz dieses überaus bedeutenden Werdegangs hat Andreas von Ritter seine Heimat Eschlkam und die dort verbrachte Kindheit nicht vergessen. Wohlwissend um die schulischen Belange im Bayern des frühen 19. Jahrhunderts, gründete er, mittlerweile 64 Jahre alt, auf der Basis einer testamentarischen Verfügung eine Stiftung zur Hebung des Schulwesens im Markte Eschlkam. Als „Freiherr von Ritter“, so der Titel nach der Adelung, hatte er, mittlerweile war ihm unter König Ludwig I. zusätzlich noch der Titel „Geheimer Rat“ verliehen worden, im gleichen Jahr wohl wegen körperlichen Befindens ein Gesuch um die Entlassung aus dem Staatsdienste eingereicht.
Ein Jahr später verstarb Andreas von Ritter. Überliefert ist die Todesanzeige: „Im ruhigen Frieden und dem göttlichen Willen innigst ergeben, entschlief heute den 28. April 1832 um halb 7 Uhr abends, nach Empfang der heiligen Sterbesakramente, der k(öniglich). b(ayerische). Staatsrath und Präsident des obersten Gerichtshofes in Bayern, Kommandeur des Civil-Verdienst-Ordens, Andreas von Ritter, in seinem 66sten Lebensjahre.“ Seine Grabstelle ist noch unbekannt.
Werner Perlinger
Die Schule in Eschlkam wurde einst mit Stiftungsgeldern unterstützt
+Eschlkam. Im Archiv des Marktes Eschlkam befindet sich geordnet nach Jahren eine größere Menge sorgsam gebundener Hefte mit kartoniertem Umschlag die den Titel tragen: Staatsrat v. Ritter’sche Stiftungs-Rechnung Eschlkam“. Aus diesen Unterlagen erfahren wir, dass eine Persönlichkeit, die auf juristischer Ebene im bayerischen Staate – wir schreiben das Jahr 1831 – als wohl höchster juristischer Beamter in den Regierungszeiten von König Maximilian I. Joseph (1806-1825) und König Ludwig I. (1825-1848) der Schule in Eschlkam ein Legat (Vermächtnis) zukommen ließ, verbunden mit dem konkreten Auftrag, das vorgegebene Schulwesen im Markte alljährlich finanziell zu unterstützen. Schließlich war knapp 30 Jahre vorher am 23. Dezember 1802 durch Verordnung des Kurfürsten Max IV. Josef in Bayern die >Allgemeine Schulpflicht< für Kinder vom 6. bis 12. Lebensjahr eingeführt worden, was die Bedeutung und die Entwicklung des Schulwesens gerade auf dem Lande entscheidend anhob und daher auch mehr an finanzieller Unterstützung benötigt wurde als vorher.
In Eschlkam aufgewachsen
Unwillkürlich erhebt sich dabei die Frage, was motivierte den hohen Staatsbeamten, der seinen Wohnsitz berufsbedingt über Jahrzehnte in München hatte, in sein Testament eigens die Schule von Eschlkam miteinzubeziehen. Der Grund dafür ist, dass Andreas von Ritter am 13. Januar 1767 in Eschlkam als Sohn des Organisten Andreas Ritter geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Für seine Verdienste, die er sich während seines erfolgreichen Berufslebens erworben hatte, wurde er als Staatsrat und Präsident des höchsten Gerichts – in Würdigung seiner beruflichen Leistungen für den Staat – noch von König Maximilian I. Joseph bereits im Jahr 1813 in den Adelsstand erhoben. Wohlwissend um die schulischen Belange im Bayern des frühen 19. Jahrhunderts, gründete er im Jahr 1831 eine Stiftung zur Hebung des Schulwesens im Markte Eschlkam, dem Ort seiner Heimat, seiner Jugend.
Zinsen für Ausgaben genutzt
Wir wollen wir einen Blick in das Rechnungsbuch der Stiftung vom Jahr 1901 werfen: So war das Stiftungsgeld bei der bayerischen Hypotheken- und Wechselbank auf der Basis von Pfandbriefen deponiert. Im Jahr 1901 z. B. betrug die Summe aller daraus zinsbedingt fließenden Einnahmen 193 Mark. Ausgaben wurden getätigt in Höhe von 99 Mark für Schulbücher, Schreibmaterialien und 1 Paar Schuhe. Einzelne Ausgaben seien in Folge aufgeführt: Bei dem Händler Peter Seiderer („beim Dörflschneider“ - damals in Nr. 73, an der westlichen Kirchhofmauer neben dem Treppenaufgang gelegen - das Haus existiert nicht mehr) kauften für die bedürftigen Schüler den jeweils nötigen Schulbedarf die an den Schulen in Eschlkam, Stachesried und Schwarzenberg tätigen Lehrkräfte selbst und überließen dies nicht den Schülern oder deren Eltern. Die Namen der aufgeführten Lehrer nennt das Rechnungsbuch nicht.
Detaillierte Rechnung vorgelegt
Wie die Rechnungsaufstellung zeigt, wurde im Jahr 1901 nur in den Monaten Mai, Juni Juli, Oktober, November und Dezember der Schulbedarf eingekauft. Meist waren es religiöse Bücher wie das Alte Testament, Katechismen, „Schiffertafeln“ (Schiefertafel), eine größere Menge Schreibgriffel, Rechnungshefte, Wolle zum Stricken, verschiedene Hefte mit und ohne Umschlag, Lehrbücher, Fibeln und anderes mehr. Auf das Jahr gerechnet erhielt der Händler Seiderer für den gelieferten Schulbedarf 80,17 Mark aus der Stiftungskasse. Die alle angekauften Lehrmittel umfassende Rechnung war von Seiderer am 31. Dezember 1901 ausgestellt und sogleich auch von der Stiftungsverwaltung, an deren Spitze stand kraft Amtes Bürgermeister Hastreiter, von diesem per Unterschrift und versehen mit dem Siegel des Marktes bestätigt und schließlich bar beglichen worden. Der Schuhmacher Georg Rötzer (damals in Nr.72/Marktstraße 13) erhielt für das Paar Schuhe, das er für die Polizeidienerstochter Maria Späth gefertigt hatte, 5.40 Mark aus der Stiftungskasse. Rechnungsführer in diesem Jahr war der Bürger Franz Stauber (Nr. 59/Marktstraße 13 – „beim Uhrmocha“). Der Buchbinder Eduard Strasser aus der Stadt Furth erhielt für 40 Wandbilder, eigens auf Leinwand aufgezogen, 14 Mark. Diese großformatigen Bilder, vor Jahrzehnten an Schulen noch üblich und in Gebrauch, wurden vor allem in den Lehrbereichen Geschichte, Biologie oder Erdkunde verwendet. Der Hauptlehrer Joseph Kumpfmüller von der Schule in Schwarzenberg wurde für die Erstellung der Rechnung des Vorjahres (1900) mit 3 Mark abgefunden. Dieser Lehrer, lange Zeit auch als Gemeindeschreiber von Schwarzenberg tätig, war der Vater des späteren Bischofs von Augsburg, Dr. theol. Joseph Kumpfmüller (1869-1949). Den Stiftungsverwaltungsrat bildeten im Jahr 1901 Bürgermeister Hastreiter, Franz Stauber als Kassier und Rechnungsführer und der Bürger und Schuhmacher Georg Rötzer.
Letztlich standen den Zinseinnahmen von 193 Mark 102 Mark an Ausgaben gegenüber, so dass ein Aktivrest von 91 Mark in der Stiftung verblieb. Der Bestand an Aktivkapital betrug nach wie vor ungeschmälert 1720 Mark, eben die vor der Einführung der Mark im Jahr 1831 gestifteten 1000 Gulden. Infolge der Hyperinflation im Jahre 1923 gingen jedoch sämtliche Stiftungen im weltlichen und auch im kirchlichen Bereich wie dort die nicht wenigen Stiftungen von Jahrtagen gänzlich verloren, so dass heute nach 100 Jahren der Stifter Andreas von Ritter in seinem Geburtsort Eschlkam nicht mehr in Erinnerung ist und in Vergessenheit geriet. Dennoch soll diese Persönlichkeit, der die Schulen im Gemeindebereich von Eschlkam viel zu verdanken haben, demnächst der Öffentlichkeit eigens vorgestellt werden.
Werner Perlinger
Schläge gegen einen Beamten kamen teuer zu stehen
+Eschlkam. „Polizeiliche Untersuchung gegen den Gerichtsdiener-Gehilfen Wührer von Kötzting wegen Beschimpfung“, titelt ein Akt aus dem Jahreszyklus 1848/49. Dazu existiert ein Protokoll, das der damalige Bürgermeister Saemmer von Eschlkam am 27. Dezember 1848 anfertigen ließ. Daraus geht hervor, dass einige Tage vorher, am 22. Dezember der „Gerichtsdienergehilfe“ Wührer wegen Beschimpfung und Mißhandlung durch den Müller Jakob Maurer und Polizeidiener Pinzinger von dem königl. Landgerichte Kötzting hierher gesendet wurde, ließ man „die so Angeführten heute zur Vernehmung auf das Rathaus zitieren“.
Als erster erklärte der Müller Maurer, am 12. Dezember habe er sich bei Gastwirt Lemberger (damals Nr. Nr. 37/38; jetzt Marktstraße 11) aufgehalten wo auch Wührer und Pinzinger zugegen waren. Beide hätten gestritten. „Und als ich mich dareinlegte und sie mit den übrigen Gästen zur Ruhe aufforderte“, habe ihn Wührer beschimpft, ihn einen „dummen Bauren“ geheißen, „worauf ich ihn, da ich betrunken war und sohin durch diese Beschimpfung in Zorn geriehth, ins Gesicht schlug. Der Streit war damit aus“, so der Müller Maurer, damals Inhaber der Jakobsmühle, vulgo „Gaglmühl“. Auf die Frage, ob er den Wührer beschimpft habe, konnte der Müller keine Antwort geben, da er, so seine Aussage „an diesem Abend stark betrunken war; wenn ich ihn übrigens beschimpft haben sollte, so widerrufe ich dies hiermit und erkläre den Wührer als einen rechtschaffenen Mann“.
Aussage des Polizeidieners Pinzinger
Dieser erklärte er sei an dem 12. Dezember im Gasthaus des Lemberger gewesen, „wohin auch Wührer in schon betrunkenem Zustande abends nach 8 Uhr kam“. In einem Gespräch über verschiedene Dinge habe er ihn auch gefragt, warum er denn bei seinem Bruder, dem Wirtschaftspächter Johann Pinzinger dahier nicht mehr einkehre“. Wührer habe geantwortet, dass er nie mehr dort einkehren oder übernachten werde, weil er von meinem Bruder „zu stark in der Zeche schon übernommen worden sei“. Pinzinger gab zu, dass ihn diese Aussage geärgert habe und er habe geantwortet, „daß dies nicht wahr sein könne, da solches meines Bruders Sache nicht ist“. Zudem bat Wührer den Pinzinger, er solle für ihn ein Circular (Amtsschreiben als Rundbrief) wegen der am 14. Dezember, also in zwei Tagen stattfindenden „Armensitzung“ (des Armenpflegschaftsrates) nach Neukirchen und Rittsteig tragen, da er sich „schon zu lange aufgehalten habe“, Pinzinger lehnte ab mit den Worten „er sei nicht schuldig, seinen Bedienten zu machen. Er solle seine Geschäfte besorgen wie es sich gehöre“. Daraufhin „warf sich der Gerichtsdienergehilfe in die Brust und rief mir entgegen, ich müsse tun, was er mir schaffe, ich müsse alle Signaturen den betreffenden Gemeinden in der Nähe Eschlkams zustellen“.
Als sich der Wortwechsel zwischen beiden steigerte, habe der Müller Maurer zugerufen „wir sollen mit unserem Streite ruhig sein“. Wührer schimpfte daraufhin den Müller „einen dummen Bauern, der besser thäte, er vertränke sein Geld, als daß er es verstreite“. Müller Maurer, ohnehin stark betrunken, gefiel das nicht und er habe den „Wührer ins Geschicht geschlagen“.
Maurer schimpfte noch weiter. Pinzinger und Wührer gingen gemeinsam weg. Pinzinger, da es schon 10 Uhr war, nach Hause; Wührer aber suchte den Gastwirt Späth auf, wo er übernachtete.
Bürgermeister Saemmer beriet sich mit den drei dafür zuständigen Gemeinderäten, dass der „Müller Josef Maurer von der Jakobsmühle wegen thätlicher Beleidigung des Gerichtsdienergehilfen Wührer mit zwölfstündigem Polizeiarreste, der Polizeidiener Pinzinger aber und der Gerichtsdienergehilfe Wührer wegen ungebührlichen und exzessiven Betragens im Wirthshause mit Verweis zu bestrafen seien“. In der Begründung führte das Gremium aus, dass „das Benehmen des Müllers durchaus keine Rechtfertigung finden kann“, daher die Arreststrafe. Bei den beiden im öffentlichen Dienste stehenden Personen treffe „aber die Strafe des Verweises umso mehr, da sie als Diener der Polizei nach ihren Instruktionen sich benehmen und daher nicht in Wirtshäusern sich herumstreiten sollen“. Diese Entscheidungen unterschrieben neben dem Bürgermeister Saemer noch die Markträte Pfeffer, Schmirl und Andrä Pohmann. Nachdem Maurer und Pinzinger sich mit dem Urteil einverstanden erklärten, ließ man den „Gaglmüllner sogleich in die Straf (12 Stunden Arrest) abführen“.
Der Gerichtsdienergehilfe widerspricht
Wührer akzeptierte die Entscheidung des Marktgerichts nicht. Das Landgericht Kötzting, das sich als nächste Behörde mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen hatte, ließ unter Vorsitz von Landrichter von Paur am 4. Januar 1849 diese Angelegenheit zunächst protokollieren. Demnach trug der Gerichtsdienergehilfe Jakob Wührer vor, „ich habe am 2. Januar ein Dekret des Magistrats von Eschlkam erhalten, nämlich in Abschrift einen Beschluss der Polizei vom 30. Dezember des Vorjahres, woraus ich ersehe, dass ich vom Magistrate mit der Strafe des Verweises angesehen wurde und 39 ½ Kreuzer Taxe sowie die Kosten der Polizeiverhandlung zu bezahlen habe“. Wührer wolle sich diesen „Beschluß nicht gefallen lassen, denn er leidet an unheilbarer Nichtigkeit“. Es sei ihm eine Anhörung vor Gericht verweigert worden. Wührer bekräftigt seine Einlassungen mit den Hinweisen, aus dem „Tenor des Strafbeschlußes ist gar nicht ersichtlich warum ich bestraft werden solle“. Außerdem mangle es der ausstellenden Behörde, hier dem Magistrate Eschlkam an „Competenz“ (hier: Zuständigkeit). Mittlerweile hatte Wührer seinen Dienstort gewechselt. Er befand sich nun beim Landgericht Nittenau. Wie die Angelegenheit letztlich ausging geht aus der Aktenlage nicht hervor.
Werner Perlinger
Unsere Heimat im Österreichischen Erbfolgekrieg - aus einem Rechnungsbuch
+Eschlkam. In den Jahren 1741 bis 1748 entstand aus der Anfechtung der Pragmatischen Sanktion nach dem Tode von Kaiser Karl VI. im Oktober 1740 durch den bayerischen Kurfürsten Karl Albert (1726-1745) aus dem Hause Wittelsbach, der selbst die Nachfolge im Deutschen Reich und in Österreich antreten wollte, der österreichische Erbfolgekrieg. Die Pragmatische Sanktion, verfasst von Kaiser Karl VI. bereits im Jahr 1713, hatte die Unteilbarkeit des Hauses Habsburg und auch die Monarchie für die weibliche Thronfolge, hier seiner Tochter Maria Theresia, in Österreich zum Inhalt. Karl Albert wurde dennoch am 12. Februar 1742 unter größter Prunkentfaltung zum Kaiser gewählt. Er regierte aber nur bis 1745. Maria Theresia aber gab gegen Bayern nicht nach und ließ den Feldmarschall Khevenhüller mit einer Armee in Bayern einmarschieren. Der Österreichische Erbfolgekrieg war in vollem Gange. Für Bayern kamen die Pandurenjahre, für unsere Gegend Truppendurchzüge und verschiedentliche Plünderungen.
In diesem Unglücksjahr Bayerns kam, ausgeschickt von Maria Theresia, der Pandurenführer, Oberstleutnant Franz Freiherr von der Trenck in die Waldgegend und bemächtigte sich des Marktes Viechtach und der Stadt Cham. Die Stadt Furth und der Markt Eschlkam hatten kurz zuvor Teile der Registratur und manche Bürger einiges ihrer Habe nach dem damals noch stark befestigten Cham gebracht, wo sie alles in gutem Schutze glaubten; sahen sich aber bitter enttäuscht, als Trenck am 9. September Cham einnahm, größtenteils niederbrennen und drei Tage plündern ließ. Inwieweit Eschlkam Verluste an seinen Urkunden zu beklagen hatte, ist nicht bekannt.
Ganz ungeschoren sind die Stadt Furth und auch der Markt Eschlkam in diesem Krieg nicht davon gekommen. Laut Aussage der Further Stadtkammerrechnung vom Jahr 1742 mussten die Bürger unter schärfsten Androhungen gegen die Stadt durch den österreichischen Feldmarschall-Leutnant, Baron von Pernklau eine Branndtsteur oder Contribution in Höhe von 687 Gulden 30 Kreuzer zahlen und blieben nur so vor schlimmeren Unheil verschont. Das Ganze nennt man eine „Brandschatzung“, Erpressung von Geld gegen Androhung der Niederbrennung eines Ortes.
Wechselvolle Kämpfe in Böhmen und Bayern, in Oberitalien und in den Niederlanden führten 1748 schließlich zu einem Frieden, geschlossen in Aachen. Für den Hohenbogen-Winkel und seine Bewohner folgten dann glücklicherweise lange Jahre des Friedens.
Aus dieser turbulenten Zeit hat sich im Archiv des Marktes Eschlkam ein Rechnungsbuch erhalten, das den langen Titel trägt: „Extra Kriegs Rechnung welche Paul Mauser des Innern Ratsburgermaister des Kayserlichen Churbayerischen Gräniz Pannmarkts Eschlkamb wegen denen wehrenden Kriegerischen gepflogenen Einnämb- und Ausgäben ordentlich abgelegt hat, und zwar für das Jahr 1743“. Wie die Titelseite mitteilt, lenkte in dieser schwierigen Zeit als Bürgermeister die Geschicke des Marktes der Bürger Paul Mauser. In der Häuserchronik begegnet uns Mauser als Bader und Inhaber des sog. Badhauses, heute das Anwesen Kleinaignerstaße 3. Bereits im Jahr 1734 hatte der Bader Mauser das Anwesen im steuerlichen Schätzwert von 450 Gulden von seinem Vater, dem Bader Stephan Mauser übernommen. Die Badertradition reicht auf diesem Anwesen bis weit in das 17. Jahrhundert zurück. Sie endet auf diesem Haus im 19. Jahrhundert.
Das protokollarisch abgefasste Rechnungsbuch beginnt zunächst mit den Einnahmen. So wurden z.B. im Jahr 1743 vom 20. Februar bis 3. März „von der alhiesigen Burgerschaft zur Bestreitung der Kriegsausgaben 24 Gulden (f), 24 Kreuzer zusamb getragen“. In diesen zu Lasten der Bürger mehrfach stattgefundenen Sammlungen an Geldern wird von „Portionen“ gesprochen, nämlich den jeweiligen Anteil in Kreuzern, den jeder Bürger je nach wirtschaftlicher Einschätzung zu leisten hatte. Die Beträge reichen von 3 bis zu 12 und 15 Kreuzer. Letztlich konnten zur Bestreitung der Kriegskosten nach mehreren Aktionen am 5. Mai 1744 die doch beachtliche Summe von 459 Gulden 31 Kreuzer vom Markt als Einnahmen verbucht werden.
Militärs verpflegt
Einen schriftlich größeren Umfang nehmen dagegen die Ausgaben ein. Die Einträge beginnen am 9. Januar 1743 „und zwar erstlich auf Zöhrung“, d.h. es mussten Personen, in erster Linie Angehörige des Militärs wie Soldaten und Offiziere verpflegt werden, die meist als Durchreisende in den Markt gekommen waren. So waren an dem besagten 9. Januar Bürgermeister Mauser und der Bürger Lährnbecher „bey der Repartition (Verteilung) wegen Einreuthung der österreichischen Tragoner 2 Täg zu Furth“. Dabei haben beide an „Zöhrung“ (hier die Spesen) verbraucht 2 Gulden und 9 Kreuzer. Es ging den beiden Bürgern um eine passende Verteilung dieser angekommenen Dragoner („leichte Reiter“) im Bereich der Gemeinde. Deshalb sprachen sie in der Stadt wohl beim damaligen Grenzhauptmann Maximilian Anton von Walser zu Syrenburg vor, der militärisch für den Hohenbogen-Winkel zuständig war.
Etwa einen Monat später übernachtete am 2. Februar ein „VeldtPater des Brückenfeldschen Regiments“ bei Paul Mauser selbst. Den Geistlichen begleiteten zwei Diener. Zusätzlich mussten die drei Pferde der Gruppe mitversorgt werden, so dass an Verpflegungskosten mehr als 1 Gulden angefallen waren. Wenige Tage später, am 13. Februar gab man an „7 Courasier Reiter des Santionischen Regiments Brodt, Bier und Brandtwein zur Zöhrung“. Der „Kürass“ bedeutete den „Brustharnisch“, in älterer Zeit häufig die Bezeichnung für einen aus Brust- und Rückenteil bestehenden Panzer (mit zugehörigem Helm), auch für die den ganzen Körper schützende Rüstung. Die Kürassiere wurden im Gegensatz zu den Dragonern auch als „schwere Reiter“ benannt. Diese hier aufgeführten Einnahmen und Ausgaben seien nur als ein kleiner Teil von vielen der im Rechnungsbuch notierten einzelnen Posten vorgestellt. Im Endeffekt überstiegen die Ausgaben die anfänglich verzeichneten Einnahmen um 14 Gulden 19 Kreuzer, die letztlich die Kommunalkasse Eschlkams zu tragen hatte.
Werner Perlinger
Aus einem alten Sitzungsbuch des Marktrates von 1789
+Eschlkam. Im Archiv des Marktes, wohlgeordnet sich dem forschenden Besucher anbietend, finden sich unter den älteren Vorgängen neben den Kammerrechnungen auch Rats- und Verhörsprotokolle. Ein reichhaltiger Fundus, der uns teils sehr anschaulich das Leben der Bürger im Markt in den letzten 300 Jahren vor Augen führt.
Ein Marktrichter (später als Bürgermeister bezeichnet) hatte die niedere Gerichtsbarkeit auszuüben im Verein mit vier „Geschworenen“, den aus der Bürgerschaft zu wählenden Markträten. Die niedere Gerichtsbarkeit erstreckte sich auf die Bewohner des Marktes und ihren „Ehehalten“ (Knechte und Mägde). Auswärtige Personen unterstanden dem Pfleggericht.
Ausgeschlossen war grundsätzlich die Ausübung der höheren Gerichtsbarkeit. Im Strafrecht betraf sie die drei Delikte, die die Todesstrafe nach sich zogen, wie Mord, Notzucht und schwerer Diebstahl, hier der Straßen- und Kirchenraub.
Es seien – wie in einzelnen Veröffentlichungen schon geschehen - Inhalte nun aus dem Ratsprotokoll vom Jahr 1789 vorgestellt. Dieses Datum hat andererseits eine große politische Bedeutung, denn in diesem Jahr begann in Frankreich die große Revolution, die auf künftige politische und vor allem soziale Entwicklungen in ganz Europa und bis in die Kolonien in Übersee einen großen Einfluss nahm. Berührt haben diese Vorgänge das Alltagsleben der Marktbürger zunächst nicht.
Streit der Müller ums Wasser
Aber gerade aus dem Ratsprotokoll des Revolutionsjahres seien einige Inhalte vorgestellt, um so in die Lebensverhältnisse der Marktbürger und ihre Alltagsprobleme vor mehr als 230 Jahren einen Einblick zu erhalten. In der ersten Ratssitzung vom 23. Januar werden wir über einen Streit zwischen zwei Müllern informiert: So klagt Andre Penzkofer, bürgerlicher Müller auf der „sogenannten Penzmill allhier“ gegen seinen Berufskollegen Andre Maurer, „Kloster Selingthaller Unterthan auf der Gaglmill (Jakobsmühle)“ wie folgt. Der Klageinhalt ist offenbar seiner Bedeutung wegen in lateinischer Sprache abgefasst, nämlich „ne quid in flumine Publice, ripea eijus fiat, quo minus aqua aliliter fluat, quam prius fluxerit…dass im öffentlichen Fluss, entsprechend dem Uferverlauf, wo (nun) weniger Wasser fließe als vorher. “ Gemeint ist damit der Freibach, an dem beide Mühlen liegen, wobei die Mühle des Maurer nicht zum Markte sondern zur klösterlichen Hofmark Seligenthal gehört. Es wird von einem „höchst widerrechtlichen Attentatum respective Spolium“ des Gaglmüllers gesprochen, von einem Attentat bzw. von Raub. Was war geschehen: Vor Wochen „erfrechte sich der Beklagte das Höllbreth des Klägers zu dessen größten Nachtheile in der hiesigen Marktsjurisdiction eigenmächtig einzuhauen, ja erst vor einigen Tagen völlig herauszureißen.“ Demnach hatte der Müller Maurer, wahrscheinlich um mehr Wasser für den Antrieb seines Mühlrades zu erhalten, den sog. „Fall“, womit ein entsprechender Teil an Bachwasser für die nördlich von der Jakobsmühle gelegene Penzenmühle - vertraglich bereits seit 1745 vereinbart – abgezweigt. Der Tatbestand der „Spolien“ (hier des Wasserraubes) lag nun klar auf der Hand. Dem Müller Maurer wurde aufgetragen, „daß er das eigenmächtig eingehauene Wasser abfahl sogleich in vorigen Stand herzustellen und den Kläger entschädigt zu halten“. Außerdem musste er die Gerichtskosten „alleinig“ tragen.
Am 31. März hatte sich das Marktgericht mit einem weiteren, eigentlich heiklen Fall zu befassen. Franz Anton Schmirl, „resignierter Bürgermeister und Inhaber einer burgerlichen Behausuung“, klagte gegen Joseph Weber, „burgerlichen Gastgeb als seinen Schwiegersohn“, dass dieser ihm „nicht nur die stipulierte (vertraglich abgemachte) und schon lange verfallene Ausnahm zu 130 Gulden nicht bezahlet, sondern auch das gewöhnliche (hier: vertraglich vereinbarte) Austragsschmalz nicht anbehendigt“ habe. Auch habe Weber ihm noch nicht die vereinbarten 265 Gulden gezahlt, die ihm bei „Erkaufung seiner dermalig besitzenden Behausung“ zugesagt waren.
Dazu folgende Erläuterung: Schmirl hatte sein ursprüngliches Anwesen (Hsnr. 1/Waldschmiststr. 14 – heute Gasthof Penzkofer) bereits im Mai 1776 an seine Tochter Maria Anna und ihrem Ehemann Joseph Weber Sohn des Wolfgang Weber, „gewesten Bauren am Sternberg“, übergeben. 1786 war die Tochter von Schmirl gestorben. Weber heiratete 1787 als „burgerlicher Gastgeb u. Inhaber eines Haimetguts (Hoamaterhof)“ erneut. Im gleichen Jahr kaufte Schmirl als „freiresignierender Bürgermeister und Austragsnießer“ für sich als sog. Ruhesitz das „Häusl am Schloßgraben“, heute Marktstraße 12 (Rötzer). Der Kaufpreis betrug 512 Gulden. Umso mehr ist es verständlich, dass Schmirl auf die ausstehenden Geldzahlungen dringlich angewiesen war.
In rechtlicher Würdigung kam das Marktgericht zu dem Schluss, dass Weber „in der stipulierten (vertraglich vereinbarten) Zeit in allem vollkommene Richtigkeit herstellen solle“. Weber musste seine einst gemachten finanziellen Zusagen gegenüber seinem Schwiegervater erfüllen.
Noch am gleichen Tag klagte Bartlmä Leutermann, nunmehr Bauer in Kleinaign, gegen Catharina Spathin (damals die weibliche Form von Späth), burgerliche Beisitzers tochter allhier“, wegen Beleidigung: Als er nämlich noch vor seiner Hochzeitsfeier zum Hochzeitslader gegangen sei, habe er „bei der Späthin aufenthaltsort vorbeigehen müssen“. Dabei habe sie ihn als einen „Schelm und Hurentreiber“ beleidigt. Im Mittelalter und noch im 18. Jahrhundert stand das Wort >Schelm< für eine schwere Beleidigung; heute bedeutet diese Bezeichnung einen Witzbold oder Spaßvogel. Dem Kläger müsse, so das Gericht, „derlei Iniurien“ (Beleidigungen) nicht erdulden. Die Späth gab ihre Äußerungen unumwunden zu, glaubte aber nicht Unrecht getan zu haben, „weil er der Kläger ihr Schelm (hier der Erzeuger) zu ihrem unehelich erworbenen Kinde ist“. Das Gericht beurteilte die Beleidigung, auch wenn er der Vater des Kindes sein sollte, trotzdem als nicht zulässig, traf jedoch kein endgültiges Urteil und verwies zur endgültigen Entscheidung die Angelegenheit an das Pfleggericht in Neukirchen b. Hl. Blut.
Werner Perlinger
Mit dem Lokalmalz- und Bieraufschlag die Wasserleitung finanziert
+Eschlkam. Das allseits beliebte Bier ist ein alkoholhaltiges Getränk, angereichert mit Kohlensäure. Es wird aus Hopfen, Malz, Wasser, mit Hefe vergoren und nach den Vorschriften des Reinheitsgebotes hergestellt. Der Brauprozess selbst verläuft in vier Phasen: Am Anfang steht die Malzbereitung. Es folgen dann das Maischen oder die Bereitung der Bierwürze, die Gärung der Würze und schließlich die Aufbewahrung und Pflege des Bieres. In frühen Zeiten hat die Hausfrau auf dem heimischen Herd in regelmäßigen Abständen das Bier noch ohne Hopfen nur für den kleinen, begrenzten, häuslichen Bedarf hergestellt. Den Beruf eines Brauers gab es im Mittelalter noch nicht. Erst im 13./14. Jahrhundert habe sich dieser langsam entwickelt.
Das Brauen von Bier hat in unserem Markt eine althergebrachte Tradition. Demnach wurde, wie im letzten Artikel schon erörtert, in Eschlkam als Sitz eines Gerichtes der bayerischen Herzöge sehr wahrscheinlich noch im 13., nachweislich aber bereits im frühen 14. Jahrhundert Bier gesotten und vertrieben. Es dürfte dies im Winkel hinter dem Hohen Bogen, dem damals eigentlichen Gerichtsbezirk, die einzige Braustätte gewesen sein.
Im Gegensatz zu den anderen Orten im Winkel hinter dem Hohen Bogen besaß der Markt bereits zu Anfang des 14. Jahrhunderts ein eigenes Brauhaus, da nach Inhalt des oben genannten niederbayerischen Güterverzeichnis für die Erzeugung und den Verschleiß von Bier eine Steuerabgabe zu entrichten war. Es darf aber angenommen werden, dass diese Einrichtung in den Hussitenkriegen bei Zerstörung des Marktes und während der unmittelbar darauf folgenden Adelsfehden zwischen Bayern und Böhmen gänzlich zum Erliegen gekommen ist und erst viel später wiederbelebt werden konnte. Brauberechtigt waren sämtliche Bürger des Marktes (Einzugsbereich der Gemeinde). In der Regel waren dies 61 hausbesitzende Bürger. Je nachdem wie in den einzelnen Zeitläufen die wirtschaftliche Lage war, konnte jeweils ein oft nur geringer Teil der Bürger im Brauhaus ihre sog. Suden herstellen lassen.
Bau der Wasserleitung
Immer wieder war über die Zeiten hinweg die Versorgung mit gutem Trinkwasser ein Problem für die Bewohner der Bergsiedlung. Oft versiegten in trockenen Zeiten die bei den einzelnen Anwesen und auch im Markte vorhandenen Brunnen. Nach vielen Initiativen in den Zeiten vorher konnte schließlich im Jahr 1898 eine moderne, leistungsfähige Wasserleitung gebaut werden. Diese für den Markt sehr aufwendige Maßnahme musste erst einmal finanziert werden. Da kam die Marktführung auf die Idee dieses finanzielle Problem durch „die Erhebung des Lokalmalz- und Bieraufschlages“, allgemein bezeichnet als der „gemeine Bierpfennig“, zu lösen. Dies zu bewerkstelligen war jedoch eine staatliche Genehmigung von Nöten. Die Eschlkamer brachten ihr Anliegen höheren Orts vor und am 20. April 1901 antwortete aus München, dem damaligen Regierungssitz des bayerischen Königshauses, das Staatsministerium des Innern wie folgt:
Im Namen seiner Majestät des Königs; seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser (seit dem Tode von König Ludwig II. im Jahr 1886), haben der Marktgemeinde Eschlkam, K(önigliches) Bezirksamts Kötzting, auf Grund der Beschlüsse des Gemeindeausschusses und der Gemeindeversammlung vom 18. Februar und 18. März 1900 zur Verzinsung und Tilgung der Wasserleitungsbauschuld von 33.810 Mark die Erhebung des Lokalmalz- und Bieraufschlages mit 1 Mark vom Hektoliter Malz, dann mit 60 & (Pfennige) vom Hektoliter (3 & von je 5 Litern) eingeführten Bieres vom 1. Mai 1901 an vorerst bis zum 1. Mai 1911 allerhuldvollst zu bewilligen geruht.
Widerstand war vorgegeben
Den Einwendungen betheiligter Gewerbsinteressenten konnte hinreichender Grund zur abschlägigen Verbescheidung des gemeindlichen Gesuches nicht entnommen werden. Etwaige besondere Ansprüche, welche diesselben aus den gemeindlichen Beschlüssen vom 20. Januar und 3. Februar 1898 ableiten zu können glauben, sind denselben zur Austragung vorbehalten…“. gez(eichnet) Frhr. von Feilitzsch. Maximilian; Graf von Feilitzsch war damals bayerischer Innenminister. In München wurden ihm zu Ehren eine Straße und auch ein Platz, heute benannt als „die Münchner Freiheit“, gewidmet.
Dagegen regte sich unter den Eschlkamer Wirten natürlich Widerstand. Aber dieser wurde abgewiesen. Vielmehr erging einige Tage später, am 23. April, vom Bezirksamt (Vorläufer des Landratsamtes) Kötzting die Aufforderung, wegen dieser „Gefällserhebung (Steuer) sofort mit dem Hauptzollamte Furth ins Benehmen zu treten“. Angewiesen wurde die Marktführung auch die nun nötige „Lokalmalzaufschlagskasse gesondert zu führen und zu verwalten“. Auch wurde gefordert für die gesamte Maßnahme unbedingt eine „ortspolizeiliche Vorschrift zur Sicherung der Gefällserhebung“ zu erlassen.
Im Marktarchiv erhalten haben sich demzufolge auch mehrere „Bieraufschlagsregister“, die sich von ihren Inhalten her gleichen. Diese Register betreffen aber nur die Steuer auf das „Quantum des eingeführten Bieres“. Verzeichnet sind immer die gleichen Namen der Wirte, die auswärtiges Bier den Gästen anboten. Im Jahr 1902 beispielsweise entrichteten über das Jahr verteilt diese neue Steuer Joseph Lackerbauer (Nr. 25/Waldschmidtplatz 8), Xaver Späth (Nr. 5/Further Straße 3), Joseph Helmbrecht (Nr. 21/existiert nicht mehr). Im Jahr darauf, 1903, kamen Ludwig Seidl (Nr. 35/Marktstraße 7) und Egid Hunger (Nr. 11/ Kleinaigner Straße 9 hinzu. Führer des Kassenbuches war der Bürger Rötzer.
Werner Perlinger
Die Stärke des Bieres wurde brauenden Bürgern staatlich vorgeschrieben
+Eschlkam. Zunächst einführend allgemeine Erklärungen zum Brauwesen im Markte Eschlkam:
Das Brauen von Bier hat im Markt Eschlkam eine althergebrachte Tradition. Demnach wurde in Eschlkam als Sitz eines Gerichtes der bayerischen Herzöge sehr wahrscheinlich noch im 13., nachweislich aber bereits im frühen 14. Jahrhundert, Bier gesotten und vertrieben. Es dürfte dies im Winkel hinter dem Hohenbogen, dem damals eigentlichen Gerichtsbezirk, die einzige Braustätte gewesen sein. Nächste Braustätten für diese Zeit finden sich erst wieder in Cham und Kötzting. Das war an sich nicht selbstverständlich, gehörte doch das Brauwesen zu jener Zeit zu den noch jungen Gewerben in Bayern. Noch bis in das 16. Jahrhundert hinein galt hier im Lande - man höre und staune - der sog. Landwein als erstes Volksgetränk.
Aber gerade die große Entfernung von den Zentren des damaligen bayerischen Landes, den damit verbundenen hohen Transportkosten und vor allem ein Klima, das im Gegensatz zu den Regionen an der Donau den Weinbau bei uns unmöglich machte, war mit der ausschlaggebende Grund, dass allein schon deshalb auf die Produktion von Bier ausgewichen werden musste. Somit wurde das Bier im Hohenbogen-Winkel schon sehr früh zum beliebten Volksgetränk.
Bis in die neuere Zeit herein gab es für die Marktbürger das Kommunbrauhaus, gelegen an der Westflanke des Berges unmittelbar gegenüber dem späteren Gasthaus Späth/Binder und hinter dem „Bruihausschreiner“ Wanninger. Es hatte einst die Hausnummer 14. Im Plan der Erstvermessung des Marktes vom Jahr 1831 sind sein Standort und seine Dimension im Grundriss eingezeichnet. Nach dem gänzlichen Niedergang des kommunalen Brauwesens wurde es noch vor 1931 ersatzlos abgebrochen.
Wie Unterlagen uns mehrmals berichten, konnten in diesem Brauhaus an die 61 brauberechtigte Bürger das Jahr über ihre „Suden“ von einem eigens dafür angestellten Braumeister herstellen lassen. Wie anderorts auch blieb die Zahl der brauberechtigten Bürger meist konstant. Die Zahl der Suden, auch „Preu“ genannt, war verschieden groß und abhängig vom Umfang des wirtschaftlichen Hauswesens des brauberechtigten Bürgers, seines Vermögens und auch von den bei ihm vorhandenen Kelleranlagen. Oft taten sich mehrere Bürger für eine einzelne „Sud“ zusammen. Diese umfasste etwa 48 „Eimer“, wobei ein Eimer Bier auf 64 Liter gerechnet wurde.
Das Bier musste „tarifmäßig“ sein
Im Marktarchiv ist zum Thema „Brauwesen“ ein Akt aus dem Jahr 1848 niedergelegt, der sich mit dem „Verbot von Erzeugung und Verleitgabe (Bierausschank) von stärkerem, als tarifmäßigen Bier“ befasst. Aufgrund dieser Sachlage ließen Bürgermeister Saemmer und der Magistrat am 5. Januar 1848 die „bräuenden Bürger“ auf das Rathaus vorladen und eröffneten ihnen eine vom Ministerium bereits am 5. Dezember 1847 erlassene höchste Entschließung nach welcher kein Brauberechtigter ohne allerhöchste Bewilligung befugt ist stärkere Biere wie „englisches Ale (englisches obergäriges Bier), Porter, Luxusbier, Doppelbier, Bock, Salvatorbier, als tarifmäßiges zu produzieren“.
Diese Anordnung bestätigten 16 Bürger mit ihrer Unterschrift, die gerade in diesem Jahr im Brauhaus ihre Suden herstellen ließen. Monate später, am 11. April, schaltete sich in diese Angelegenheit der gerade amtierende Landrichter von Kötzting, der Herr von Paur, ein. Unter dem Titel „der Schankpreis des Bieres beym minuto Verschleiß“ (sofortigen Ausschank) bezog sich der hohe Beamte dazu auf eine am 26. Januar erlassene Verordnung und machte die Marktführung „besonders aufmerksam auf den Auftrag“ – sollte es nicht schon geschehen sein - „diese den (gerade) bräuenden und brauberechtigten Bürgers sofort zu publizieren und wie geschehen anzuzeigen“.
Wenige Tage später, am 17. April ließ der Magistrat „wegen des Minutoverschleiße zu erhebenden Schankpreise sämtliche bräuenden Bürger, welche für das Sudjahr 1847/48 Bier gebraut haben, zum Magistrate vorladen und eröffnete denselben, daß sie nach allerhöchster Entschließung vom 18. Dezember 1847 gleich den Inhabern selbstständiger Bräuern berechtigt seien, jenes Bier, das sie an die ihre Zech- und Wirtschaftslokalitäten besuchenden Gäste in minuto (unmittelbar) verzapfen, um den Schankpreis abzugeben, also für den laufenden Monat April noch um: 4 Kr(euzer), 2 & (Pfennige) pro Maß, für den Monat Mai bis zum 15. Juli um 5 Kr. 2 & und ab dem 16. Juli bis zum Jahresende aber um 5 Kr“.
Der „Ganterpreis“ war Vorschrift
„Jenes Bier jedoch, welches sie über die Gasse (aus der sog. Gassenschenke im Wirtshause) ausschenken, haben sie um den Ganterpreis abzugeben“ (Der „Ganter“ selbst ist ein Gerüst oder eine Bühne aus massiven Balken, auf dem die Fässer stehen, eine Art Schanktisch außerhalb der Gaststube – bedeutet aber auch den vom Staat für das Bier festgesetzten Preis, was hier zutrifft), demnach im April noch um 4 Kr., vom Mai bis 15. Juli um 5 Kr. und ab dem nächsten Tag bis Jahresende um 4 Kr. 2 &. 14 bräuende Bürger bestätigten ihre Kenntnisnahme mit ihrer persönlichen Unterschrift. Es waren nach der alten Hausnummerierung dies die Bürger Franz Rötzer (Hsnr. 19), Joseph Lemberger (37), Alois Schmirl (41), Andre Seidl (56), Josepf Pfeffer (59), Franz Pfeffer (3), Ignatz Schmirl (72), Anton Korherr (71), Wolfgang Späth (14), Anna Schöppel (34), Joseph Neumeyer (1), Joseph Späth (5), Anton Baumann (21) und Mathias Späth (39).
Wenn anfänglich von 61 brauberechtigten Bürgern im Markte gesprochen wurde, so beweist gerade die eben genannte Zahl von nur 14 bräuenden Bürgern im Jahr 1848, dass damals und sicher auch in den Zeiten vorher, immer jeweils nur ein Teil der Bürger ihr seit alten Zeiten bestehendes Recht, im Kommunebrauhaus Bier brauen zu lassen, auch ausübten. Basis dafür war stets deren jeweilige wirtschaftliche Lage.
Werner Perlinger
In früher Zeit verkauften die Bäcker ihre Waren in einem „Brothaus“
+Eschlkam. Im Marktarchiv findet sich ein Akt aus dem Jahr 1850 mit dem Titel: „über die Verpachtung des der Marktsgemeinde Eschlkam eigenthümlich gehörigen Fragner- und Melber Gewerbes“. Dazu folgende Erklärung: der „Fragner“ ist eine sehr alte heute nicht mehr übliche Bezeichnung für den Krämer. Mit „Melber“ oder auch „Melbler“ bezeichnete man noch im 19. Jahrhundert den Mehlhändler.
Als es noch nicht die regulären Geschäfte für die Metzger und Bäcker gab, durften die örtlichen Metzger nur in einer eigens geschaffenen sog. „Fleischbank“ ihre Ware verkaufen; ebenso die Bäcker ihre Produkte in einem dafür eigens gebauten „Brothaus“. Das war in allen Städten und Märkten gleich oder ähnlich geregelt. In Eschlkam befanden sich als öffentliche Einrichtungen für alle Bewohner das ehemalige Brothaus und die Fleischbank einst auf dem Marktplatz neben der heutigen Bäckerei Hastreiter (Balsenbäck); zentral gelegen und leicht erreichbar für alle Bürger. Die dafür im Laufe der Zeit immer wieder neu zu erstellenden Gebäude besaßen nur ein Erdgeschoß. Im Brothaus verkaufte ein „Brothüter“ oder „Brodsitzer“, wie er im amtlichen Schriftverkehr verschiedentlich genannt wird, die von den ortsansässigen Bäckern angelieferten Brot- und Backwaren.
Am 27. Januar 1848 stellt die Regierung von Niederbayern, hier die „Kammer des Innern“ fest, dass der Magistrat des Marktes „das Recht zur Verleihung einer persönlichen Fragners u. Melbbers Concession an einen jeweiligen Brodhaushüter als ein Annexum (Anhängsel) des dortigen Brodhauses“ habe. Zudem bestätigte die Regierung, dass der Brothaushüter laut Inhalt eines alten Salbuches (Verzeichnis über Besitzrechte) mindestens seit dem Jahre 1705 die Erlaubnis habe, „daselbst eine Fragnerei mit der Befugnis zum Mehlverschleiße (Verkauf)“ zu betreiben, „da es zum Nutzen und zur Bequemlichkeit des Publikums in Eschlkam gereiche, wenn dasselbe im dortigen Brodhaus sogleich Mehl und Fragner Artikel beziehen kann“. Abschließend wurde festgestellt, dass bereits am 29. März 1830 der Ökonom und Fuhrmann Joseph Pfeffer (HsNr. 59/Marktstraße 13) als „Brothüter in persönlicher Eigenschaft“ bestellt worden sei.
Unterverpachtung gerügt
Pfeffer, hauptsächlich als Fuhrmann viel unterwegs, kam jedoch gerade wegen dieser Tätigkeit seinen Aufgaben im Brothause nicht nach. Daher hatte er die Tätigkeit des „Brodsitzers“ an den Inwohner (nur Mieter, ohne Hausbesitz) Michael Zellner abgegeben. Heute würde man von Unterverpachtung sprechen. Dieser Umstand, dass Pfeffer einen Teil „der übertragenen Concession“ pachtweise an einen anderen übertragen hatte, wurde amtlicherseits gerügt. Die Behörde duldete das nicht und forderte, dass „alle Befugnisse“ von Pfeffer selbst ausgeübt werden müssten.
Mittlerweile war im Juni 1850 der Bürger Pfeffer verstorben. Daher beschloss am 8. August der Marktrat die Verpachtung des Brothausdienstes auf jeweils sechs Jahre, verbunden mit den beiden Gewerben, öffentlich zu versteigern. Gegen diesen Beschluss erhoben nun acht Tage vorher die vier damals in Eschlkam ansässigen Bäcker Joseph Lemberger (Hsnr. 37/Marktstr. 11, vulgo „Brücklbäck“), Franz Rötzer (Nr. 19/ Further Straße 4 u. 6), Georg Hastreiter (Nr. 23/ Marktstraße 2) und Andreas Plötz (Nr. 58/ Blumengasse 2, vulgo „Voglbäck“) Einspruch mit dem Hinweis: sie allein hätten bisher immer das Recht gehabt einen „Brodhauswärter“ aufzustellen, der auch die Befugnis habe die zwei besagten Gewerbe mitauszuüben. Dabei beriefen sie sich auch auf die Verordnung aus dem Jahre 1705. Der Marktrat widersprach diesem Ansinnen und begründete es hauptsächlich mit dem Hinweis, dass nach Inhalt aller Unterlagen allein dem Magistrat das Recht zustehe, einem „jeweiligen Brodhüter“ auch den „Kram-und Mehlhandel“ zu gewähren; letztlich bestätigt von der Regierung am 27. Januar 1848.
Die Versteigerung
Die Auktion wurde auf den Sonntag, 11. August 1850, mittags 1 Uhr, festgelegt. Noch einen Tag zuvor, am 10. August, wollten die drei ansässigen Bäcker das Ganze auf dem „Appellationswege“ (Berufung) bei der Regierung Niederbayern verhindern, aber ohne Erfolg. Das „Pachtobjekt“ wurde zunächst mit 4 Gulden ausgerufen. An der Versteigerung beteiligten sich die Bürger Georg Mühlbauer, Anton Pfeffer, Joseph Späth und von den Bäckern nur Joseph Lemberger. Als letzter bisher noch nicht teilgenommen, gab er gegenüber Späth, der 27 Gulden aufbringen wollte, ein Gebot mit 28 Gulden ab, was ihm letztlich den Zuschlag garantierte. Lemberger setzte offenbar alles auf eine Karte, denn er wollte sich den Gewinn aus dem Verkauf seiner Erzeugnisse und einem gleichzeitigen möglichen Handel mit Mehl und Krämereiprodukten nicht entgehen lassen.
Erst ein gutes Jahr später, am 22. November 1851, entschied das Königliche Appellationsgericht von Niederbayern in der Absicht, für eine mögliche, später ähnlich wieder auftretende Situation endgültig Klarheit zu schaffen, dass „die Beschwerde des Bäckers Joseph Lemberger und (der) 3 Consorten“ abzuweisen war. Auch hätten sie an ihren Anwalt und Advokaten Müller aus Kötzting für die Abfassung der Beschwerdeschrift 4 Gulden an Gebühren zu entrichten. In der ausführlichen, mehrseitigen Begründung hatte sich das Berufungsgericht der Argumentation des Marktes voll angeschlossen.
Werner Perlinger
Die Erlaubnis zur Heirat musste eigens beantragt werden
+Eschlkam. Wenn im 19. Jahrhundert oder noch früher junge Leute heiraten wollten, war dazu die Erlaubnis der Gemeinde einzuholen, in der sie ihren Familienstand begründen wollten. Mit dem Gemeindeedikt von 1818 wurde im Königreich Bayern der „Heiratskonsens“ den Gemeinden übertragen. Grund- und Hausbesitz, Steuerabgabe, Heimatrecht, ein einwandfreier Leumund waren unter anderem die damaligen Voraussetzungen für eine Heiratsgenehmigung. Erst ein Gesetz von 1868 brachte wesentliche Erleichterungen, die im sog. „Zweiten Reich“ unter Reichskanzler Otto von Bismark im Reichszivilehegesetz vom Februar 1875 fortgesetzt wurden.
Demnach wurde vor 1868 von den Gemeinden streng darauf geachtet, dass bei Heiratswilligen beim Eintritt in das Eheleben „der Nahrungsstand“ gesichert war. Man wollte so auf längere Zeit vorsorgen, dass die Kommune von armen Familien, die sie letztlich im Notfall zu unterhalten hätte, so weit wie möglich verschont blieb. Es mögen nun – wie in früheren Aufsätzen teils schon geschehen – einzelne Vorgänge hinsichtlich der gegebenen Erlaubnis eine Ehe zu schließen – dem Leser unterbreitet werden:
Wir schreiben das Jahr 1854: Am 15. Dezember spricht im Rathaus bei Bürgermeister Simon Moreth (Nr. 42/Blumengasse 7) und im Beisein des Marktschreibers (Joseph Anton) Beutlhauser der Bürgersohn Wenzl Späth (geb. am 10.11.1824) vor und erklärt, sein Vater (Joseph Späth) habe ihm das elterliche Anwesen (Nr. 5/ Further Straße 3) mit den dazu gehörenden Gründen, geschätzt auf den stattlichen Wert von 6.500 f (Gulden), übergeben. Er möchte sich auf diesem Anwesen ansässig machen und eine Familie gründen. Als Braut wählte er die Brauerstochter Crescentia Mühlbauer von Arnschwang. Die Mühlbauer selbst, so Späth in seinem Gesuch, verfüge über ein Heiratsgut von stattlichen 2.400 f. Auch habe sie einen guten Leumund.
Uneingeschränkte Zusage
Noch am gleichen Tag erklärten sämtliche Gemeindebevollmächtigte, insgesamt 12 Bürger, dazu wie folgt: „da auf dem vom Gesuchsteller übernommenen elterlichen Anwesen der Nahrungsstand für eine Familie vollkommen begründet ist, (sei) keine Einwendung vorzubringen“. Keinerlei Einwendungen gegen das Vorhaben des Bürgersohnes Späth hatte auch der Armenpflegschaftsrat, so dass dessen sechs Mitglieder, darunter Bürgermeister Moreth und Pfarrer (Karl) Pittinger, auf Grund der wirtschaftlichen Lage des Brautpaares uneingeschränkt ihre Zusage gaben. Am selben Tage noch, am 15. Dezember beschloss der Magistrat „nach collegialer Berathung, daß dem Gesuch stattzugeben sei“. Das Protokoll unterschrieben Bürgermeister Moreth und die Magistratsräte Mathias Späth (Nr. 35/Marktstraße 7), Georg Forster (Nr. 36/Marktstraße 9), Carl Müller (Nr. 25/ Waldschmidtplatz 8) und (Wilhelm) Wernhard (Nr. 7/Kleinaignerstr. 3). Dieser Beschluss wurde in Abschrift dem Gesuch des Späth beigelegt. Einen Tag später wurden dem Wenzl Späth die „nötigen Zeugnisse über die ertheilte Ansässigmachung und Verehelichung ausgestellt“.
Nur ein Maurer im Markt
Ein knappes Jahr später, 1855, am 15. Oktober beantragt der „ledige Marktdienerssohn und Maurergeselle“, Jakob Pinzinger – seine Eltern waren der Marktdiener Franz Pinzinger und Maria, geb. Prandl von Stachesried (wohnhaft im ehemaligen sog. „Marktdienerhaus“ Nr. 62/ Großaignerstr. 5) – „daß er sich in Eschlkam auf Lohnerwerb als Maurer ansässig machen“ dürfe, „da ich als Maurer mein ordentliches Auskommen finden würde, indem hier nur ein Maurer sich befindet“. Auch wolle er die Bürgerstochter Therese Hausladen ehelichen. Ein Vermögen in Geld konnten beide wohl nicht vorweisen, da zu dieser Frage bei Angaben der Beträge eine Lücke offen gelassen wurde.
So gesehen lagen für beide die Chancen für den Erhalt einer Heiratserlaubnis nicht gut. Doch bereits am 18. Oktober erteilten die Gemeindebevollmächtigten dem Pinzinger trotz vorgegebener Armut „die Ansässigmachung auf Lohnerwerb und die Verehelichungsbewilligung, da sich der Gesuchsteller voraussichtlich als Maurer dahier ordentlich wird fortbringen können“. Pfarrer Pittinger konnte einen möglichen Einspruch gegen die Absicht Pinzingers nicht mehr geltend machen, da das Gesuch ihm erst sechs Tage später am 24. Oktober vorgelegt wurde und die Entscheidung der Gemeindebevollmächtigten bereits rechtskräftig geworden war. Der eigentliche Grund warum in diesem Fall, obwohl der „Nahrungsstand“ noch nicht gesichert erschien, eine schnelle für Pinzinger positive Entscheidung getroffen wurde, lag allein in der Tatsache begründet, dass der Markt unbedingt einen weiteren Maurer als Handwerker haben wollte, weil gerade in damaliger Zeit, oft ausgelöst durch furchtbare Brandkatastrophen, viele Holzbauten (die sog. Waldlerhäuser) immer mehr durch Bauten aus Stein ersetzt werden mussten. Dass der Maurerberuf auf dem Lande immer mehr Bedeutung erlangte, liegt zudem darin, dass infolge neuer Bauordnungen in vielen Bereichen der herkömmliche, über Jahrhunderte gepflegte Holzbau untersagt worden war. So durften beispielsweise nach dem großen Stadtbrand in Furth im Jahr 1863 die Städel bei den einzelnen Ökonomiebürgeranwesen nicht mehr aus Holz sondern nur mehr gemauert errichtet werden.
Werner Perlinger
Einst blühte im Grenzgebiet der Schmuggel mit allerlei Waren
+Eschlkam. Ebenso alt wie das Zollwesen ist auch der Schmuggel. Das Wort kommt aus dem germanisch-englischen Sprachbereich und heißt so viel wie Schleichhandel. In unserem Dialekt sagt man „schwärzen“ bzw. „schwirzn“, d.h. Waren illegal am Zoll vorbei von einem Land ins andere bringen; „schwirzn“ wohl deshalb, da sich die Schmuggler mit Ofenruß das Gesicht unkenntlich machten. Den Schmuggler nannte man auch Pascher (dieser Begriff für Schmuggler kommt aus der Zigeunersprache). Seit Einrichtung von Zollstationen wurde gleichzeitig immer auch versucht, diese örtlich zu umgehen, um so die staatlich festgelegten Abgaben auf eine Ware einzusparen. Im Grenzgebiet zwischen Čerchov und Rittsteig blühte vor dem Zweiten Weltkrieg der Schmuggel hauptsächlich mit Vieh (Rinder, Pferde, Schweine und Gänse), Salz, Zucker, Mehl, Käse, hochwertigen Lederwaren und Tabak. In der Inflationszeit war die böhmische „Krone“ sehr begehrt, damals eine starke, stabile Währung gegenüber der schwindenden Mark.
Nach Auskunft alter Gewährsleute blühte der Schmuggel in beide Richtungen. Man hat alles „gschwirzt“, was sich aufgrund gegenseitiger Handelsunterschiede rentierte. Die Konjunktur und die Waren wechselten je nach Wirtschaftslage. Harmlos war, wenn sich mancher gelegentlich einmal etwas unverzollt aus dem Nachbarland mitbrachte.
Anders beim Salz: dieses Gut wurde in den 20er Jahren sackweise über die Grenze in das an Salzlagern arme Böhmen getragen. Damals kostete der Zentner drei Mark. Die jungen Burschen im Grenzland haben sich bei ihrer Geldknappheit damit ihren Unterhalt verdient, da sie in Böhmen für den Zentner fünf Mark erhielten. Sie gingen nachts oft bis zu dreimal und erzielten dabei so viel Geld, wie einer allein, der dafür die ganze Woche arbeiten musste. Bei der Grenzlandbevölkerung galt der Grundsatz: „S`schwirzn is koa Verbrechn“.
Einzelne Tiere und ganze Herden von Rindern – zehn bis 15 Stück - gingen in den 30er Jahren bei Nacht über die Grenze, geführt von den Profis. Wenn nötig, wurde eine alte Kuh an einer Stelle „laut“ über die Grenze getrieben um so die Beamten vom Haupttrieb - oft an die 30 Tiere und mehr - abzulenken, der einige 100 Meter entfernt gerade die Grenzlinie passierte. Auch wurden Ferkel und junge Schweine „geschwirzt“. Damit diese nicht schrieen, gab man ihnen vor dem Grenzübertritt einen kräftigen Schluck Schnaps, worauf diese kurzzeitig schliefen.
Beiderseits der Grenze war das „Schwirzn“ bestens organisiert, so dass die Beamten oft einen harten Stand hatten. Manchmal aber kam es zu brachialen Auseinandersetzungen zwischen den Zollbeamten und den Schmugglern. Es kam vereinzelt zu Schießereien, da manche Schmuggler nur allzu gerne zu den Waffen griffen, um sich das Schmuggelgut nicht abnehmen zu lassen. Viele Tricks wurden angewandt, um die Ware sicher schmuggeln zu können. Wurden ein einzelner Schmuggler, oder eine ganze Bande ertappt und arretiert, so verfiel die dabei erlangte Ware unweigerlich dem Fiskus, und die Täter erhielten in der Regel empfindliche Geld- oder Gefängnisstrafen. So mancher Kleinbauer und Häusler verlor dadurch sein Anwesen und geriet so in den Ruin.
Im Archiv des Marktes hat sich zu diesem Thema ein Akt erhalten mit dem Titel: „Die vom königl. Landgericht Kötzting zu versteigern übertragen eingeschwärzte, und confiscirte Sachen betr.“ Einige Begebenheiten daraus seien angeführt: Am 23. Januar 1833 hatte sich das Zollamt mit der „Einschwärzung eines Spinnrades durch einen Unbekannten“ zu befassen. Der Magistrat wurde von der Zollbehörde um die Vornahme der Versteigerung gebeten worden. Offenbar hatte jemand im Nachbarland günstig von einem sog. „Holzbitzler“ ein Spinnrad erworben, vielleicht sogar als damals nötiger Teil für eine Heiratsaussteuer.
Zwei Monate später, am 23. März meldet das Zollamt an den „Markts Magistrat dahier, ein gestern durch (den) Zollgendarm Siegelin aufgegriffenes Kalb, dessen Eigenthümer entflohen ist, sollte bei jenseitigen Magistrate nach vorausgegangener Bekanntmachung ungesäumt versteigert werden, indem der Transport nach Kötzting mit großen Schwierigkeiten und Unkosten verbunden ist.“ Das Kalb war noch sehr jung und konnte noch kein festes Futter zu sich nehmen. Daher wird es im Schriftverkehr auch als „Saugkalb“ bezeichnet, d.h. es war noch auf die Muttermilch angewiesen. Deshalb bat das Zollamt die Marktbehörde das Tier, das mittlerweile im Stalle des Metzgers Schöppel untergebracht war, „unter Beobachtung der gesetzlichen Formalitäten zu versteigern“. Das Bittschreiben unterzeichnete der damalige Zollbeamte Adalbert Schmidt, Vater des Literaten Maximilian Schmidt genannt Waldschmidt.Noch am gleichen Tage wurde die öffentliche Versteigerung angesetzt. Geschätzt wurde der Wert des Kalbes auf 1 Gulden 15 Kreuzer. Als Interessenten meldeten sich der Lehrer Dobler, der „Insaß“ (wohnt in Miete) Georg Kellner und letztlich der Metzger Joseph Schöppel, bei dem das kleine Kalb untergebracht war. Schöppel, der damals als Metzger das Anwesen Nr. 34, heute Marktstraße 5, innehatte, war mit 1 Gulden 45 Kreuzer der Meistbietende und erhielt den Zuschlag. Kurze Zeit später wurde der „hiesige Magistrat aufgefordert, die 2 Säcke Haderlumpen, welche dem Jacob Stingel und Joseph Seiler abgenommen wurden, zu versteigern“. Die Sammlung nicht mehr gebrauchter Textilien aller Art, früher bezeichnet als „Hadern“ oder „Haderlumpen“, schien damals für die kleinen Leute ein einträgliches Geschäfts gewesen zu sein, denn diese Ware wurden dringend für die Papierherstellung gebraucht. Die nächste Fabrik dafür war seit etwa 1810/12 in der Stadt Furth angesiedelt.
Der Schmuggel endete 1938 durch den Anschluss des Sudetenlandes und ein Jahr später mit Annektion der Tschechei durch Adolf Hitler. Mit dem endgültigen Fall der Grenze ab 1989 blühte der Schmuggel wieder auf. Heute werden global Menschen und Rauschgift illegal über die Grenzen befördert, und Zoll, Polizei und BGS haben alle Hände voll zu tun, um auch nur einigermaßen dieser „modernen“ Kriminalität begegnen zu können. Seit 1988 erinnert ein „Schwirzer“-Denkmal an die Schwirzer. Es wurde an der Straße von Schachten nach Neumark/Všeruby am 19. Juli eingeweiht. Die monumental aus Flossenbürger Granit gehauenen Skulpturen stellen einen „Schwirzer“ dar, der gerade ein Rind über die Grenze führt. Über der linken Schulter hängt ein Sack. Ein kleiner Hund begleitet den Viehtreiber.
Werner Perlinger
Stets bemühte man sich die Lebensverhältnisse auf dem Lande durch gesetzliche Vorgaben zu verbessern
+Eschlkam. Eine Bestandsaufnahme der frühen Lebensverhältnisse im Hohenbogen-Winkel verdanken wir dem Generallandesdirektionsrat Joseph von Hazzi, der am Höhepunkt der Aufklärungszeit sein Werk „Statistische Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern, aus ächten Quellen geschöpft“ in den Jahren 1802-1808 herausgegeben hat. Nach eigener Inaugenscheinnahme schreibt der hohe Beamte über unsere Gegend u.a.: „Die kleinen Dörfer mit ihren kleinen hölzernen Häusern, die ganz mit Holz umringt und mit schweren Schindeldächern belegt sind, bieten einen widerlichen Anblick dar: Die Hausthüren sind so klein, daß man sich tief bucken muß, um sich nicht vor den Kopf zu stoßen; aus den Fensterlöchern zu sehen, ist unmöglich. Im Innern ist die Hitze so drückend, daß man ersticken möchte. Alles ist mit Rindsblut kohlschwarz angestrichen, ohne Meubeln, voll Schmutz. Und dann erst der Stall! Man weiß nicht, wer schlechter wohnt, das Vieh oder die Menschen!“.
Zu Furth, Eschlkam und Neukirchen lautet der kritische Bericht des hohen Beamten: „In der Stadt Furth und den zwei Flecken befinden sich nur gewöhnliche Handwerker; die meisten von der Landwirthschaft leben. Da hier die einzige Verbindung mit Böhmen besteht, und der Haupthandlungszug hier eröffnet ist, so gibt es immer viele Fuhrleute und Fremde auf der Straße. Furth hat noch beinahe ganz das Aussehen eines Dorfes. Die Häuser sind meistens aus Holz und alles regellos durcheinander geworfen. Nicht viel besser steht es mit den Flecken Eschelkam und Neukirchen“.
Wenig Wert auf Sauberkeit gelegt?
Diese Beschreibung aus napoleonischer Zeit lässt den Schluss zu, dass auf Hygiene im Lebensalltag offenbar nicht viel Wert gelegt wurde, bzw. gelegt werden konnte. Es war daher nur allzu verständlich, dass übergeordnete Behörden im Laufe der nächsten Jahrzehnte immer wieder versuchten durch Vorschriften die Lebensverhältnisse auf dem Lande allgemein zu verbessern, vor allem auf dem Gebiet der Hygiene. So findet sich im Archiv des Marktes eine ortspolizeiliche Vorschrift, erlassen von der Gemeindeverwaltung am 2. Januar 1903 und im Original hier wiedergegeben.
„Demnach erließ die Gemeindeverwaltung auf Grund des Artikels 73 des Polizeistrafgesetzbuches von 1900 und § 16 der k(öniglichen) Allerhöchsten Verordnung vom 10. Februar 1901, die Wohnungsaufsicht betreffend, nachstehende ortspolizeiliche Vorschriften, deren Inhalt ein besonderes Interesse verdient:
§1. Wohn- und Schlafräume, sowie die dazu gehörigen Nebenräume, die Küche, Kammern, Aborte etc., müssen in reinlichem Zustand gehalten werden. Die Ortspolizei ist befugt, im Falle wahrgenommener Mißstände die Reinigung dieser Räume anzuordnen. Die Wohnungsinhaber sind verpflichtet, diesen Anordnungen innerhalb der bestimmten Frist Folge zu leisten.
§2. Es ist verboten, in Wohn- und Schlafräumen Schweine, Ziegen und Nutzgeflügel zu halten.
§3. Wohn- und Schlafräume dürfen zur längeren oder regelmäßigen Aufbewahrung von Feldfrüchten und größeren Mengen von Viktualien (Lebensmittel) nicht benützt werden.
§4. Wohn- oder Schlafräume dürfen nur insoweit vermietet werden, als eine Überfüllung derselben nicht eintritt. Als überfüllt ist ein Wohn- oder Schlafraum dann zu erachten, wenn auf eine erwachsene: über 16 Jahre alte Person nicht mindestens 10 cbm Luftraum und 3 qm Bodenfläche treffen; für nicht erwachsene Personen genügt die Hälfte dieser Ausmaße.
Auf Moral geachtet
§5. Unverehelichte Personen verschiedenen Geschlechts, welche das 14. Lebensjahr bereits überschritten haben, dürfen nicht in den nämlichen Schlafräumen untergebracht werden; dieses Verbot findet auch auf Geschwister Anwendung. Die Schlafräume von weiblichen Dienstboten und von Arbeiterinnen/Schlafgängerinnen müssen von innen verschließbar, jedenfalls aber die Thüren mit einem Riegel versehen sein.
§6. Schlafräume, welche an sogenannte Schlafgänger oder Bettgeher vermietet werden, müssen einen eigenen Eingang haben; es ist daher insbesondere unzulässig, Räume, zu welchen man nur durch die Wohn- oder Schlafräume gelangen kann, an Schlafgänger oder Bettgeher zu vermieten.
§7. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden an Geld bis zu 45 M(ark) bestraft.
Eschlkam, den 23. November 1902.
Diese Niederschrift unterschrieben Bürgermeister Hastreiter und die sechs Mitglieder des Gemeindeausschusses. Als ortspolizeiliche Vorschrift wurden diese Anweisungen sofort „öffentlich publiziert“. Sie traten unmittelbar in Kraft.
Ähnliche Vorschriften wurden von der Gemeinde mehrere erlassen. Bereits Monate vorher, am 8. Juni 1902, wurden nicht erlaubt z. B. „der Aufenthalt an und vor den Türen der Kirche während der Gottesdienste, auch der Aufenthalt auf dem Gottesacker während der hl. Messen“. Grundsätzlich verboten war, „das Umherlaufen lassen der Gänse und Hühner im Gottesacker“.
Bei allgemeiner Betrachtung dieser Vorschriften, für deren Einhaltung die jeweilige Ortspolizei aufgrund höchster Anordnung zu sorgen hatte, erklärt sich, dass es den damaligen staatlichen Organen ein großes Bedürfnis war für Sauberkeit im Alltag zu sorgen. Mit dem Fortschritt in der Medizin hatte man gelernt, bei Einhaltung oben genannter Anordnungen mögliche Seuchen, wie sie in den Zeiten vorher immer wieder auftraten, zu unterbinden. Auch wollte die weltliche Macht dafür sorgen, dass im Bereich der Kirchen und der Friedhöfe Ordnung gegeben war, hauptsächlich wenn die gottesdienstlichen Handlungen durchgeführt wurden.
Werner Perlinger
Um kranke und behinderte Menschen sorgte die Gemeinde auch in früher Zeit
+Eschlkam. Schon immer war es ein heikles Thema, über behinderte Menschen und ihre Leiden bzw. Probleme, welcher Art auch immer, Niederschriften anzufertigen. Heutzutage charakterisiert diese Berichte eine hohe Sensibilität gegenüber den Betroffenen, was die jeweilige Wortwahl der verwendeten Begrifflichkeiten betrifft. Das hat seinen Ursprung in der Vergangenheit, in der Zeit des sog. „Dritten Reiches“, als „die Vernichtung unwerten Lebens“ zur politischen Tagesordnung gehörte. Gerade diese, heute Gott sei Dank unvorstellbare Denkweise in der Hitlerdiktatur, dürfte zumal ein wenig ihren Ursprung auch in der amtlich gebräuchlichen Wortwahl in den Zeiten vorher haben, wenn es darum ging über körperlich oder geistig behinderte Menschen dienstlich Entscheidungen zu treffen. Als ein Beispiel für heute nicht mehr akzeptable Formulierungen seien Inhalte eines Aktes aus dem Marktarchiv angeführt:
Wir schreiben das Jahr 1895, wenige Jahre vor der Jahrhundertwende. Am 24. März 1895 wird unter dem Betreff „Evidenthaltung des bezirksamtlichen Irren etc-Verzeichnisses“ vom Bezirksamt (heute das Landratsamt) Kötzting die Gemeindeverwaltung beauftragt, „längstens inner von sechs Tagen alle im Gemeindebezirk vorhandenen, gleichviel ob in der Gemeinde oder auswärts befindlichen geisteskranken Personen und zwar nicht nur die eigentlichen Irren, sondern auch die blöd- und stumpfsinnigen Personen (Tölpel, Kretins), gleichviel ob sie aus öffentlichen Mitteln oder privat verpflegt und bzw. untergebracht sind, genauestens nach Maßgabe des umstehenden Schemas zur Anzeige zu bringen“. Ebenso mussten gemeldet werden die „blinden, taubstummen sowie krüppelhaften mit unheilbaren und bzw. Ekel erregenden Krankheiten behafteten Personen jeglichen Alters, sohin namentlich auch derartiger Kinder zu betätigen und gegebenenfalls hinsichtlich einer jeder dieser Personenkategorien Fehlanzeige zu erstatten. Gewissenhafter Vollzug wird gewärtigt (erwartet)“.
Ebenso wurde die Gemeinde aufgefordert darüber ein Register „für den eigenen Gebrauch anzulegen und fortan evident (auf dem Laufenden) zu halten“. Auch hatte die Gemeinde alljährlich zum 1. Januar nach dem „gleichen Schema anher (die Situation) anzuzeigen. Ueber die erfolgte Anzeige des Verzeichnisses ist gleichzeitig zu berichten und im Terminkalender der Vormerkung zu bestätigen“. Dieses auffordernde Schreiben unterzeichnete eigenhändig der damalige königliche Bezirksamtmann (heute bezeichnet als Landrat) von Schacky.
Ein Fragenkatalog
Diesem Akt beigefügt ist ein „Verzeichnis der geisteskranken, taubstummen, blinden und krüppelhaften Personen der Gemeinde“. Dazu ist ein fester Fragenkatalog vorgegeben wie nach Name, Stand und Alter der „krankhaften“ Person, sowie nach deren „Heimath“ und Wohnort. Genau aufgeführt mussten die jeweiligen Vermögensverhältnisse und „alimentationspflichtige (zur Sorge verpflichtete) Verwandte“ werden. Dann waren zu beantworten die „Form und muthmaßliche Ursache der Krankheit oder des Gebrechens, auch ob Hoffnung auf Heilung oder auch nicht bestand. Genaue Angaben wurden gefordert, wie die „derzeitige Verpflegung, insbesondere wie, bei wem und auf wessen Kosten für Wohnung, Pflege, Aufsicht und Erziehung gesorgt ist.“
Die Behörde will auch wissen, „ob Unterbringung in einer Anstalt geschehen und wer, seit wann auf wessen Kosten und zu welchem Betrage – oder noch nothwendig u. bzw. wünschenswerth (ist).“ Die letzte Frage, die es zu beantworten gab, lautete: „Bei Geisteskranken und Taubstummen“ wurde gefragt nach deren „Charakter, ob (die Kranken) insbesondere für Personen oder Eigenthum oder für die öffentliche Sicherheit u. Sittlichkeit gefährlich“ sind.
Vier kranke Personen
Die Gemeinde kam der gestellten Aufgaben gewissenhaft nach. Insgesamt sind vier Namen aufgeführt und entsprechend der Anfragen charakterisiert. In diesem Jahr waren dies zwei Frauen und zwei Männer. Die eine Frau verfügte über ein Barvermögen von 1200 Mark und war bereits seit zwei Jahren in der „Kreisirrenanstalt“ in Deggendorf untergebracht. Deggendorf kam damals in Frage, da Eschlkam zu Niederbayern gehörte. Für ihre Verpflegung wurde das noch vorhandene Barvermögen der Kranken herangezogen, so lange es reichte. Dann war die Armenpflege der Gemeinde zum Teil gefordert. Das gleiche traf auch für die zweite Frau zu.
Ein 60jähriger Mann war „von Geburt an taubstumm jedoch nicht total“. Er „verdiente sich selbst das Nötigste“ und galt „zur Alters- und Invalidenrente berechtigt“. Sechs Jahre hatte er bereits in der Taubstummenanstalt in Straubing zugebracht. Beschrieben wird er als „sehr gutmütig, dabei sittlich u. religiös“. Er lebte als „Hausknecht“ bei dem Brauerei- und Gasthofbesitzer Alois Neumeier, damals Hsnr. 1 (Waldschmidtstraße 14). Unter dem Titel „krüppelhafte Personen“ meldete die Gemeinde einen Buben, krankheitshalber bezeichnet als „Kretin“ (Dummkopf). Seine Mutter hatte ihn in Stich gelassen. „Die Mutter, welche in München dient, kümmert sich um ihr Kind gar nicht“, so die Meldung. Die Pflege hatte ihr Vater übernommen. Auch wird darauf hingewiesen, dass der Junge „sich zur Unterbringung in einer Kretinen-Anstalt nicht eigne; übrigens dürfte dieses Kind voraussichtlich nicht mehr lange leben“, so der Eintrag im Register.
Epilog: Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch des diktatorischen Regimes des Dritten Reiches kehrte von nun an vermehrt in der Betrachtung und somit auch der Beurteilung oben geschilderter psychisch oder physisch kranken Personen eine völlig neue Formulierungsweise ein – die Humanität und damit verbunden ein neues Denken gegenüber diesen Menschen, ließ eine neue Wortwahl entstehen. Nicht mehr gebräuchlich in der nun herkömmlichen Terminologie sind die angeführten harten Formulierungen. Im Gegenteil, amtlicherseits und auch in privater Sphäre spricht man allgemein nur mehr von „behinderten Menschen“. Erst dann wird, wenn erforderlich, die Situation des Betroffenen präzisiert.
Werner Perlinger
4000 Gulden in die Ehe eingebracht – 2050 Gulden als „Vatergut“ versprochen
+Eschlkam. Im Marktarchiv findet sich eine große Menge an Unterlagen, die sich mit Ansässigmachung und zugleich auch mit einer Erlaubnis zur Eheschließung befassen. Ein ganz besonderer Fall – was damalige Vermögensverhältnisse betrifft – wurde vom Magistrat im Jahr 1858 abgehandelt: Am 13. April erscheint der ledige Bauerssohn Joseph Fischer vom Großköpplhof (Unterfaustern) und bittet um eine Heiratserlaubnis. Er beabsichtigt die Bürgerswitwe Sophia Leitermann von Anwesen Nr. 2 (Waldschmidtstraße 10) zu ehelichen. Dazu verspricht Fischer an „Elterngut“ 4000 Gulden mit in die geplante Ehe zu bringen.
Zur Vorgeschichte: Drei Jahre zuvor hatte Joseph Leitermann von seiner Mutter Therese diesen „Hoamterhof“ übernommen. Leitermann starb bald darauf und seine Frau Sophie, eine geborene Moreth, musste allein schon aus wirtschaftlichen Gründen baldmöglichst eine neue, passende Ehe eingehen. Dafür war der Sohn des Bauern vom Großköpplhof, damals zur Gemeinde Schwarzenberg gehörend, von ökonomischer Seite her der passende Partner. So fand bereits am 15. April die Übernahme des Anwesens durch Joseph Fischer und Sophie, verwitwete Leitermann statt.
Aus ihrer ersten Ehe mit Joseph Leitermann stammte die Tochter Katharina. Um ihr eine wirtschaftlich sichere Zukunft zu gewährleisten, wurde bereits am 18. Juni 1857, sehr bald nach dem Tode des Vaters vom Landgericht Kötzting ein sog. „Vatergutsbrief ad 2500 f(Gulden)“ ausgestellt. Demnach schloss Sophia Leitermann, Bürgerswitwe von Eschlkam, „auf Ableben ihres Ehemannes Joseph Leitermann mit ihrem Kinde Katharina, vertreten von dem Vormund Wolfgang Neumaier, Bauer von Großaign, folgenden Vatergutsvertrag“. Auf der Basis des Ehevertrages vom 25. September 1855 ist das Kind mit der „Hälfte des Reinvermögens abzutheilen.“ Grundlage für die Höhe des Betrages bildete das „aufgenommene gerichtliche Inventar“, wonach ein „Reinvermögen“ von 4106 Gulden 25 Kreuzer festgestellt wurde. Aus dieser Summe „zeigt demnach die Witwe und Mutter in Berücksichtigung der sie treffenden Kosten die runde Summe von 2050 Gulden ihrem genannten Kinde als Vatergut aus“. Das Geld erfuhr zunächst keine Verzinsung, da die kleine Katharina „ohnehin in der mütterlichen Pflege und Versorgung ist“.
„Entgegen erlangt die Witwe“, so der Vatergutsbrief weiter, „nach dem allegirten (angeführten) Ehevertrage das Alleineigenthum des Anwesens, worauf das Vatergut von Amts wegen hypothekarisch versichert wird“. Diesen Vatergutsbrief unterschrieben neben Sofie Leitermann und Vormund Wolfgang Neumeier auch der Kötztinger Landrichter von Paur.
Wenige Tage vor der Eheschließung bescheinigte am 9. April der damalige Ortsvorsteher der Landgemeinde Schwarzenberg, Pongratz, dem Bräutigam Fischer „einen vorzüglichen guten Leumund“, was Pfarrer Karl Pittinger mit seiner Unterschrift zusätzlich bestätigte. Ebenso bestätigt der Ortsvorsteher Pongratz „auf Verlangen nach Wahrheit, daß der Bauer Franz Fischer seinem großjährigen Sohn Joseph behufs seiner vorhabenden Verehelichung ein baares Vermögen von 4000 f als Elterngut übergibt.“
Nicht fehlen im Akt durfte auch der „Entlassungs-Schein“ vom Militärdienste, ausgestellt bereits am 8. September 1854. Als Grund der Entlassung wurde angegeben „wegen Untauglichkeit zum Dienste in der Armee“. Durch ein beigefügtes „Signalement“ (Beschreibung) erfahren wir einiges über das Aussehen des Bauernsohnes Fischer. So war er über 5 Schuh (ein wenig mehr als 1,50 Meter) groß, hatte braune Haare, eine niedere Stirn, braune Augenbrauen und blaue Augen. Die Nase wurde als „proport“ (ebenmäßig) bezeichnet, ebenso der Mund. Wenig Bart zierte das Kinn. Sein Gesicht, das eine gesunde Farbe auszeichnete, war „oval“ gestaltet. Insgesamt hatte Fischer einen „schlanken Körperbau“. Besondere Kennzeichen, die es zu beachten gegeben hätte, waren keine vorhanden.
Beigefügt dem Ganzen ist auch das Abgangszeugnis von der „Werktagsschule“ in Schwarzenberg. In vier zu bewertenden Fächern, wie gegebene Fähigkeiten, Fleiß, Fortgang und sittliches Betragen, erhielt Fischer stets die schriftliche Note >vorzüglich<. Beigefügt ist dem Gesuch auch ein „Geburts- und Taufzeugniß“, eigenhändig ausgestellt von Pfarrer Pittinger. Daraus erfahren wir, dass er der Sohn des Franz Fischer, Bauers zu Großköppelhof und seines Weibes Anna Maria, geb. Stoiber von Jägershof war. Am Tage der Geburt noch wurde Joseph Fischer von Kooperator Georg Leutner getauft. Pate war der Jakobsmüllner (vulgo Gaglmühle) Joseph Maurer. Daher erhielt der Knabe – wie es damals üblich war- den Vornamen des Paten. Auch hatte Fischer sein „Religionsexamen sehr gut bestanden“. Nachdem die Gemeindebevollmächtigten, unter Bürgermeister Schmirl acht Bürger, und der Magistrat selbst beschlossen, das Gesuch der Ansässigmachung im Markte und Heirat uneingeschränkt zu befürworten, da der „familiäre Nahrungsstand fernerhin auf dem Sophie Leitermannschen Anwesen gesichert ist“.
Bei Betrachtung vieler sog. Heiratsabsprachen und nach erfolgter Eheschließung abgeschlossener Heiratsverträge fällt auf, dass von den jeweiligen betroffenen Personen darauf geachtet wurde, dass bei beiden Seiten die jeweilige finanzielle Lage in etwa gleich war. Niemals, so der Inhalt vieler solcher Verträge, konnte beispielsweise ein einfacher Knecht oder eine Magd in ein größeres Anwesen einheiraten. Das hat folgende verständliche Gründe: Bei Übergabe eines Hofes oder Bauerngutes hatte der Übernehmer, wie unserem Falle die Witwe Leitermann, dafür zu sorgen, dass die spätere Mitgift für die Tochter aus erster Ehe vertraglich abgesichert war, bzw. für die Geschwister des Übernehmers entsprechend der Wertigkeit des Anwesens eine gewisse Summe bereit gestellt werden konnte. Um aber den Hof nicht zu „schädigen“, konnte nur mit der Mitgift des einheiratenden Bräutigams oder der Braut eine durch anstehende Auszahlungen an Geschwister entstehende finanzielle Lücke aufgefangen werden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass im Hohenbogen-Winkel manche der wirtschaftlich herausgehobenen Bauernfamilien oft nah zueinander verwandt sind.
Werner Perlinger
Als die einzelnen Siedlungen im Hohenbogen-Winkel Ortstafeln erhielten
+Eschlkam. Wir schreiben das Jahr 1827. Im Herbst, am 19. November, wendet sich das Landgericht Kötzting (heute wäre es das Landratsamt) an den Magistrat des Marktes Eschlkam in sprachlich teils umständlicher Weise mit den Worten: „Was man unter heutigem in Betreff der Tafeln der Ortschaften und der Wegweiser erlaßen, theilt man dem Magistrat zu dem Ende mit, um sich gleichfalls hierüber binnen 8 Tagen anher zu erklären. Wohin u. in welcher Weise die Tafeln aufgestellt werden müßen, wird dann weitere dießartige Verfügung nachfolgen“.
Vereinzelt nur haben sich solche Ortstafeln bis heute erhalten. Sie finden sich teils noch an exponierter Stelle einzelner Straßenverläufe, restauriert angebracht an Gebäuden. Wenn auch die oft kunstvoll gestalteten Schriften meist verblasst sind, so überraschen die Tafeln selbst den Betrachter mit ihrer dekorativen Ausgestaltung. Sie sind die eigentlichen Vorläufer der heutigen Ortsschilder. Diese zeigen sich, dem Zeitgeschmack entsprechend, in streng einheitlicher Form, Farbe und Beschriftung.
Im Hohenbogen-Winkel finden sich gestreut viele einzelne Siedlungen, kleine Dörfer und Einödhöfe, die früher für den nicht ortskundigen Besucher oft schwer zu erreichen waren. Der Markt Eschlkam selbst liegt an einer bedeutenden Straße, die von Bayern aus ins Nachbarland Böhmen führt, in amtlichen Akten und in manchen Karten als „Vicinalstraße“ bezeichnet – ein Begriff der heute schlicht als Nachbarschaftsstraße (Land-, Kreis-, Bundesstraße) definiert wird – im Raum Eschlkam ihrer Bedeutung wegen gerne auch als „Handelsstraße“ bezeichnet.
Mit dem oben erwähnten Schreiben adressiert das Landgericht an die „dießseitigen Patrimonialgerichte“ eine genaue Anordnung wie die Schaffung und Aufstellung der Ortstafeln und Wegweiser zu geschehen habe. So sind die öffentlichen Wege mit Wegweiser und die Gemeinden, Dorfschaften und Weiler mit Tafeln zu versehen. Gemeinsam mit den Vorstehern der Gemeinden und den Gemeindepflegern (meist die Bürgermeister oder Obmänner) kam man nach „Berathung dahin überein“ ein geltendes Reglement aufzustellen, gegliedert in drei Punkten.
So sind die auszuweisenden Orte bei Herstellung der Hinweistafeln angehalten „zur Erzielung einer gleichen Form und gleichen richtigen und hübschen Schrift“. Auch habe man bei Bestellung auf „wohlfeile Preise“ zu achten. Wenn ein Handwerker bereit ist den Auftrag für alle Tafeln zu übernehmen, so sollen „die Tafeln zu Kötzting in Akkord (Bezahlung nach Stückzahl) gegeben werden“. Für die Herstellung der Tragsäulen für die Tafeln wurden die einzelnen Gemeinden selbst verpflichtet. Die Säulen sollten eine Höhe von mindestens „zehn Fuß“ haben, was etwa 3 Meter entspricht. „Das Anstreichen der Säulen“, so die Anweisung, „ist an den Wenigstnehmenden zu versteigern“. Es wurde mit dieser Vorgehendweise erwartet, „daß auf diese Weise am wohlfeilsten die Herstellung“ gelingen wird.
Außerdem hatten die Patrimonialgerichte (bis 1829 das Landgericht in Kötzting) die Aufgabe, sämtliche Gemeindevorsteher und Gemeindepfleger ihres Bezirks, für Eschlkam war es der Bürgermeister, „über den Eintritt zu diesem Beschluss zu vernehmen“. Binnen acht Tagen hatte dazu die Vollzugsmeldung zu erfolgen. Angemerkt wurde auch, „dass die Plätze an denen die Tafeln zu stehen kommen“, bzw. wie viele Tafeln aufzustellen seien, „erst nachfolgen“ werde. Ferner seien „für den gegenwärtigen Augenblick lediglich die an der Vicinalstraße erforderlichen Wegweiser und die Ortschaften, nach welchen die Gemeinden benannt sind, dann jene, welche gemäß der Vicinalstraßen liegen, bestimmend, die Ergänzung der übrigen Tafeln aber im nächsten Sommer zu bewerkstelligen sein wird“. Gemäß der Bedeutung dieses Schreiben unterschrieb es der Landrichter von Schatt selbst. Somit erhielt der Markt Eschlkam aufgrund seiner Lage an einer bedeutenden Straße, die von Bayern ins Nachbarland führt und umgekehrt, als erster Ort im Hohenbogen-Winkel seine Ortstafeln.
Verlegung des Oberzollamtes
Wegen der Bedeutung der den Markt durchlaufenden alten Handelsstraße ist diesem Akt beigefügt ein Antwortschreiben der Königlichen General Zoll-Administration in München vom 6. Juni 1828, betreffend „die Bitten des dortigen Magistrats um Belaßung des Oberzollamtes und des Gastwirts Spät wegen der für dieses neu erbauten Wohnung“. Mit letzterem war das spätere sog. Mauthaus gemeint, das von dem Wirt Späth 1827 als Wohnung für Zollbeamte gebaut worden war. In ihm wurde 1832 der bekannte und geschätzte Volksschriftsteller Maximilian Schmidt, zu Lebzeiten noch genannt „Waldschmidt“, als Sohn des Zollinspektors Adalbert Schmidt geboren.
Wie bereits in dem Artikel „Das alte Mauthaus wurde im Jahr 1827 erbaut“ dargelegt, wurde in Furth im Jahr 1828 das Oberzollamt offiziell eingerichtet. In Eschlkam verblieb nach Aufhebung des Oberzollamtes lediglich ein Zollamt, das nunmehr dem Oberzollamt Furth unterstand. Die Antwort aus München hat den kurzen, jedoch für den Markt Eschlkam bedeutenden Inhalt, der an dieser Stelle wortgetreu wiedergegeben werden soll: „Das Oberzollamt Eschlkam hat dem dortigen Magistrate die Eröffnung zu machen, daß die Verlegung des Oberzollamtes Eschlkam nach Furth allerhöchsten Orts beschloßen wurde, und nicht abzuändern sey, daß aber die Markts-Gemeinde in Belaßung eines Zollamtes mit einem Zollbeamten, einem kontrollierenden Amtsschreiber, und einem Zollwarte (somit einen) Ersatz finde“. Zu ergänzen sei noch, dass im Jahr 1834 in Folge einer neuen Zollordnung für Bayern (Reg.BI. vom 7. März 1834) das Oberzollamt Furth wieder aufgehoben und in Eschlkam ein Hauptzollamt errichtet und dorthin die Further Behörde verlegt wurde.
Werner Perlinger
Fischrechte wurden amtlich festgelegt - die Gemeindeweiher nach 1800 aufgelassen
+Eschlkam. In Niederbayern und auch in den übrigen bayerischen Landen hatte spätestens seit dem ausgehenden Mittelalter die Fischzucht eine große Bedeutung. Fisch war damals billig und stand auf dem wöchentlichen Speiseplan wohl viel häufiger als heutzutage; vor allem in der Fastenzeit, als es galt, für die herkömmlichen Fleischspeisen einen vollwertigen Ersatz an tierischen Eiweißen zu bekommen. Auch die Bürger von Eschlkam pflegten und förderten über die Jahrhunderte hinweg die Fischzucht. Dazu einiges aus alten Aufzeichnungen:
Der „Freypach“
Am 21. März 1691 wird den Bürgern das Fischen nur an festgelegten sog. „Vischtagen“ im „Freypach“ erlaubt, eine Maßnahme, die sich in den Protokollen immer wieder findet. Sog. „Freibäche“ gibt es allerorten. Oft sind sie heute nur mehr als Gewässernamen für einzelne Flussabschnitte erhalten, wie beispielsweise in der Stadt Furth. Der „Freybach“, in den Wäldern des hinteren Hohen Bogen entspringend und von Neukirchen kommend, wird abgesehen vom Haselbach, hauptsächlich von den frischen Wassern des Hohenbogen gespeist; und so war und ist er als Fischwasser besonders beliebt. Er war für die Bürger Eschlkams im Bereich des Markt- oder Burggedings für das Fischen „gefreit“, d. h. zugelassen, aber nur an bestimmten Tagen, um so eine Überfischung zu vermeiden. Von diesem Privileg her stammt auch der Name.
Nun einzelne Details: Jahre vorher: In der Ratssitzung vom 24. März 1686 wurden an die gesamte Bürgerschaft auch Verbote ausgesprochen, eigentlich Inhalt eigener vom Rat des Marktes erlassener Ortssatzungen. So wurde den Bürgern der „Freypach ausser Pfingst- und Fürgtag“ (das Fischen in diesem Bach jeweils nur am Donnerstag und dem Vortag) verboten, den Inwohnern ohne Hausbesitz aber gänzlich. Im Jahr 1706 z.B. betrug der „Vischgewün“ aus den Weihern des Marktes über 25 f (Gulden). Gleichzeitig erhielt der „Weihermeister“ Georg Zilckher für seine arbeitstechnische Betreuung der gemeindeeigenen Fischweiher 2 f.
Überlassung des Fischwassers an den Ortsadel
1721: „Weyland der hochedl geborene Herr Johann Baptist Walsers von Syrenburg gewest(er) churfrstl. Obristen dann Pfleger und Gräniz Haubtmanns zu Furth, wie auch Hofmarksinhaber zu Clainaigen und Schachten, und die Frauen Maria Caecilia dessen (sein) Ehegemahl beider nunmehr seelig hinterlassene Erben (wie) H. Johann Alberth Antoni Walser v. Syrenburg u. Frau Anna Barbara von und zu Haunzenberg auf Wildenau, und Frau Maria Franzsica Theresia Weingärtlerin v. Haybach auf Traxelsriedt, gebohrene Walserin v. Syrenburg Wittib, haben das churfrstl. Durchlaucht etc. urbahre Vischwasser, den Campp, dem hochedlgebohrenen Herrn Maximilian Antoni Walser, von Syrenburg, auf Clainaigen und Schachten, der churfrstl. Durchlaucht in Bayern etc. Gräniz Haubtmann und Pfleger zu Furth, als ihren H. Bruder pro 215 f käuflichen überlassen. Das Kaufrechtsgelt (Besitzveränderungsgebühr, eingezogen vom Staat) betrug 10f 45 Kr. Wir sehen, auch beim Ortsadel ließ der Staat in Steuerfragen nicht locker.
Überlassung des Fischwassers bei Pfarrerwechsel
1770, folio 50: „den 22. Juni wurde dem alhiesig neuangehenten Pfarrer, H. Anton Puchter von dem bis anhero alhier ebenmessig gewesten Pfarrer H. Johann Georg Schöppel das Fischwasser Camp pro 200 f käufflichen cediert (übertragen), dabey aber gleich vorhin das ius relictionis (Recht auf Vereisung) der gesambten Burgerschaft dasselbst per Expressum reserviert; und weillen die Schäzleith sothannes (dieses) Fischwasser um die Kauffs Summa ad 200 f nit einmahl Eydlich erkennen können; Also ist nach der lezteren Veränderung ad 213 f das Kaufrechtgeld erfordert worden, mit 10 f 39 Kreuzer. Von 1756, 18. August bis 1770 stand der Pfarrei Johann Georg Schöppl vor. Ihm folgte von 1770, 7. Juni – 1771 der Priester Anton Puchter.
Der Markt trennt sich von seinen Weihern
Nach 1800 wurden, wie in anderen Gemeinden auch, auf staatliche Anweisung hin die Gemeindegründe insoweit verteilt, um zunächst nur durch „Verstiftung“ (Pacht) mehr Geld in die stets darbende Kommunalkasse zu bekommen. Erhalten haben sich aus dem Jahr 1802/03 einzelne Protokolle welche inhaltlich „die Verlosung der zur Marktkammer gehörigen und zur Kultur gebracht werdenden Weiher“ enthalten. Am 6. August 1802 hat sich „die Burgerschaft in Belang der zur Marktskammer gehörigen 3 Weiher vereinbahrt, daß sie diese auf 61 Theile folglich gleichheitlich Stiftweis an sich bringen, in CULTURstand setzen und für jeden Theil des Jahres 1 f 30 Kr., mithin zu Michaeli 1803 90 f 30 Kr. Zins zum erstenmal zum Stiftgeld bezahlen“. Das Protokoll vom 23. April 1803 führt 61 hausansässige Bürger auf, an die die Flächen der Weiher gegen eine entsprechende Gebühr „verlost“ wurden. Die drei zur Gemeinde gehörende Weiher sind namentlich aufgeführt wie der „Staudenweiher“ (5 Tgw), der „Brutweiher“ (3 Tgw) und der „Penzenweiher“ (8 Tgw). Zusammen ergab ihre Grundfläche 16 Tagwerk. Sie lagen einst links neben dem Freibach im Talboden. Der ehemalige „Staudenweiher“ kann nahe der Bäckermühle verortet werden, der „Penzenweiher“ bei der gleichnamigen Mühle. Der „Brutweiher“, sein Name ist nicht mehr bekannt, lag entsprechend der auf die einzelnen Parzellen eingetragenen damaligen Hausnummern wohl nördlich oberhalb des Staudenweihers, bzw. der Bäckermühle. Die vorher zur Aufteilung nötige Vermessung führte der aus Furth stammende Geometer Max von Sonnenburg durch.
„Die in 61 Köpfen bestehende Bürgerschaft“ fasste einstimmig den Beschluss, „die Weihergründe gleichheitlich zu vertheilen, in Culturstand zu bringen, und für jeden Theil des Jahres 1 f 30 Kr. als Stiftgeld“ (Pacht) zu bezahlen, und dies über die nächsten Jahre hinweg. Aufgabe war es dann die „3 Weyher proportioniert stiftweis (als gepachtete Gründe) an sich zu bringen“. Im Laufe der nächsten Jahre wurden sie in Kulturland (Wiesen und Felder) umgestaltet und schließlich gänzlich privatisiert.
Werner Perlinger

Bildtext: Im Liquidationsplan von 1840 sind die einzelnen Weiherteile, amtlich vermessen und bereits aufgeteilt unter der Eschlkamer Bürgerschaft, westlich des Marktes unterhalb von Kleinaign im Talboden zwischen Freibach und dem Steinriegel eingezeichnet. (Bildnachweis: Markt Eschlkam)
Verzeichnis über genehmigte Bauten beschreibt die infrastrukturelle Lage des Marktes
+Eschlkam. Eine „Übersicht der im Gemeindebezirke Eschlkam vorgekommenen Neubauten und Gebäude-Erweiterungen“ gibt für die Jahre 1883 bis 1911 einen umfassenden Einblick nicht nur über das Bauwesen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, sondern lässt auch die damals gegebene wirtschaftliche Lage der Marktbewohner erkennen. Schließlich bedeutete beispielsweise der Neubau eines Hauses für einen Bürger bzw. seine Familie eine bedeutende und wirtschaftlich fordernde Anstrengung, die wohl überlegt sein wollte.
Die Aufzeichnungen beinhalten selbstverständlich auch baulich kleinere bis nahezu unbedeutende Anträge. Aus dem ganzen vorgegebenen Konvolut sei deshalb eine Auswahl vorgestellt. Bei den einzelnen Vorhaben werden jeweils der Bauherr, die gewünschte Maßnahme, deren Beginn und die Fertigstellung sowie auch der „Name des mit der Leitung des Baues betraute Bau-Handwerker (Meisters/Polier)“ aufgeführt.
So stellte am 22. Mai 1883 der Bäcker Georg Hastreiter den Antrag auf „Reparatur des Wohnhauses“ (Nr. 23, nun Marktstraße 2). Am 25. Mai begannen die Arbeiten. Sie waren am 18. Juli vollendet. Ausgeführt wurden sie von dem Maurer Jakob Pinzinger, Sohn des damaligen Marktdieners Franz Pinzinger.
1885 ließ der damals amtierende Pfarrer Johann Baptist Braun (1877-1897) im Bereich des zentral im Markt gelegenen Ökonomiepfarrhofes, eine Holzremise erbauen. Ausgeführt wurden die Arbeiten von Marzell Hastreiter.
Im selben Jahr gab der Metzger Joseph Späth bei Jakob Pinzinger den Bau einer „Fleischkammer“ in Auftrag. Die Baumaßnahme dauerte vom 11. bis 31. August. Wahrscheinlich war diese Maßnahme aus hygienischen Gründen zur Pflicht geworden.
Zur gleichen Zeit benötigte der Bierbrauer Alois Neumeier (Nr.1/Waldschmidtstraße 14) für die Lagerung seines Bieres einen Eiskeller. Die Arbeiten dafür führte der Maurermeister Franz Zimmermann aus.Eine Kegelbahn gebaut
Um den Betrieb seines Gasthauses gerade an den Sonn- und Feiertagen zu beleben, hatte Neumeiner schon zwei Jahre zuvor eine Kegelbahn bauen lassen.
Franz Leitermann von Blumengasse 10 (ehemals Nr. 55) erweiterte 1888 seinen Stall. Die Arbeiten führte der Maurermeister Johann Heinrich von Kleinaign aus.
Im Jahr darauf war Heinrich baulich für die Erweiterung des Friedhofes um ein Teilstück des sog. „Mirtlgartens“ zuständig.
1892 wurde die „Herstellung eines Schullokals im Rathause“ in Auftrag gegeben, da die schulische Einrichtung unmittelbar daneben aus allen Nähten platzte. Erst 1896 wurde die heutige sog. „alte Schule“ anstelle der Vorgängereinrichtung erbaut (siehe Artikel "Die alte Schule wurde erst im Jahre 1896 erbaut").
Um dieselbe Zeit ließ der oben schon genannte Bäcker Georg Hastreiter (Marktstraße 2) sein Haus um ein zweites Stockwerk erhöhen.Auch kleine Baumaßnahmen mussten amtlich genehmigt werden, darunter finden sich zahlreiche Anträge auf Neubau jeweils schon vorhandener Backöfen. Viele Beispiele davon finden sich heute noch bei den einzelnen bäuerlichen Anwesen im Hohenbogen-Winkel. Zu den kleinen Maßnahmen gehörten auch die ständigen Reparaturen an bereits vorhandenen Viehställen, wobei es sich dabei um kleine Anlagen handelte, da die Marktbürger aufgrund ihres begrenzten Grundbesitzes jeweils nur wenig Vieh halten konnten.
Eine Villa entsteht
Im Jahr 1897 ließ der Bürger Joseph Lenk anstelle der ehemaligen Schreinerei Kaufmann (damals Nr. 31; nun Burgweg 2) – das alte Gebäude wurde dafür abgerissen - die sog. „Ranklvilla“ im Stile des damals gerade vorherrschenden Historismus erbauen. Nach seiner Fertigstellung glich der ganze Bau einer Villa aus der Gründerzeit, wie wir sie noch heute in größeren Städten vielfach bewundern können; deshalb auch der Name „Ranklvilla“, benannt aber nach den späteren Besitzern, der Familie Stöberl (vulgo Rankl). Gegenüber den ländlich geprägten Häusern des Marktes nahm um 1900 dieses Haus von seinem Stil und der Bauausführung her eine absolute Sonderstellung ein (siehe Artikel "Die "Villa" an der Kirchhofmauer").
1897 entstand das Anwesen Nr. 77, nun Further Straße 19. Bauherr war der Straßenwärter-Oberaufseher Joseph Zwack, geb. 1863 in Oberköblitz, Bezirksamt Nabburg. Aus beruflichen Gründen kam diese Familie in den Markt.
Im gleichen Jahr ließ der Handelsmann Josef Baumann (Nr. 31, nun Waldschmidtplatz 1) seinen Kaufladen neu erbauen, heute das Textilgeschäft Brey.Zwei Jahre später, am 24. Juli 1899, stellte Pfarrer Johann Frisch den Antrag, eine Kapelle erbauen zu dürfen. Der Bau scheint sich nicht realisiert zu haben, denn eine Fertigstellung wird nicht genannt. Frisch stand der Pfarrei Eschlkam von 1897-1923 vor.
Am 11. November 1905 wurde dem Gemeindediener Wenzl Hastreiter amtlich erlaubt, sich ein Wohnhaus zu erbauen. Bereits am 25. Juli 1906 war der Bau bezugsfertig, hergestellt von dem Maurermeister Zimmermann. Hastreiter konnte in sein neues Haus einziehen. Vorher wohnte er beengt im Totengräberhaus (Kirchstraße 10), da er zugleich auch als Totengräber arbeitete.
Der Müller Georg Penzkofer hatte 1908 eine größere Baumaßnahme bei seiner Schneidsäge vorgenommen. Näheres dazu sagt uns das Protokoll nicht.
Ein Jahr später, 1909, errichtete Franz Waitzer als Bauherr sein Wohnhaus selbst. Es ist das Anwesen Kleinaigner Straße 7, früher die Nr. 9.
Sogar kleinere Baumaßnahmen waren damals bereits meldepflichtig. So ließ Karolina Lackerbauer in ihrem Anwesen im gleichen Jahr die „Aborte“ (Toiletten) erneuern. Vier Jahre zuvor hatte sie das Anwesen (Nr.25/Waldschmidtplatz 8) von ihrem Mann übernommen.Resumee: Auf die industrielle Entwicklung, das enorme Bevölkerungswachstum im Lande und die damit einhergehende Erweiterung der Städte und Märkte wurde vor allem in den Jahren nach 1870 mit der Einführung von regelnden Gesetzen reagiert, die sich allgemein unter dem Titel „Baurecht“ zusammenfassen lassen. Diese neuen Verordnungen ermöglichen es seitdem den Gemeinden Baugenehmigungen, aber auch Bauverbote zu erlassen. Zugleich kann entscheidend Einfluss auf die jeweiligen Vorstellungen der Baubewerber genommen werden, wenn es gilt das Ortsbild zu wahren. Darauf wurde vor weit über 100 Jahren auch im Markte Eschlkam geachtet.
Werner Perlinger
Lederermeister Simon Moreth baut eine „Aschenwerkstätte“
+Eschlkam. Das Anwesen Nr. 42, nun Blumengasse 7, ist seit langer Zeit schon im Besitz der Familie Moreth. Der „concessionierte Lederer Simon Moreth, geb. 1797, verheiratet mit Barbara Aschenbrenner, Schmiedtochter aus der Stadt Furth, kaufte von Elisabeth, der Witwe des Rotgerbers Georg Vetter, im Jahr 1827 das Anwesen in der damals als „Hoderngasse“ benannten steilen und teils engen Gasse, die zur Marktstraße führt. Im Jahr 1837 durfte er nach Anfrage bei der Marktgemeinde das nun erworbene Haus „um 4 Zimmerbäume“ erhöhen, „um auf diese Art einen anständigen Trockenboden für sein rauhes Lederwerk zu erlangen“. Außerdem sollte die bisherige Legschindeldachung in gleicher Art wieder aufgesetzt werden. Einwendungen dagegen hatten die Nachbarn Andre Pohmann (Nr. 54/Blumengasse 12) und Andreas Fritz (Nr. 53/Blumengasse 14) nicht. Sie erkannten die Bauabsicht Moreths als notwendig an. Das Anwesen selbst war schon immer in Besitz von Lederern oder Gerbern. Die einzelnen Besitzer, beruflich stets als Gerber oder Lederer genannt, lassen sich bis weit in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen, daher auch der frühere und ständige Hausname „beim Lederer“.
Einige Jahre später, 1844 am 12. April, stellte Moreth den Antrag eine „Aschenwerkstätte“ erbauen zu dürfen. In jetziger Zeit spricht man stattdessen von „Äscherei“, einer Einrichtung, in der die für die Gerber notwendige Pottasche hergestellt wurde. Pottasche, bekanntlich seit jeher gebraucht für die Glasherstellung, war auch wichtig für die Enthaarung der Felle. Die Pottasche, eigentlich als „Topfasche“ durch Eindampfen von Holzaschelösungen im offenen Topf gewonnen (daher der Name), eine weißlich kristalline bis derbe Masse – wird chemisch als Kaliumkarbonat bezeichnet. Behandelt mit der Pottasche, wurden früher die Haare von dem auf dem Scherbaum gespannten Fell mit dem Scherdegen, einem speziellen Schabmesser, entfernt.
Der „bürgerliche Lederermeister Simon Moreth hat vor, außerhalb des Marktes nahe dem Chamb eine solche Werkstätte zu errichten. Sie sollte 30 Fuß lang, 18 Fuß breit und die Umfangsmauer 11 Fuß hoch sein“. Ein Fuß entspricht als Längeneinheit ca. 30 cm. Errichtet sollte sie auf „Gemeindegrund (werden), der an dem Kamp-Wasser im Burgfrieden liegt“. Vor versammelter Gemeinde stellte Moreth sein Vorhaben vor und betonte, dass „er eine solche Leder- und Aschenwerkstätte zu seinem Gebrauch sehr notwendig hat“. Er bat daher ihm dafür ein „Gemeindeplatzl zu überlaßen und hat auch sein Angrenzer Anton Sämer, Weißgärber in Eschlkam (Nr. 44/Kleinaigner Straße 25), mit Ausführung dieser vorhabenden Leder- und Aschenwerkstatt am Kamp Fluße nichts darwider“.
Allein der angrenzende Nachbar Andrä Seidl von Haus Nr. 56 (Blumengasse 8) wandte ein, seiner „daran anstoßende Wiese wird durch den geplanten Bau das Heu und Grummet verunreinigt und verdorben“. Das Haupthindernis aber zeigte sich nach Aussage des Joseph Späth (Nr. 5/ Further Straße 3), „per anno Bräuvorgeher (in diesem Jahr wohl Sprecher des Communbrauerverbandes) und beigezogener bräuender Bürger, daß von dieser Aschenwerkstätte das Kampwasser für das Communbrauhaus zum Gebrauch des Siedens unrein und auch die Fahrt des Wasserbeiholens zum Flusse gehemmt wird (durch den Bau im Wege steht)“.
An den einzelnen einwendenden Ausführungen ist zu erkennen, dass schon damals, als erste kleine industriebezogene Vorhaben am Lande geplant wurden, die davon betroffenen Menschen umweltschützende Argumente dagegen vorbrachten, wenn auch vorerst nur aus persönlicher Betroffenheit.
Die Monate gingen ins Land, erst am 26. Juni 1844 wurde in dieser Angelegenheit eine Entscheidung getroffen: Moreth durfte auf dem „von den Georg Hastreiter’schen Relikten (wohl Marktstraße 2) erkauften Gemeindegrund – Zugabe zu ihrem anno 1803 erhaltenen Gemeindetheil – eine Aschenlederer Werkstätte“ in der gewünschten Art erbauen. Als „Angränzer“ waren erschienen:
1) Franz Kerscher, behauster Bürger (Nr. 48/Blumengasse 24) und
2) die Hackerischen Relikten, beide von Eschlkam, welche unbedingt einwilligen.
3) Andre Seidl, angehender Bürger, welcher unter dem Beding einwilligt und auch einverstanden ist, falls die fragliche Aschenleder Werkstätte 5-6 Schuh von seinem anstoßenden Ackerl entfernt wird und zu stehen kommt, was Simon Moreth zusichert.
Diese Entscheidung wurde dem Moreth bekannt gegeben und „ihm zugestellt, die distriktspolizeiliche Bewilligung ab (von) Seite des königlichen Landgerichts Kötzting (heute wäre es das Landratsamt) gehorsamst nachzusuchen“.
Es unterschrieben diesen Akt als „Angränzer“ Franz Kerscher, Katharina Hacker (mit drei Kreuzen als Handzeichen) und Andrä Seidl. Als „Beyständer (Zeuge) fungierte Ignatz Schmirl (Nr. 72/Marktstraße 12). Letztlich unterschrieben den Akt noch der gerade amtierende Bürgermeister Kaufmann (Schreiner in Nr. 31/Burgstraße 2) und letztlich Simon Moreth als Antragssteller.
Das sog.“Lederer-Haus“ wurde im Jahr 2020 abgebrochen. Erwähnenswert sei noch, dass der Name „Moreth“ eine vom Dialekt her entwickelte Form von „Moritz“ sein dürfte. Der Vorname „Moritz“ selbst hat seine Wurzel im lateinischen Namen „Mauritius“, in unserem Lande insoweit nicht ungewöhnlich, als Mauritius auch Patron des alten Klosters Niederaltaich ist, dessen Traditionen bis in die Mitte des 8. Jahrhunderts reichen.
Werner Perlinger
Grenzen des ehemaligen „Pestleichenhofes“ wurden 1837 neu festgelegt
+Eschlkam. Allerseelen, das Gedenken an die verstorbenen und in unseren zwei Friedhöfen beerdigten Angehörigen und Mitbürgern, ist vorbei. Darauf rückblickend sei an eine alte über Jahrhunderte existierende Friedhofsanlage im Marktbereich erinnert wie folgt: „Die Vermarkung des Pestleichenhofes zu Eschlkam betr.“, lautet der Titel eines Aktes aus dem Jahr 1837, niedergelegt im Marktarchiv. Die Entstehung des heutzutage genannten „Pestfriedhofs“ geht in der Geschichte des Marktes weit zurück: Es war dies die landläufig als „Pest“ bezeichnete Seuche, einer der drei apokalyptischen Reiter, der auch in Eschlkam und im gesamten Hohenbogen-Winkel in der ersten Hälfte des Jahres 1634 nach einem für den Markt und seine Bevölkerung verheerenden Schwedeneinfall viele Todesopfer forderte. Die genaue Zahl der Toten wissen wir nicht. Meist war von dieser Seuche, der sog. Beulenpest, etwa die Hälfte der Bevölkerung einer Kommune hinweg gerafft worden, so die Schilderungen aus nahe gelegenen Orten wie Furth oder Arnschwang. Die dortigen Zahlen dürfen getrost auch auf die davon östlich gelegenen Gebiete angenommen werden, wie für Eschlkam und Neukirchen. In Furth wurden die Toten außerhalb der Stadt im Bereich eines bereits bestehenden Seuchenfriedhofs an der Hochstraße unmittelbar neben der heutigen Kreuzkirche beerdigt. Ebenso wurden in Eschlkam die zahlreichen Toten aus Angst vor Ansteckung und Wiederkehr der Seuche, auch wegen der räumlichen Enge im bestehenden Friedhof nördlich der Pfarrkirche, damals in einem eigens weit außerhalb des Marktes angelegten Pestfriedhof beerdigt, heute der sog. neue Gottesacker.
In der Kammerrechnung von 1706 wird ein Acker beim „Infections Freudthof“ (Pestfriedhof) genannt, den der damalige Marktschreiber nutzen konnte. Ansonsten sind schriftliche Hinweise über diesen Friedhof eher rar. Erst im Jahr 1836 taucht dieses Grundstück urkundlich näher fassbar auf. Am 7. November wurde vom Königlichen Landgericht Kötzting angeordnet, „daß der der Pfarrgemeinde Eschlkam zugehörige, in den frühesten Zeiten zu einem Pestleichenhofe bestimmte Wiesgrund durch Markung von den Eingriffen der Adjacenten (Anlieger) gesichert werde“. Der Magistrat erhält die Weisung, „4 Ecksteine durch einen Steinmetz binnen 14 Tagen hauen zu lassen“. Zugleichen waren die Namen der „Anstößler“ zu melden. Diese waren der Ökonom Wolfgang Stauber (heute Marktstraße 2) und die Witwe des Franz Leitermann (Waldschmidtstraße 10). Monate später, am 23. März 1837, forderte das Landgericht „zur Abmarkung des Pestleichenhofes“ zum 1. Juni eine Kommission zu bilden, bestehend aus einer „magistratischen Deputation“ und den beiden Anliegern. Der Königliche Landrichter (Georg) Nagler (1833-38) ließ dann am 6. Juni ein sog. „Grenzvermarkungsprotokoll“ anlegen. Die umfangreiche Niederschrift beginnt mit dem Hinweis, dass an der Begehung des Geländes teilnahmen der Ortspfarrer Wolfgang Kolbeck (1828-1843), eine „Deputation“ des Magistrats, bestehend aus dem Bürgermeister und Schreiner Michael Kaufmann (Burgstraße 2) und des Magistratsrates Andre Pohmann (Blumengasse 12), dann die schon genannten Anlieger Wolfgang Stauber und die Witwe Leitermann, letztlich der Marktdiener Franz Pinzinger und sein Bruder Jakob „als Gehülfe und Taglöhner“.
Die Grenzen festgelegt
Die so Versammelten begingen „die Grenzen des Pestleichenhofes“. In Übereinstimmung mit den Anliegern wurde die Art und Lage der „Gränzbestimmung“ festgelegt. Demnach liegt dieser Friedhof 150 Schritte außerhalb des (damaligen) Marktes „auf einer freyen und luftigen Anhöhe, die Schloßerhöhe genannt“, begehbar durch einen Fußpfad und zwischen dem Felde des Wolfgang Stauber und des Franz Dänzl (Bräuhausgasse 1) führte dann ein drei Fuß breiter zum Pestleichenhof gehöriger „Rain“. Dieser Rain (Weg und zugleich Flurgrenze) nebst dem Pestleichenhofe gehört der Gemeinde. Der Platz selbst wurde für die vielen Toten „nach einem in dem alten pfarrlichen Saalbuche aufgefundenen und hier abschriftlich beigefügten Dokumente im Jahre 1601, in welcher Zeit die Pest regierte, und die ganze Pfarrey bis auf 21 Familienväter ausgestorben ist, zu einem Begräbnisplatze bestimmt“. Im Datum für die Epidemie irrte sich der damalige Verfasser (siehe oben).
Das Protokoll schildert weiter, dass dieser Platz, lange Zeit ein „öder Wiesfleck“, später – ein Datum kann nicht genannt werden – mit vier Bäumen bepflanzt „und daselbst ein Kreuz aufgerichtet“ wurde. Nach erneuter genauer Abmessung und in Berücksichtigung der Meinung und Feststellung der Adjacenten wurde erkannt, dass die westliche wie östliche Seite 85 Schuh und die südliche wie nördliche Seite des auszumessenden Grundstücks 68 Schuh betragen – insgesamt also 5780 Schuh im Quadrat. Das Längenmaß „Schuh“ ist mit ca. 0,3 Meter anzusetzen. Demnach betrug die Fläche des alten Pestfriedhofs im 19. Jahrhundert ca. 645 Quadratmeter.
 Vier Linden gesetzt
Vier Linden gesetzt
Nachdem alle Teilnehmer der Begehung sich mit diesem nun gewonnenen Ergebnis der „Gränzbestimmung“ einverstanden erklärten, konnten der Marktdiener Pinzinger und sein Bruder und Taglöhner Jakob die „eingeschlagenen Pflöcke ausreißen und in die ausgehauenen Vertiefungen die Belage zu 4 Ecksteinen und 2 Läufern mittels eigens dazu behauenen Ziegelsteinen einlegen und die auf dem Platze schon vorhandenen 4 Ecksteine und 4 Läufer (in der Art) einsetzen, daß die beiden Läufer der Längsseite 42 ½ Schuh von jedem Eckstein, die Läufer der beiden Breite-Seiten 34 Schuh von den Ecksteinen abstehen“. Angemahnt wurde auch „jeder Verstümmelung der auf dem Leichenhofe stehenden 4 Linden strengstens zu enthalten“. Diese vier Linden – die letzte Linde musste altershalber nach 1960 entfernt werden - markierten in alter Zeit in etwa wohl auch die Grenzpunkte des Friedhofs aus der Pestzeit. Das Protokoll unterschrieben alle Teilnehmer.
Dieser hier abgehandelte sog. „Pestleichenhof“ war vor Anlegung des neuen jetzigen Gottesackers nahe der Umgehungsstraße, geschehen nach dem 2. Weltkrieg ab 1945/46 unter Pfarrer Josef Pongratz und ummauert 1988 unter Pfarrer Johann Fischer, dessen räumlicher Ausgangspunkt. Zugleich bildet er den nördlichen Bereich.
Bildtext: Der Pestfriedhof ist in der Karte der Erstvermessung von 1831 eingezeichnet. Das Grundstück im Bereich der „Schlosserhöhe“ trägt die Flurnummer 75.
Werner Perlinger
Vor 600 Jahre erlebte der Markt Eschlkam eine Brandkatastrophe
+Eschlkam. Im ausgehenden Mittelalter waren in der römisch-katholischen Kirche des Abendlandes viele Missstände ausgebrochen, die allenthalben Kritiker auf den Plan riefen. Einer von Ihnen, der einen verhältnismäßig hohen Bekanntheitsgrad noch heute besitzt, war der tschechische Reformator Jan Hus. Hus wurde, nachdem er vor dem Konzil in Konstanz am Bodensee seine Thesen nicht widerrief, am 6. Juli 1415 als sog. Ketzer auf dem Scheiterhaufen lebendig verbrannt.
Hus war wegen seiner Predigten beim Volk ungemein populär. Sein Tod entfachte in Böhmen, in der es schon länger starke soziale Spannungen gab, eine starke religiös-nationale Bewegung. Die Flammen seines Scheiterhaufens setzten unverzüglich das ganze Reich in einen verzehrenden Brand. Davon war etwa 15 Jahre lang auch die Region des Hohenbogen-Winkels betroffen, was zur Vernichtung vieler kleiner Siedlungen und teils auch zur zeitweisen Verödung größerer Orte führte. Sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war aufgrund der Nähe zu Böhmen der Markt Eschlkam, damals sogar Sitz eines Landgerichts. Dort übte in herzoglichem Auftrag bereits seit dem 13. Jahrhundert ein Landrichter die hohe Gerichtsbarkeit für die ihm anvertraute Region aus. Beigegeben war ihm seit dem 14. Jahrhundert ein sog. Pfleger, der seinen Sitz in der damaligen Burg Kleinaign hatte. Diese Pfleger, meist aus dem Ritterstand genommen, waren als Vertreter des Herzogs u. a. militärische Befehlshaber über das jeweilige ländliche Aufgebot im Bezirk des Landgerichts. „Eschelkam. „Coemeterium hoc est munitum in modum castri, et sunt plures domus in eo...Eschlkam, der Kirchhof (Friedhof) ist befestigt gleich einer Burg, und es befinden sich mehrere Gebäude in ihm“, so lautet eine amtliche Beschreibung aus den Jahren noch vor der nun zu schildernden Zerstörung.
Der große Einfall 1422
Der erste große hussitische Einfall in den Hohenbogen-Winkel – vorangegangen waren bereits kleinere Überfälle - ereignete sich im Jahr 1422, am 22. Februar. Die Überlieferung dazu lautet: „Zum ersten Anno vicesimo secundo (im Jahre 22) predicto Dominica Esto mihi (am vorgenannten Sonntag Esto mihi) do komen die Hussen mit großer menig volkes uber walt (der breite Grenzwaldgürtel) in meins gnedigen Hern lant und verpranten do vor dem wald Eschelkam Newnkirchn und wol XII dorffer damit und namen do den arme Lewten ir viehe und gut...“. Diese Schilderung lässt einen größeren Raubzug mit Niederbrennung der Märkte Eschlkam und Neukirchen erkennen. Das geraubte Vieh war neben Getreide wohl das Hauptziel des hussitischen Kontingents, da bereits zu Anfang der Wirren in Böhmen die dortige Versorgungslage mit Fleisch und Getreide katastrophal war. Die Namen der zwölf Dorfschaften sind nicht genannt. Ich vermute die Siedlungen im Umfeld der zerstörten Märkte, im hinteren Bereich des sog. Winkels.
Noch am Tage des Bekanntwerdens des Einfalls unternahm die Regierung in Straubing Anstrengungen, um in das verheerte Gebiet Ruhe und Sicherheit zu bringen: „Do vordert mein Herr der Vitzdom (aus „vice dominus“, der Vertreter des Herzogs) meins gnedigen Herrn Rete (die Ministerialbeamten) und Lantschafft (Vorläufer des Landtags) und wurden do zu Rat und eynig, daß man die Kirchhof (befestigte Friedhöfe) besetzen, beschutzen und verwaren solt“. „60 Reisige“ (gerüstete Krieger) werden von Herzog Johann von Neumarkt nach Cham gelegt, um gegen das taboritische Taus vorzugehen, denn sehr wahrscheinlich kamen die Hussiten des 22. Februar aus dem Tauser Raum. Allein 65 Berittene werden sogleich in den Winkel als Schutztruppe geschickt und auf die einzelnen Wehranlagen verteilt. Gleichzeitig wurden 15 Schützen auf den Kirchof zu Kötzting nach dem Einfall vom Sonntag Esto mihi (22. Februar) an einen Monat lang bis Letare (22. März) eingelegt. Auch wurden Pfeile, Pulver und Hantpuchssen (erste Vorläufer der Gewehre) nach Eschlkam und Neukirchen geliefert.
Schließlich wurden vom 5. März an bis 1. September 1422 sogar 120 berittene Krieger in den Winkel geschickt, um von da aus „die Hussen zu beschedigen. Sie thaten da großen Schaden mit name (Raub) und Prannt in Beheim“. Zudem wurden Neukirchen mit 20 Schützen und Eschlkam mit 10 Schützen „von Cantate (10. Mai) bis Johannes Baptiste (24. Juni) belegt und so verwahrt“. Das sind nur einige der Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gewesen.
Ende Oktober ließ dann der „Vitztum den Peyerlein, Sturmb und einen Stainer nach Straubing kommen“ und sagte ihnen, dass „sy ir(e) freythof (die besagten Kirchhöfe in Eschlkam und Neukirchen, wohl auch den in Furth) selber sollten verwahren wann er nymand mer solden (bezahlen) wolt“. Im Jahr 1423 erfolgte kein hussitischer Einfall. Für die Hussiten war im Hohenbogen-Winkel vorerst nichts mehr zu holen.
Die Lage der Bewohner
Wie war nun die Lage der Zivilbevölkerung nach dem großen Überfall von 1422? Wir dürfen annehmen, dass die eh in nicht großer Zahl vorhandenen Anwesen, erstellt wohl fast völlig in Holzbauweise, niedergebrannt und zerstört waren. Stark mitgenommen waren auch die Anlagen der befestigten Friedhöfe in der Region. Weitere Einfälle in den Hohenbogen-Winkel erfolgten bis etwa 1433 und noch lange danach während der bayerisch-böhmischen Adelsfehden. Der Markt Eschlkam war seit dem angeführten Überfall längere Zeit stark zerstört, denn noch 1452 bat der Rentmeister (der höchste Beamte im Herzogtum) Heinrich Vinder die herzoglich-staatliche Verwaltung „daß man Eschelkamb solt pawen den Turn und mauern unfarn (die Kirchenburg mit Mauern umgeben) dadurch die arm läut (= die steuerpflichtige Bevölkerung) dahin ein zueflucht hetten...“. Im gleichen Schreiben wird auch der Vorschlag gemacht, Eschlkam (hier die Marktsiedlung) zu befestigen „daß (die) arm Leut mit irm Leib und Gut ain zuflucht darzue haben“. Diese neuen Anlagen erschöpften sich lediglich in Palisadenzäunen wie uns die früheste Ansicht des Marktes von 1514 bestätigt. Wie schwer sich der Wiederaufbau über die Jahre gestaltete, überliefert eine Steuerliste vom Jahr 1477, also 25 Jahre nach Vinders Bitte. Nur 16 bis 17 Anwesen konnten steuerlich veranlagt werden.
Werner Perlinger
Holzrechte am Hohenbogen – einst regelmäßig genutzt von den Marktbürgern
+Eschlkam. Holz bedeutete früher – mehr als heute – einen sehr wertvollen Besitz, noch dazu sich dieser auch nach intensiver Nutzung über Jahrzehnte stets immer wieder erneuerte. Aber eines darf gesagt werden: gerade in heutiger Zeit, wo wir zuschauen müssen, wie durch vorerst nicht beeinflussbare drastische Veränderungen infolge des Klimawandels ganze Waldbereiche zugrunde gehen, erkennen gerade die davon betroffenen Menschen welchen Wert die Materie Holz als nachwachsender wertvoller Rohstoff haben kann und eigentlich schon immer hatte.
Zu diesem Thema ein Blick weit zurück: Den Titel „Den Holz:schlag in dem Churfürstlichen Hochwaldt Hochen=Pogen so andres betreff de anno 1626“ trägt ein umfangreicher Akt, niedergelegt im Marktarchiv, dessen Inhalte über einen langen Zeitraum hinweg die Holzrechte der Marktbürger in diesem damals weitgehend dem bayerischen Staat gehörenden Bergmassiv betreffen. Aufgeführt sind ab dem Jahr 1626 hauptsächlich die häufig vorkommenden Streitigkeiten über den Holzbezug zwischen der Marktbürgerschaft und den Seligenthaler Bauern, deren Siedlungen am Fuße des gewaltigen Bergstocks liegen. Zum Kloster Seligenthal in Landshut, im Jahr 1232 gegründet von der bayerischen Herzogin Ludmilla, vormals verheiratet gewesen mit dem Grafen Albrecht III. von Bogen, der noch vor 1200 auf dem heutigen Burgstall eine repräsentative Burganlage erstellen wollte, gehörten diese Dörfer und Einöden bis zur Säkularisation sämtlicher Kirchengüter im Jahr 1803.
Wie die Inhalte der Schriften erkennen lassen, fehlte es vor allem in den Steilhängen des Hohenbogen noch vor und auch lange noch nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) an den nötigen Grenzzeichen, welche die Besitzzugehörigkeiten zum bayerischen Staat, dem Kloster oder zu einer Gemeinde hätten klar erkennen lassen.
Für den Leser interessant sind einzelne sog. „Spezifikationen“, die den Holzbezug der Eschlkamer Bürgerschaft überliefern, so beispielsweise für das Jahr 1697. Dabei fallen die jeweils beanspruchten Holzmengen auf. So ließ der Bürger Wolf Sighardt Altmann („Hoamater“, heute Anwesen Gasthof Penzkofer) allein 86 Klafter „Puches“(Buchen)- und 30 Klafter „Tennes“(Fichten oder Tanne)-Holz einschlagen. Bei Hans Lehrnpecher waren es 24 und 10, Simon Stepfel 10 und 6, Wolf Späth, Gastgeber, 20 und 15, Veith Adam Mauser 24 und 10, Hans Späth 15 und 8 und letztlich bei Georg Denzl 10 und 15 Klafter Hart- und Weichholz. 1 Klafter entspricht 3 Ster.
Es folgt dann wie in den anderen gleichen Listen pro Jahr noch der Hinweis: „Anbelangend die anderen Bürger, welche ihnen das Holz in Ermangelung des Fuhrwerchs nit selbsten fihren (transportieren) können, müssens von denen Sällingthallerschen Underthonen die es ebenfals in Hohenpogen schlagen und durch ihren Mennath (Zugtiere) vor die Thür firen, erkauffen. Daher seint ersagte Burger von gemelten Sallingth. Underthonen beileiffige zu erkhauffen womit in die 176 Claffter, Allermaßen es aber soviell / indem ersagte Underthonen auch das Recht sowol als wie in diessen Gehilzen/ als obs die Burger selbsten schlagen und herbeibringen thetten.“ Laut Angabe waren dies 120 Klafter Hart(Buchen)- und 56 Klafter Weichholz (meist Fischte). Zusammen mit dem beanspruchten Holz der Besitzbürger des Marktes wurden im Jahr 1697 in den Waldungen des Hohenbogen 309 Klafter Hart- und 150 Klafter Weichholz geschlagen.
Auffallend dabei ist, dass allein nur sieben Bürger in der Lage waren, das beanspruchte Holz selbst heimzubringen. Sie waren als Landwirte technisch in der Lage dies zu bewerkstelligen, was den übrigen Bürgern – nicht umsonst wurden sie spöttisch manchmal auch als „Schubkarrenbürger“ bezeichnet – mangels Ausrüstung nicht möglich war. Ebenso verwunderlich erscheint, dass der Bürger Altmann ein sehr hohes Kontingent an Holz beanspruchte, was 50 Jahre nach den Verwüstungen im Schwedenkrieg wiederum auf einen gegenüber den anderen Anwesen sehr groß entwickelten Wirtschaftsbetrieb schließen lässt.
Aufklärend für den großen Holzbedarf von insgesamt 1240 Klafter Hart- und Weichholz sowie 10 Stämme als „Spannholz“ und die gleiche Menge an „Pauholz“ allein im Jahr 1754 ist der Hinweis, dass die in dieser Liste insgesamt 62 aufgeführten Bürger als „samentliche Ratsfreund (Markträte) und Preuente Burger, so an der Zahl 62 Mann würklich vorhanden seyent und deren ieder zu seiner Haus nothdurfft, und zu dem Sudwesen das ganze Jahr hindurch an Waich: und Harrten Holz wenigstens 20 Klafter nötig hat“.
Somit erklärt sich die hohe Menge an Holzbedarf allein für den Markt Eschlkam: das meiste Holz, wahrscheinlich hauptsächlich das Hartholz, musste jeder Bürger im Kommunebrauhaus (HsNr. 14) anliefern, wollte er für seinen eigenen Hausausschank vom offiziell angestellten Braumeister eine bestimmte Zahl an „Suden“ von dem damals beliebten Braunbier herstellen lassen. Die Lage was den Holzbedarf betraf, besserte sich erst, als im Jahr 1788 die Bürgerschaft den „Cameralwald Karpfling“, aufgeteilt in viele einzelne „Lust“ (Lose) kaufte und so die Bürger nicht mehr unbedingt auf das Holz vom Hohenbogen angewiesen waren.
Werner Perlinger
„Kaufrechtsverzeichnisse“ informieren über frühe Hausverkäufe
+Eschlkam. Zu den für die Ortsgeschichte inhaltlich aussagekräftigen und so wertvollen Archivalien des Marktarchivs zählt u.a. ein sog. „Kaufrechtsverzeichnis“, das von den jeweiligen Marktschreibern vom Jahre 1700 bis einschließlich 1759 sorgsam, alle dinglich rechtlichen Vorgänge erfassend geführt wurde. Der in Schweinsleder gebundene fast 90 Doppelseiten zählende Band trägt folgende Titulatur: „Kauff Rechts Verzaichnüssen – welcher gehalten Genädigster Landts Herrschafft ab dennen bey alhießig Churfstl. Graniz Pann (Bann) Marcht Eschlcamb sich anbegebenen Laudemiösen Veränderungen die schuldige Kauff-Rechts Gebihrnüssen entrichtet worden von 1700, bis 1759 beedes inclusive.“
Der Titel besagt, dass diese Aufzeichnungen sämtliche in den jeweiligen Jahren erfolgten Haus- und Grundstücksübergänge mit den staatlicherseits dafür in Frage gekommenen Gebühren enthalten. Für die Staatskasse wichtig waren die jeweils aufgeführten „laudemiösen Veränderungen“.
Das „Laudemium“ – ein heute nicht mehr bekannter Begriff - bedeutet das „Abfahrts- und Auffahrtsgeld“, nämlich die Besitzwechselabgabe an den Grundherrn bei jeder Veränderung im Besitz (vergleichbar der modernen Grunderwerbs- und Erbschaftssteuer). Sie betrug meist 5 % des Übergabewertes eines Anwesens und musste sowohl beim Abgang eines Eigentümers wie beim Antritt des neuen bezahlt werden.
Unter dem Begriff „Bannmarkt“ ist ein Markt mit eigenem Magistrat und eigener Jurisdiktion (die niedere Gerichtsbarkeit über Personen und Sachen) innerhalb des „Burgfriedens“ zu verstehen. Dieser ist eine alte rechtliche Gebietsbezeichnung; hier das durch einen präzisen Grenzverlauf eingefriedete Gebiet, das zu einer Stadt oder einem Markt gehört, also der Gemeindebereich. Aus diesem sog. Steuerabgabenbuch seien vereinzelte Vorgänge dem Leser vorgestellt:
Das Jahr 1700 beginnt mit Veith Adam Wurzer, Bürger und Gastgeber. Zeitweise versah er auch den Dienst des Marktschreibers. Er hatte bereits im Jahr 1694 seine jetzige Behausung (Nr. 17/Kleinaigner Straße 4) im besteuerten Wert von 800 f (= Gulden) erworben. Noch aber war er die sog. Laudemiensteuer in Höhe von 5% des Schätzwertes, hier 40 f, dem Staate schuldig. Der über Jahre aufgeschobene Nachlass, worum er gebeten hatte, wurde nun nicht mehr gewährt und so musste Wurzer auch aufgrund weiterer wirtschaftlicher Schwierigkeiten das Anwesen zunächst veräußern. Im gleichen Jahr erwarb käuflich für den nicht geringen Betrag von 1600 f der Bürger Peter Lährnbecher von Simon Stephl dessen „burgerliche Behausung cum pertinentiis“. Der ganze Besitz, der Hof mit Grund und Boden, hier die „Pertinenzien“ (Zugehörigkeit) war amtlich auf 1650 f geschätzt worden. Lährnbecher zahlte zusätzlich 82 f 30 Kreuzer an Laudemien (Besitzveränderungsgebühr). Das Anwesen war einer der „Haimather Höfe“ (Nr. 2/Waldschmidtstraße 10), wobei die dazu gehörenden Feld- und Wiesengründe den Hauptanteil des Kaufpreises bildeten.
Aufgrund des Spanischen Erbfolgekrieges, der auch in Eschlkam nicht spurlos vorüber ging, wurden in den Jahren 1703 bis 1707 keine Rechtsgeschäfte getätigt bzw. protokolliert. Erst 1708 nach dem Todes seines Vaters konnte der Schuster Peter Preu das „hinterlassene bloße Burgerheisl“ (Nr. 16/Bräuhausgasse 1) im Schätzwert von 50 f übernemmen. Vier Jahre später, 1712, konnte Hans Georg Vogl „im Hof“ von seinem Vater Wolfen Vogl das Anwesen mit Feld- und Wiesengründen im Schätzwert von 700 f übernehmen. Dieses Gut (Nr. 37/38/Marktstraße 11) trägt ebenfalls den Hausnamen „beim Hoamater“, da es wohl noch im 17. Jahrhundert von einem der „Haimater“-Höfe abgeteilt wurde. Die Laudemialgebühr betrug 37 f.
Zwei Jahre später, 1714, kaufte der Bürger Hans Maurer von Wolf Sighardt Altmann, damals war dieser auch Eigentümer des heutigen Gasthofes Penzkofer, das „sogenante Rottenhaimbet“ mit sämtlichen dazu gehörenden Gründen um den stolzen Betrag von 1275 f. Der Hausname rührt daher, weil in einer Hausbesitzerliste, angelegt bereits 1534/35, „Wilhalmb Rott“ und „Wolfgang Rott“ als Inhaber des Anwesens Nr. 3/ Waldschmidtdtraße 8 genannt sind. Der Hausname hat sich über Jahrhunderte erhalten. Der sog. „Hoamater“, wie er heute noch genannt wird, ging aus einem der zwei bereits in einer Steuerliste um 1300 genannten zwei großen damals dem bayerischen Herzog gegenüber zinsbaren Hofanlagen hervor.
Franziskus de Paula Schmirl, Wirtssohn und Metzger aus Stachesried, hat durch Heiratscontract (Vertrag) mit der Tochter Anna Regina von Wolf Sighardt Altmann und dessen Frau Rosina die „eingeraumbte Behausung samt den Wiesen und Feldern im Schätzwert von 3375 f im Jahr 1715 an sich gebracht“, heute der Gasthof Penzkofer, Waldschmidtstraße 14. Diese Heirat war längst beschlossen, da wollte der Schwiegervater Wolf Sighardt Altmann einzelne Feld- und Wiesengründe von seinem Anwesen im Wert von 2000 f an die Hofmark Stachesried verkaufen. Jedoch haben am 22. November 1714 der Bäcker Wolfgang Lärnbecher (Nr. 60/Marktstraße 15) und 10 „Consorten“ diese doch umfangreichen Gründe um 2000 f gekauft, damit diese nicht in den Grundbesitz der Hofmark fallen und somit für den Gemeindebezirk Eschlkam für immer verloren gehen. Schmirl hat dann 1715 diese Gründe „uxoris nomine modo retractus an sich gelöst“, so dass er den Besitz Altmanns als Schwiegersohn uneingeschränkt übernehmen konnte.
Bedenken wir, dass damals ein Handwerker wie beispielsweise ein Maurer oder Zimmerer pro Woche bei einem 12 Stunden-Tag nur etwa 1 f verdienen konnte, erkennen wir, wie hochwertig damals Grund und Boden waren. Schließlich bildeten sie die Lebensgrundlage der auf ihnen siedelnden Menschen.
Werner Perlinger
100. Artikel: Einrichtung der Schulen um die Mitte des 19. Jahrhunderts
+Eschlkam. Am 23. Dezember 1802 wurde durch Verordnung des Kurfürsten Max IV. in Bayern die >Allgemeine Schulpflicht< für Kinder vom 6. bis 12. Lebensjahr, am 12. September 1803 die Sonntags- oder Feiertagsschule für Knaben und Mädchen bis zum 18. Lebensjahr eingeführt. Im gleichen Jahr folgte ein allgemein verbindliches Lehrerbildungsgesetz. Mit der einsetzenden Lehrerausbildung - konkret ab 1806 - kamen neue Ideen und konkrete Lehrmethoden in die Schule. Auch konnten seit 1807 die Kinder die doch so notwendigen „approbierten“ (geprüften) Schulbücher benützen. Infolge dessen kamen im Laufe der nächsten Jahre die Markträte zur Erkenntnis, es müsse nun endgültig ein geeignetes Schulhaus gebaut werden. Dafür wählte man einen im Markt von den Straßenführungen her zentral liegenden Platz. Es war dies der, wo damals das „Metzger-Flore-Haus“ Nr. 24 stand. 1824 erwarb nun der „Schulsprengel Eschlkam“ das für die Schulkinder günstig gelegene Anwesen für ein künftiges Schulhaus von dem Metzger Riederer. Die lange schon gewünschte Schule mit Lehrerwohnung konnte darin endgültig eingerichtet werden.
Der Staat wird aktiv
Im Plan der Erstvermessung vom Jahr 1840 ist das Schulhaus eingezeichnet als ein von der Fläche her verhältnismäßig kleines Gebäude, baulich sich anlehnend an das Nachbaranwesen Nr. 23 (Marktstraße 2). Im Westen wie auch südlich zu den Straßen hin waren kleine Gartenflächen vorgelagert. Diese gezeichnete Bausituation entspricht aber keineswegs dem vorhandenen mächtigen Baukörper der sog. „alten Schule“ an der Gabelung der Marktstraße/Waldschmidtstraße. Diese aber wurde erst im Jahr 1896 erbaut (siehe dazu Artikel „Die alte Schule wurde erst im Jahre 1896 erbaut – kein Hinweis im Archiv“).
Im Archiv des Marktes findet sich ein „Inventarium oder Verzeichnis des Schulapparates bei der Schule in Eschlkam“ aus dem Jahr 1842, das nun dem Leser vorgestellt werden soll. Unter „Schulapparat“ verstand man damals all die Einrichtungen und Gegenstände, die für die Abhaltung des Unterrichts von Nöten waren. So befanden sich damals im „Lehrzimmer der II und III Klasse“ sechs Einrichtungsgegenstände wie ein „Crucifix“, ein „Lehrstuhl“ ohne Sitz, 14 Schulbänke, zwei hölzerne schwarze Tafeln, eine „Tagesordnungs Tafel“ und eine Wandtafel für die Freunde der Obstbaumzucht.
Das „Lehrzimmer der 1. Klasse war ausgestattet mit: einem Kreuz, einem kleinen Tisch, 15 Schulbänken, 1 „Setzkasten“ und einer schwarzen Tafel mit Stellage (Ständer). Für die Richtigkeit der Angaben, die wohl an das Landgericht Kötzting als höhere Verwaltungsbehörde zu schicken waren, unterzeichnete Bürgermeister (Michael) Kaufmann (damals als Schreiner tätig in Nr. 31/Burgweg 2) und für die Angaben als verantwortlicher Lehrer (Franz Xaver) Dobler.
Eine nächste Auflistung der Schuleinrichtungen datiert vom Jahr 1858. Die Angaben gleichen sich in etwa. Zunächst wird unter >A< das „Schulzimmer des Gehilfen“ angeführt: so ist dem Stuhl ohne Lehne ein Tisch beigegeben; 15 Schulbänke sind mit „richtigen Tintengläsern“ versehen. Vorhanden sind zwei schwarze Tafeln mit Stellagen, zwei „Musterblätter deutscher Currentschrift“, dann eine schadhafte Wandtafel von „Stepfani“ (???). Erwähnt wird in diesem Protokoll ein „Ofen mit eiserner Platte“ – nötig vor allem für den Unterricht in der kalten Jahreszeit. Neu sind auch ein „Setzkasten“ sowie eine „Stellage von Holz und Draht zum Zählenlernen“ (vielleicht eine sog. Hundertertafel). Der anfangs genannte „Gehilfe“ wurde amtlich gerne auch als „Hilfslehrer“ bezeichnet. Er war dem Schulleiter untergeordnet.
Diesem, im Protokoll unter >B< bezeichnet als „Lehrer“, stand ein „Katheder mit Stuhl“ zur Verfügung. In seinem Klassenzimmer standen 18 „Schulbänke mit nicht hinlänglichen Tintengläsern“. Offenbar waren sie durch längeren Gebrauch schadhaft geworden. Vorhanden waren auch zwei schwarze Tafeln mit den dazu gehörenden Stellagen, dann ein „Kasten (Schrank) zur Aufbewahrung der Schulakten, ebenso ein „erdener Ofen mit eiserner Platte“ – d.h. er war aufgemauert. Im Erdkundeunterricht konnten drei Landkarten benutzt werden. Sie zeigten den Schülern großflächig Europa, Deutschland und Bayern.
Die Hausbibliothek
In einem wohl weiteren eigenen „Schulkasten“ war die Hausbibliothek untergebracht. Darunter waren damals Bücher zu folgenden Themen: ein „Grundriß der Chemie“, eine Anleitung zum Futterbau, Seidenzucht und ihre Behandlung, „Pflichten gegen die Thiere, 2 Jahresberichte (vom) Verein der Thierquälerei, Denksprüche und Sprichwörter, eine Anleitung zum Anfertigen von Geschäftsaufsätzen“, ein „Catechismus der Obstbaumzucht“, Briefe für Kinder nebst einigen Anreden bei Prüfungen. Dazu kam noch eine Verordnung vom 15. Mai 1857, „die Bildung der Schullehrer im Königreich Bayern“.
Ein Buchtitel lautet: 555 Brief-Themata“, von Georg Wiedemann und Joseph Madel. Dabei war auch eine „Anleitung zum mündlichen und schriftlichen Gedankenausdrucke“ und letztlich ein Buch über die „landwirtschaftliche Buchführung für kleinere Bauernwirthschaften“. All diese hier genannten Bücher dienten von ihren Inhalten her dem Unterricht der sog. „Feiertags- und Werktagsschüler“. Die meisten davon mussten später den Hof oder die meist kleine elterliche Landwirtschaft übernehmen. Interessant ist auch, dass es damals in Eschlkam eigens einen Verein gab, der auf eine ordentliche Behandlung der Haustiere achtete.
Als Zugänge an Einrichtungsgegenständen werden noch genannt: grüne Fenstervorhänge samt drei Vorhangstanden, „eine Waßerboding“, eine neue Schulbank sowie letztlich das „Bildnis s. k. Majestäten König Max II und Königin Maria“.
Abgeschlossen wurde das Protokoll vom „Magistrat Eschlkam als Schulfondsverwaltung“ am 30. September 1858. Es unterschrieben Bürgermeister Schreiner und Marktschreiber Reitinger.
Werner Perlinger
Als es galt den alten Friedhof zu erweitern
+Eschlkam. Bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und, wenn es möglich war, noch während der Hussitenkriege werden in unserem bayerischen Grenzbereich zu Böhmen die vorhandenen Kirchen regelrecht befestigt. Es entstehen anstelle der herkömmlichen Burganlagen der Adeligen (z. B. Kleinaign, Lichteneck, Runding, Haidstein) in den Grenzorten sog. Kirchenburgen oder befestigte Friedhöfe wie in Furth, Eschlkam, Neukirchen und Lam; im damals angrenzenden pfälzischen Gebiet in Gleißenberg, Dalking und Arnschwang. In unserem Grenzraum galten die Kirchen nicht nur aus dem religiösen Empfinden der Bevölkerung heraus als das schützenwerteste Gut, sondern auch weil sie in erster Linie stets ein Ziel räuberischer Einfälle waren. So waren sie ein Refugium für die schutzlose Bevölkerung. Dadurch aber waren aufgrund der engen Bebauung, stammend aus einer Zeit, als die Bevölkerung noch gering war, für den jeweiligen Friedhof, der seit der Christianisierung im frühen Mittelalter stets um die jeweilige Kirche anzulegen war, kaum Erweiterungsmöglichkeiten gegeben. Ähnlich ergab sich im Laufe der Zeiten auch in Eschlkam diese sich mehrmals wiederholende Situation.
 Die Fläche, welche die ehemalige Kirchenburganlage in Eschlkam einst einnahm, begrenzt heute noch die 0,8 bis 1 ¾ m starke Mauer des Friedhofs, die im Grundriss ein Trapez bildet. Die Mauern sind aus Bruchstein aufgeführt, im Kern die alte, die einstige Wehranlage mit Kirche umschließende Ringmauer. Der älteste Teil für die Bestattungen war das Areal nördlich des Gotteshauses. Südlich der Kirche finden sich bei Grabaushebungen oft völlig erhalten noch die Grundfesten als verbliebene Reste der ehemals oberirdischen Mauerzüge des einstigen Pflegerhauses. Der früher das ganze Ensemble umlaufende Graben ist nicht mehr erkennbar, da das Gelände bereits teils seit dem frühen 18. Jahrhundert aufgefüllt und seitdem bebaut ist.
Die Fläche, welche die ehemalige Kirchenburganlage in Eschlkam einst einnahm, begrenzt heute noch die 0,8 bis 1 ¾ m starke Mauer des Friedhofs, die im Grundriss ein Trapez bildet. Die Mauern sind aus Bruchstein aufgeführt, im Kern die alte, die einstige Wehranlage mit Kirche umschließende Ringmauer. Der älteste Teil für die Bestattungen war das Areal nördlich des Gotteshauses. Südlich der Kirche finden sich bei Grabaushebungen oft völlig erhalten noch die Grundfesten als verbliebene Reste der ehemals oberirdischen Mauerzüge des einstigen Pflegerhauses. Der früher das ganze Ensemble umlaufende Graben ist nicht mehr erkennbar, da das Gelände bereits teils seit dem frühen 18. Jahrhundert aufgefüllt und seitdem bebaut ist.
Den Hauptzugang bildet heute noch der zweigeschossige Satteldachbau des Torhauses in der Südost-Ecke mit seinem als Rundbogen gestalteten Tor aus Hausteingewände, dahinter eine flachgedeckte Durchfahrt. Im Volksmund heißt dieser uralte Bau „der Kobel“ (einst die Nr. 28), einmal weil früher von außen eine Treppe in das obere Stockwerk führte und wohl auch wegen seiner räumlichen Enge. Trotzdem diente er früher manchmal als Wohnung des „Diskantisten“ (Organist). Links neben dem Toreingang springt die Friedhofsmauer ca. 9 Meter nach Süden vor und dokumentiert so den Vorgang einer Erweiterung der Anlage nach Süden zu, denn im Plan der Erstvermessung von 1831 (siehe Bild) bilden die damalige Mauer und der südliche Toreingang noch eine Linie. Diese Erweiterung, baulich durchgeführt im Jahr 1889 auf einem Teil des sog. „Mirtlgartens“, sei in Folge dargestellt:
Für 500 Mark gekauft
Um den Friedhof erweitern zu können, kaufte die Pfarrkirchenstiftung bereits im Jahr 1888 von Karolina Späth einen Teil dieser Gartenfläche. Die für die Kirchenverwaltung nicht geringe Bezahlung erfolgte das Jahr über in drei Etappen. Am 25. Oktober bestätigte die Späth „für einen neuen Friedhofsplatz aus den Mitteln der Pfarrkirche Eschlkam fünfhundert Mark“ erhalten zu haben, so der Inhalt der Kirchenrechnung, niedergelegt im Pfarrarchiv.
Am 30. April 1889 informierte das Landgericht Kötzting den Markt, die kgl. Regierung habe angeordnet, dass die „durchschnittliche Sterblichkeitsziffer in der Sepulturgemeinde festgestellt wird“. Tabellarisch und übersichtlich sei festzustellen, wieviel Leichen von Kindern und anderen Personen bis zum vollen 16. Lebensjahr, dann von Personen über 16 Jahre aus dem Pfarrsprengel“ im Laufe von 10 Jahren zu beerdigen waren. Die angelegte Statistik von 1879-1888 zeigt, dass bis auf einem Fall in diesen Jahren meist erheblich mehr Kinder und Jugendliche als wie an Erwachsenen ihr Leben ließen, im Schnitt etwa um die 80 Personen.
Am 21. Juli 1889 musste der Bauplan an die Regierung in Landshut eingereicht werden, denn die Regierung übte in solchen Fällen auf die Gemeinden in erster Linie wegen Einhaltung der Hygenie Druck aus. Zugleich wurde die „Umtriebszeit“ (Dauer der Verwesung) für Erwachsene auf 10 Jahre und für Jugendliche unter 16 Jahre auf 6 Jahre festgelegt. Die Baumaßnahme selbst war auf etwa 700 bis 800 Mark geschätzt worden. Der eingereichte Bauplan wurde am 25. Juli 1889 genehmigt. Am 2. September begannen unter der Regie von Maurermeister Johann Heinrich von Kleinaign die Bauarbeiten. Am 13. September meldete der Markt dass die Arbeiten „nahezu vollendet sind“. Beendet wurden sie am 28. September. Zugleich sah sich die Kirchenverwaltung veranlasst das Bezirksamt zu bitten, den Termin für die Rechnungsstellung doch bis zum Frühjahr zu gewähren, da die „Arbeiten in der Hauptsache (wohl) vollendet sind, (aber) erst im kommenden Frühjahr der Verputz des Mauerwerks geschehen könne“.
Der „Mirtlgarten“
Im Plan der Erstvermessung von 1831 zeigt sich der südliche Bereich der Friedhofsmauer in einer Linie noch bündig mit dem Eingang ins Torhaus. Trotz der Erweiterung verblieb vorerst noch unmittelbar neben dem Torhaus die sog. „Heiligenschupfe“ mit der Nr. 75, ein kleiner Stadel, der zur Kirchenstiftung gehörte; abgerissen erst 1906. Das für die Erweiterung der Bestattungsfläche vorgesehene Grundstück trug den damals im Markt geläufigen Flurnamen „Mirtlgarten“. Es hat die Plannummer 119, die im Kataster von 1840 als zum Anwesen Nr. 30 gehörig eingetragen ist. Der Flurname „Mirtlgarten“ bezieht sich auf die Familie Späth von Anwesen (Nr. 57/Blumengasse 4 u. 6) mit dem Hausnamen „Mirtl“. Dieser erinnert an den Vorbesitzer Martin (dialektisch: Mirtl) Fischer. Diese Familie Späth ist verwandt mit der gleichnamigen Familie von (Nr. 30/Waldschmidtplatz 3), nachweisbar im Besitz des „Rueschhauses“ seit 1846.
Karolina Späth, verwandtschaftlich eng verbunden mit dieser Familie und geboren 1847 in Kleinaign als Tochter des „Irlbauern“, heute „Wertl“ (Familie Reimer), taucht später in den Matrikeln der Pfarrei und des Marktes nicht mehr auf. Sie dürfte nach dem Verkauf des Gartengrundstücks bald weggezogen sein. Möglicherweise war es ihr Erbteil.
Werner Perlinger
Die Reinigung des Chambflusses war früher immer wieder nötig
+Eschlkam. Seit ältesten Zeiten war für die Bürger in Eschlkam der oft eintretende, teils erhebliche Mangel an Wasser für Mensch und Vieh gerade in der heißen und trockenen Jahreszeit immer wieder zu einem großen Problem geworden. Hauptgrund dafür war und ist die Lage der Marktsiedlung auf einem steilen Berg. Nur wenige Brunnen versorgten die Bevölkerung, die aber bei trockenem Klima oft rasch versiegten. Dann musste das Wasser aus möglichen Quellen vom Fuße des Berges, für das Vieh aber zusätzlich aus dem Chamb geschöpft und zu den Anwesen am Berge mühevoll transportiert werden.
Aber nicht nur wegen sauberen Wassers galt es den Chambfluss zu reinigen, sondern auch für die Sorge um seinen ungehinderten Verlauf, denn allzu oft geschah es, dass Bereiche des mäandrierenden Flussbetts aus mehrerlei Gründen versandeten und sich deshalb ein Rückstau bilden konnte. Dieser aber beeinträchtigte einmal mehr den reibungslosen Betrieb der an diesem Fluss liegenden Mühlen.
Im Archiv des Marktes findet sich aus den 1870er Jahren ein Akt mit dem Titel „Reinigung des Chambflusses“. Anfänglich wird amtlich festgestellt, dass im Gemeindebereich damals an dem Chamb 22 „Adjecenten“ waren, Bürger des Marktes, die mit ihren Grundstücken an den Chamb stießen und somit der jeweilige Uferstreifen das Grundstück begrenzte. Deswegen hatten die Anlieger gewisse Sorgfaltspflichten zu beachten, auf die nun näher eingegangen werden soll:
Müller legt Beschwerde ein
Am 24. Juli 1875 informiert das Landgericht Kötzting den Magistrat, dass der Mühlenbesitzer Johann Müller – damals Inhaber der Heuhofer Mühle – gegen den „streuberechtigten“ Bürger Anton Pfeffer wegen unterlassener Räumung des Chambflusses Beschwerde eingelegt habe. Nach „distriktspolizeilichen“ Vorschriften jedoch habe die „Räumung des Chambflusses in der Zeit vom 1. bis 18. Juli alljährlich zu geschehen. Sofern die „Ufer-Eigenthümer“ diese Arbeiten nicht selbst verrichten wollten oder auch konnten, seien dafür die Eigentümer der Triebwerke und Stauvorrichtungen dafür beizuziehen.
Von der Gemeinde wurde festgestellt, dass „unterhalb der Heuhofer Mühle an den Stellen, wo Anton Pfeffer das Streurecht besitzt, die Strecke des Chamb so mit Binsen und Wassergewächsen überwuchert (ist), daß das Wasser seinen natürlichen Ablauf nicht finden kann“ und so durch den gebildeten Rückstau der Mühlenbetrieb „in der empfindlichsten Weise beeinträchtigt ist“. Eine Inaugenscheinnahme bestätigte die Beschwerde des Müllers, denn „durch die Verwachsung des Flussbettes mit Schilfgewächsen aller Art wird das Wasser unterhalb der Mühle so bedeutend zurückgestaut, daß sogar die Kammräder (Getriebe) des Mühlwerkes, welche trocken laufen sollen, tief unter Wasser gehen.“
Der Privatier Anton Pfeffer, an dessen Uferstreifen sich eigentlich ein im heutigen Sinne natürliches Biotop gebildet hatte, „wurde zur sofortigen Räumung des Flussbettes von den Wasserpflanzen“ verpflichtet, da infolge eines besonderen Rechtstitels, wonach er das Streurecht am Chambfluß käuflich erworben hat und in der Ausübung seines Streunutzungsrechtes (nur) durch den im öffentlichen Interesse festgesetzten Räumungstermin beschränkt ist“. Pfeffer wurde daher beauftragt, „die Räumungsarbeiten sofort in Angriff zu nehmen und binnen 3 Tagen zu vollenden, widrigenfalls auf seine Kösten von Amtswegen die Räumung besorgt werden würde“. Pfeffer, der bis 1854 das Anwesen Marktstraße 13 und dann ab diesem Zeitpunkt als „Fragner“ (Krämer) bis 1860 das Anwesen Marktstraße 2 innehatte, erscheint nach dessen Verkauf als Privatier, d.h. er lebte von seinem Vermögen. Pfeffer war schließlich seiner Verpflichtung als Anrainer am Chamb nachgekommen.
Obmänner wurden bestimmt
Um künftig ähnliche Situationen zu vermeiden, wurde am 7. Mai 1879 vom Bezirksamt Kötzting eigens eine „Bachordnung für den Kampbach“ erlassen: Nach genauer Beschreibung seines Verlaufs von seinem Ursprung in Böhmen aus wird in § 2 betont, dass „der Kampbach“ alljährlich, wie schon seit 1871vorgeschrieben, „von Schilfen und Wasserpflanzen aller Art bis auf die Sohle zu reinigen (sei) und zwar in der Zeit vom 1. bis 10. Juli jeden Jahres durch die Adjacenten (Anlieger). Um die geeignete Wassertiefe zu halten, sei der Chamb „alle drei Jahre einer gründlichen Reinigung zu unterstellen“. Die sog. „geeignete Wassertiefe“ war nötig für den Betrieb der am Fluss liegenden Mühlen wie auch für die Bewässerung der am Flusslauf liegenden Fluren. Obmänner wurden aus der Reihe der Anlieger bestimmt mit dem Auftrag, die Säuberungs- und Regulierungsarbeiten am Fluss zu überwachen. 1879, am 17. Juli wurden für die am Chamb liegenden Gemeinden Eschlkam, Großaign, Stachesried insgesamt fünf Obmänner bestimmt, für den Markt allein nur der Ökonom Franz Pfeffer.
In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Beschwerden, da der Chamb trotz der vorgegebenen amtlichen Bestimmungen oft nicht geräumt wurde, so auch im Jahr 1891. Da vermeldete das Bezirksamt: „Nach hier erhaltener Anzeige ist das Bachbett der Chamb schon lange nicht mehr geräumt worden und deshalb vielfach mit Schilfgewächsen überdeckt und mit Schlamm angefüllt, und bedarf daher im Interesse der angrenzenden Wiesen-Eigenthümer einer gründlichen Räumung“. Verwiesen wurde dabei auf die oben bereits genannt Bachordnung von 1879.
Aus heutiger Sicht betrachtet, diente die damalige Nachlässigkeit der Bachanlieger eigentlich dem Erhalt der von Natur aus vorgegebenen ökologischen Vielfalt in diesem stark mäandrierenden Wasserlauf.
Werner Perlinger
Maximilian Schmidt genannt Waldschmidt 1888 zum Ehrenbürger Eschlkams ernannt
+Eschlkam. Im Archiv des Marktes finden sich Quittungsbücher. Sie beinhalten für die einzelnen Jahre die Belege bezahlter Rechnungen. So findet sich zum Jahr 1888 unter den Belegen, z. B. für geleistete Handwerksleistungen, auch eine Rechnung, ausgestellt am 8. März von der Lithographiefirma X(aver) Rief aus Regensburg für die kunstvolle Gestaltung einer Ehrenbürgerurkunde. Als einziger Posten ist aufgeführt:
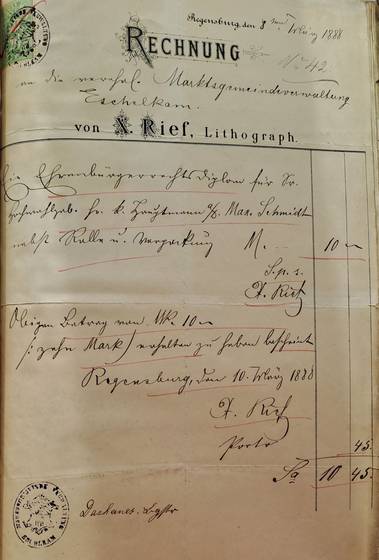
(Für) ein Ehrenbürgerrechtsdiplom für Se. Hochwohlgeb(oren) Hr. K(öniglichen) Hauptmann Max Schmidt nebst Rolle u. Verpackung
M(ark)10 - S.p.s. X. Rief.
Es heißt dann weiter: Obigen Betrag von M. 10.- (zehn Mark) erhalten zu haben bescheinigt. Regensburg, den 10. März 1888, X. Rief.
Den Eingang bzw. den Erhalt dieser Rechnung quittierte der damalige Bürgermeister von Eschlkam, Franz Dachauer (damals als Schmied in Nr. 2/Waldschmidtstraße 10).
Nachdem laut Inhalt einzelner chronikaler Abhandlungen über Waldschmidt bisher nicht klar hervorging, wann genau der Literat von seinem Geburtsort die Würde eines Ehrenbürgers verliehen erhielt, gab nun der zitierte Beleg der Fa. Rief einen Anhaltspunkt für die weitere Recherche. Fündig wurde der Verfasser letztlich in der damaligen Tageszeitung „Der Bayerische Wald“, herausgegeben in der Stadt Furth im Wald seit dem Jahr 1882. In der Ausgabe Nr. 21 vom Mittwoch, den 22. Februar 1888 lautet eine kurze einspaltige Meldung:
Eschlkam, 19. Februar (zum 25jährigen Dichterjubiläum Maximilian Schmidt) „Heute (Sonntag) wurde dem um seinen heimathlichen Gau hochverdienten Dichter und Schriftsteller Herrn k(öniglichen) Hofrath Maximilian Schmidt in München das Ehrenbürgerrecht der Marktgemeinde verliehen. Möge der allgemein beliebte Jubilar uns recht bald mit einer Erzählung aus dem Bayerischen Wald erfreuen. Unsere herzlichste Gratulation!“
Die Verleihung fand also in der Landeshauptstadt statt. Dazu war aus Eschlkam eine Delegation angereist, bestehend wohl aus dem Bürgermeister und zwei bis drei Markträten.
Allgemein betrachtet darf sich Eschlkam als Geburtsort rühmen, in Bayern die erste Kommune zu sein, die ihrem literarisch bereits berühmt gewordenen Sohn einige Tage vor seinem 56. Geburtstag die Würde eines Ehrenbürgers zuerkannt hatte. 1892 verlieh ihm die Stadt Furth im Wald diese Würde. 1902 folgten der Markt Lam sowie Hammern und Seewiesen im Lande der Künischen Freibauern. In der nächsten Ausgabe „Der Bayerische Wald“ vom Freitag, 24. Februar wurde für Maximilian Schmidt zum 25jährigen Dichterjubiläum ein eigener, eine ganze Seite füllender Festbeitrag veröffentlicht, enthaltend den Lebenslauf, bisherige literarische Veröffentlichungen und Glückwünsche.
Im Sterbejahr Goethes geboren
Aus diesem Anlass seien für die Bürger des Marktes Eschlkam nochmals Stationen des Lebens und Wirkens ihres berühmten Sohnes in Erinnerung gerufen: Maximilian Schmidt genannt Waldschmidt wurde am 25. Februar 1832, im Sterbejahr von Johann Wolfgang von Goethe, in Eschlkam geboren. Er verstarb hochbetagt und fast erblindet am 8. Dezember 1919 in München als einer der bekanntesten bayerischen Heimatschriftsteller. Maximilian war der Sohn des Oberzollverwalters Adalbert Schmidt und seiner Frau Karoline, geborene Karg. Schon als Kind erfand er Geschichten für seine beiden Geschwister und inszenierte mit der Jugend des Marktes Theateraufführungen. Nach dem Besuch der Klosterschulen in Metten und Straubing und des Gymnasiums in Passau absolvierte Schmidt die Gewerbeschule in Hof an der Saale, wohin sein Vater als Beamter versetzt worden war. Mit 16 Jahren begann Maximilian ein Studium am Polytechnikum in München, meldete sich 1850 als Freiwilliger zum Militärdienst und war 1859 Inspektionsoffizier am Königlichen Kadettencorps in München. Nach dem Feldzug 1866 im Deutschen Krieg wurde er zum Hauptmann befördert, ein Jahr später krankheitshalber vom aktiven Dienst pensioniert. 1874 beendete er den Militärdienst. Seit 1863 war Maximilian Schmidt mit der wohlhabenden Auguste Haßlacher verheiratet. Fünf Kinder kamen zur Welt, von welchen zwei das erste Lebensjahr nicht überlebten.
Bereits während seiner Militärzeit begann Schmidt zu schreiben. Die ersten Erzählungen und Romane beschäftigten sich mit Personen aus dem Bayerischen Wald, deren Leben er einfühlsam und verständnisvoll beschrieb. König Ludwig II., besser bekannt als der Märchenkönig, ernannte Schmidt 1884 zum königlich bayerischen Hofrat. Prinzregent Luitpold wollte ihn in den Adelsstand erheben, dies soll Schmidt abgelehnt haben. Stattdessen durfte er ab 1898 den Namenszusatz „genannt Waldschmidt“ führen. Dieser Beiname wurde erblich und ist bis heute bei seinen Nachkommen in Gebrauch.
Im Jahre 1890 gründete Maximilian Schmidt den Bayerischen Fremdenverkehrsverband und organisierte 1895 ein großes Volkstrachtenfest anlässlich des Münchener Oktoberfestes, aus welchem sich der jährliche Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest entwickelte. Maximilian Schmidt – ein „Bestseller-Autor“ des 19. Jahrhunderts – schrieb rund 60 größere Volkserzählungen, 40 Humoresken und Skizzen, 40 dramatische Theaterstücke, sowie zahlreiche Gelegenheitsgedichte.
Der 1984 in seinem Geburtsort Eschlkam gegründete Waldschmidt-Verein e.V. zeichnet seither alljährlich Personen, welche sich literarisch, musikalisch oder anderweitig künstlerisch durch Heimatverbundenheit verdient gemacht haben, mit dem Waldschmidt-Preis aus (auszugsweise aus: https://de.wikipedia.org./wiki).
Werner Perlinger
Marktrat erfüllte auch polizeihoheitliche Aufgaben
+Eschlkam. Im Bereich des Marktes und der bürgerlichen Gründe besaß der Marktrat auch die Polizeihoheit. Damit war ihm auch die Gelegenheit gegeben, stets energisch gegen Trunkenbolde, Spieler und gegen Personen vorzugehen, die manchmal gegen das geltende Recht und die Ordnung verstießen. Darüber berichten uns ausführlich, geordnet nach Jahren sog. „Polizei Verhandlungs - u. Strafprotokolle“. Interessant sind sie allein deshalb, als sie uns über die Denkweise und das Rechtsempfinden unserer Vorfahren vor gut 200 Jahren informieren. Aus ihnen sollen einzelne Fälle dem Leser erneut unterbreitet werden. Für den Zeitraum 1818/19 beginnt das erste erhaltene Protokoll am 11. März 1818. Einleitend wird bemerkt: „Über die hierortig magistratische Verfassung erfolgte unterm 31. Dezember 1818 von einer königlichen Regierung des Unterdonaukreises, Kammer des Innern, die allergnädigste Bestätigung, daß die Einweisung des Magistratsrates in den Geschäftsgang im Monat Februar hierauf vor sich ging; und die neuen Functionen fingen im Märzmonat an“.
Deswegen blicken wir noch einmal zurück: Eine zunächst empfindliche Einbuße hat durch eingeleitete staatliche Reformen das märktisches Gemeinwesen erhalten, als die bayerische Regierung unter Graf von Montgelas daran ging, den Gemeinden ihre Selbstständigkeit zu nehmen und sie zu letzten Werkzeugen des Staates zu machen. Auch die Verwaltung des Gemeinde- und Stiftungsvermögens ist den Gemeinden genommen worden. Sie ist eigenen von der Regierung aufgestellten Kommunaladministratoren übertragen worden. In Eschlkam wurde, wie in anderen Gemeinden auch, dafür der Marktschreiber als Komunaladminstrator bestimmt. Kgl. bayer. Kommunaladministrator war nun der Marktschreiber Franz de Paula Bach, aber nur bis zum Jahr 1818. Denn mit dem zweiten Gemeindeedikt vom 17. Mai dieses Jahres wurden den Gemeinden wiederum mehr Selbstverwaltungsrechte eingeräumt. Darüber wurde schon mehrmals berichtet.
Den Dunghaufen zurücksetzen
Am 11. März 1819 tagte daher erstmals der Magistrat auf der Basis seiner Polizeihohheit. Kein Mitglied fehlte. Der „behauste“ Bürger und Fuhrmann Joseph Pfeffer beschwerte sich, dass der Bürger Kaspar Schifferl (Großaigner Straße 9) ihn „zum Nachtheil hinsichtlich der Fahrtmöglichkeit zu dem von den Georg Bauerischen Eheleuten erkauften Behausung (Großaigner Straße 11) durch einen um drei Schuh vorgesetzten Dunghaufen behindere“. Dem Schifferl wurde aufgetragen innerhalb von 8 Tagen den neu angelegten Dunghaufen wieder an die alte Stelle zurückzusetzen. Ansonsten würde es die Gemeinde auf seine Kosten bewerkstelligen.
Im Monat April zeigte der teils mit Polizeihoheit ausgestattete Marktdiener an, dass der Hufschmied Andre Würz, der Schneidermeister Georg Hacker (damals in Großaigener Straße 4) und Georg Riederer, „Leerhäusler“ (ohne Grundbesitz) „ihre Brunnen nicht hinlänglich verdeckt haben“. Die drei Bürger wurden vor den Rat zitiert und erhielten bei Androhung von Strafe den Auftrag die mangelnde Abdeckung zu beseitigen. Verständlich wird das Vorgehen des Magistrats, da gerade verschmutztes oder bereits verseuchtes Trinkwasser immer wieder die Ursache für den Ausbruch von Epidemien waren bzw. sein konnten.
Der Marktrat hatte auf dieser Rechtsebene auch die Brot-, Fleisch und Mühlenbeschau durchzuführen, die Lebensmittelpreise prüfen und bei den Bäckern das Gewicht der Produkte zu überwachen. Für diese Dienste wurden bei jeder Ratswahl eigens Personen aus dem Ratsgremium bestimmt. Die Protokollinhalte darüber seien nicht eigens angeführt, da dies in einer früheren Veröffentlichung bereits ausführlich geschehen ist.
Sperrstunde überschritten
Joseph Scheppel, Metzger; Anton Hastreiter, Müller; Johann Hornik, Stiftschmied“ (Pächter einer Schmiede), dann die Bürgersöhne Sebastian Hastreiter, Sebastian Aschenbrenner, Franz Leuthermann, Franz Lachs, Michael Hastreiter; ferner Joseph Schreindorfer, Schuhmachergeselle, haben sich in der „Wirthsbehausung“ des Mathias Späth „über die gesetzliche Polizeystunde noch zechend bewirthen laßen“. Deshalb wurde am 18. Mai die Befolgung der „Polizeiordnung“ angemahnt und „für dermal jeder Kopf pünktlich (bestraft mit) 30 Kreuzer, von samentlichen 9 Individuen“ somit 3 Gulden als Geldstrafe vereinbart. Der damalige Gulden dürfte heute etwa dem Wert von 10 Euro entsprechen.
Die Bauaufsicht tagte
In der Sitzung vom 5. September 1819 wurde dem „behausten Bürger“ Wolfgang Stauber „eines wegen Hausreparation wiederholt aufgetragen, die Baufälle (bauliche Schäden) sogleich wiederum wenden zu laßen, außerdem er zu gewärtigen hat, daß von (der) Oberpolizey (hier: Einschaltung des Bezirksamtes) wegen das Geeignete vorgekehrt würde“. Stauber, von Beruf Uhrmacher, besaß damals das Anwesen 22 – es wäre heute Marktstraße 2. Stauber dürfte der dringlichen Aufforderung nachgekommen sein.
Im Dezember 1820 beschwerten sich einige Gemeindebevollmächtigte (Mitglieder des Ausschusses), dass die beiden Nachtwächter Wolfgang Schafler und Franz Meidinger ihren Wächterdienst vernachlässigten. Sie wurden ermahnt, dass sie „ihren Verrichtungen getreulich und pflichtmäßig nachkommen“, ansonsten würde die Entlassung drohen.
Werner Perlinger
Die Finanzen des Marktes - aus der Kammerrechnung von 1784
+Eschlkam. Wie in allen Kommunen mit eigenem Rechtsstatus wurden auch von der Marktbehörde Eschlkam die jeweils pro Jahr anfallenden Einnahmen und Ausgaben in sog. Kammerrechnungsbüchern sorgfältig und detailliert aufgelistet. Dadurch geben diese Rechnungsbücher – soweit sie noch vorhanden sind - einen hervorragenden und tiefen Einblick in das Leben und auch den Alltag der Marktbewohner, der Gewerbetreibenden, Handwerker und Bauern in der Gemeinde. Es seien im Folgenden nur die wichtigsten Posten aus der Rechnungslegung des Marktes vom Jahr 1784 vorgestellt. Sie ist wie die anderen auch, gegliedert in Einnahmen und Ausgaben.
Die Überschrift auf der ersten Seite titelt: „Cammer Rechnung (des) Chürfrslt.: BannmarktsEschlkam, so von Anton Hastreither dermahligen Amts Bürgermaistern alhir abgelegt worden de anno1784“. Zu Jahresanfang betrug das Marktvermögen „als fertiger Rest“ (Rest vom Vorjahr) 693 f (Gulden) 35 Kr(euzer) und 2 ½ H(eller); sicherlich ein Ergebnis vorjähriger sparsamer Wirtschaftsführung.
Die Einnahmen beginnen mit den „Pfening Gilten“. Grundstücke im Eigentum des Marktes wurden gegen eine bestimmte jährliche „Gilt“ (Zins) an bestimmte Bürger verliehen bzw. verpachtet. Die darauf ruhende Steuerlast kam der Marktkasse zugute. Die Einnahmen selbst erschöpften sich in kleinen Beträgen, daher auch der obige erklärende Name. Mit eingeschlossen wurden auch eine „2/3 Steuer“ und eine „Kastengilt“ So zahlte im Jahr 1784 der Müller Andre Penzkover „auf der Trukenmühl“ über 4 f (Gulden), den mit Abstand höchsten Betrag. Letztlich kam für die drei Steuererhebungen ein Betrag von 72 f 42 Kr. und 4 ¼ H der Marktkasse zu Gute.
An „Deichslzohl“, die Zollabgabe für die den Markt durchfahrenden Wagen und Karren, konnten 67 f verbucht werden, 1 f mehr als im Vorjahr. Keine Einnahmen gab es beim „Bürgerrechtsgeld“, da keine Neuaufnahme stattfand.
Das „Manngeld“
Diese Art Steuer, „Manngeld“ genannt, war eine Abgabe für grundbesitzlose Marktbewohner, die nicht nach dem Umfang von eigenen Grund und Boden besteuert werden konnten. 17 Kr entrichteten jeweils sechs Bewohner, so dass 1 f 42 Kr an die Kommune abgeführt werden konnten. Über 11 f betrugen die Einnahmen an Strafgeldern.
Über viele Jahre zogen sich manchmal die Zinszahlungen für die aus der Marktkasse hergeliehenen Kapitalien hin. 13 Bürger werden 1784 genannt, wobei etwa knapp 160 f an Zinsertrag in die Marktkasse flossen. Die Einnahmen an „Wachtgeld“ von 61 Bürgern und 6 „Inleuten“ (Mieter ohne eigenes Haus) für die Besoldung der Nachtwächter betrugen knapp über 18 f. Demnach zählte der Markt damals um die 61 Anwesen. Die Einnahmen an sog. „Zapferrecht“, dem Recht Bier auszuschenken, betrugen auch nur 4 f 36 Kr. Dagegen betrug der „Fischgewün“ aus den Weihern des Marktes 27 f. Fisch war gegenüber dem teuren Fleisch damals sehr beliebt. Es war die eiweisreiche Nahrung für die hart arbeitende und gering verdienende Bevölkerung. Die Einnahmen der Marktkammer betrugen 1784 insgesamt knapp über 1049 f.
Vielfältige Ausgaben
Im zweiten Teil des Rechnungsbuches sind detailliert die Ausgaben der Marktkammer aufgelistet: So erhielten die „4 Herren Bürgermeister“, das waren der gerade regierende Amtsbürgermeister Hastreiter und seine drei Stellvertreter, als „ihre jährliche Besoldung“ insgesamt 32 f, so dass auf jeden 8 f entfielen. Diese vier Persönlichkeiten bildeten zugleich den „Inneren Rat“. Die vier Mitglieder des „Äußeren Rates“ wurden dagegen mit nur 12 f entlohnt. 75 f Jahreslohn erhielt der Marktschreiber für seine Dienste. Die beiden Nachtwächter wurden für ihren täglichen Dienst zur Nachtzeit mit 20 f entlohnt; daher jeder 10 f. 24 f insgesamt erhielt der Ratsdiener Johann Reiser; davon allein 4 f für die „fleißige Obsicht“ über die damals noch zur Marktkammer gehörende Waldung „Kärpfling“. Für Reparaturarbeiten an den öffentlichen Gebäuden wie z. B. dem Rathaus und der Marktsdienerwohnung wurden unter der Rubrik „auf Gebäu und Beßerung“ 28 f 21 Kr ausgegeben. Über 15 f wurden für Botendienste aufgebracht.
Allgemeine Ausgaben
Zum Schluss werden die „allgemeinen Ausgaben“ angeführt welche 1784 insgesamt nur 88 f 58 Kr und 5 ½ H betrugen; gegenüber dem Vorjahr um über 70 Gulden weniger.
Unter diese Rubrik fielen u.a. Kosten an für anzuschaffende Gesetzesbücher, gerade erst publizierte Intelligenzblätter, Brennholz für das Rathaus, für Schreib- und Siegelpapier, die viermalige Säuberung des „Rhathaus Kamins“. Für die „abzuhaltenden Rhats Seßionen“ (Sitzungen) erhielt für die Fertigung eines „Tischls“ der Schreiner Johann Kaufmann 1 f 56 Kr, um nur einige Beispiele an Ausgaben zu nennen.
Die Summe für alle Ausgaben betrug letztlich über 346 f; 172 f weniger „als ferten“ (im Vorjahr). Letztlich wird am Schluss nach gegenseitiger Berechnung und Einbeziehung noch anderer Positionen festgestellt, dass „der gemeinen Markts Kammer völliges Vermögen“ sich zum Jahresende von 1784 zunächst auf 2782 f belief. Dagegen wurden 863 f noch zu zahlende Schulden aufgelistet, so dass „der Markts Kammer zum wahren Aktivvermögen nur rein rechnerisch ca. 1919 f übrig blieben. Demnach charakterisierte damals den Markt eine gute Finanzsituation. Die Rechnung unterschrieb und siegelte als amtierender Bürgermeister der Schuhmacher Anton Hastreiter. Seine Petschaft ziert handwerksbezogen ein Schnabelschuh. Hastreiter besaß damals das Haus Nr. 59, heute Marktstraße 13.
Werner Perlinger
Als Eschlkamer Bürgersöhne ihrer Wehrpflicht nachkommen mussten
+Eschlkam. Unter den Archivalien des Marktarchivs finden sich, aufgeschlüsselt nach einzelnen Jahrgängen, sog. „Special Listen bezüglich der Conscription der Altersklasse“. Der Titel sagt dem Leser vorerst nicht worum es sich bei diesen Niederschriften handeln mag. Eine der frühesten Liste datiert vom Jahr 1842 und beschreibt die „Altersklasse 1821“. Nun wird es klar: aufgezählt werden in dieser von der Marktverwaltung erstellten Aufstellung all die jungen Männer, welche im Jahr 1821 geboren sind und somit im Alter von 21 Jahren der Wehrpflicht unterliegen. Diese war damals die Pflicht eines jeden Staatsbürgers, für einen gewissen Zeitraum in den Streitkräften seines Landes zu dienen.
Dazu einleitend noch folgende allgemeine Ausführung: In Deutschland verhalf der sogenannte "Befreiungskrieg" gegen Frankreich (1813-1814) der Vorstellung von der allgemeinen Wehrpflicht als Bürgerpflicht zu einem ersten Durchbruch. Tatsächlich konnte von einer allgemeinen Volksbewaffnung keine Rede sein, denn es waren freiwillige Soldaten und Verbände in den verschiedenen deutschen Staaten, die sich aus tiefer Bindung an den entstehenden deutschen National- und Kulturstaat entschlossen, ihr Leben einzusetzen. Erst mit der Reichsgründung von 1871, einer "Revolution von oben", wurde die allgemeine Wehrpflicht in der Reichsverfassung festgeschrieben. Demnach war jeder männliche Deutsche grundsätzlich wehrpflichtig und musste, wenn tauglich, ab dem 20. Lebensjahr sieben Jahre lang in den Streitkräften dienen – zunächst als aktiver Soldat, später als Reservist und in der Landwehr. In ihrer aktiven Zeit unterlagen sie entscheidenden Einschränkungen: Soldaten besaßen kein aktives Wahlrecht, waren aber selbst wählbar. So sollte die bewaffnete Macht davor bewahrt werden, in die politischen Konflikte des Kaiserreichs hineingezogen zu werden. Wie wir sehen hatte gerade im 19. Jahrhundert jeder junge Mann in Friedenszeiten seine allgemeine Wehrpflicht abzuleisten, nicht anders als bei uns in jetziger Zeit von 1956 bis zu ihrer Abschaffung im Jahr 2011.
Wir kehren zurück: In der genannten Liste vom Jahr 1842 werden als eines von mehreren Beispielen gerade mal acht Männer aufgelistet. Erfasst werden dabei Geburtsort, Religion, das gerade ausübende Gewerbe, auch ein mögliches Studium, das vorhandene Vermögen als Hinweis auf die wirtschaftliche Situation; dann seine „Aufführung“ als sein gesellschaftliches Verhalten, letztlich noch die Eltern und deren „Stand“ (hier der ausgeübte Beruf).
Bruder von Kunstmaler Alois Bach
Die Liste beginnt mit Franz Späth. Er war mit gerade 21 Jahren „Schulgehilfe“ in Konzell, Landgericht Mitterfels. Seine Eltern waren der Metzger Joseph Späth und Katharina, geb. Stiegler von Anwesen Nr. 5/Further Straße 3. Neben dem Schmied Joseph Fischer und dem Bräuknecht Anton Pfeffer nennt uns die Liste Franz Paul Bach als Sohn des damaligen gleichnamigen Marktschreibers Franz Bach und seiner Frau Anna. In der beruflichen Sparte wird Franz Paul als Hochschüler bezeichnet, d. h. er hatte damals wohl gerade erst ein Studium begonnen. Er war der Bruder des Kunstmalers Alois Bach, ein Zeitgenosse und Freund des weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Carl Spitzweg. Alois Bach (1809-1893) gilt in der Kunstwelt als Genre-, Tier- und Landschaftsmaler.
Nach dem Zimmermann Michael Schreiner (Eltern: der Häusler Mathias Schreiner und sein „Weib“ Barbara von Nr. 18/Further Straße 8) wird Joseph Vetter genannt, bezeichnet als „Student“. Seine Eltern waren der Rotgerber Georg Vetter und „Weib“ Elisabeth. Die Eltern waren in diesem Jahr 1842 nicht mehr in ihrem ehemaligen Anwesen Nr.42/Blumengasse 7 wohnhaft, sondern in der Landeshauptstadt München, wo sie als „Schutzverwandte aufgenommen“ worden sind, wohl als Rückhalt und Hilfe für den studierenden Sohn. Die Liste endet mit Franz Alois Limmer, Sohn des (+) Mautdieners Joseph Limmer und mit Karl Landsdorfer, Sohn des Häuslers Michael Landsdorfer. Sohn Karl befand sich bei Aufnahme des Protokolls in Steinerkreuz, Hofmark Schönstein, Landgericht Mitterfels.
Man konnte der Wehrpflicht auch „auskommen“. Ein „Patent“ (hier als „Schutzrecht“) vom 15. Mai 1847 informiert über die „Conscribenten“ der Geburtsjahrgänge 1824/25 welche „sich freylobten“ (freikauften) oder für den Militärdienst als untauglich befunden wurden. Sie hatten Anspruch auf einen „Militär-Entlassungsschein“. Dafür mussten die „zahlungsfähigen Conscribenten“ etwas mehr als 6 Gulden entrichten, die „vermögenslosen“ jungen Männer hatten sich mit dem „erforderlichen von dem Gemeindeausschusse und dem einschlägigen von Hr. Pfarrer unterzeichneten Armuthszeugnisse zu versehen“. Vom Gebutsjahr 1824 waren dies Rupert Anton Koller, Seilerssohn, Johann Lechermayer, Wenzeslaus Späth und Joseph Weber; im Jahr darauf Michael Meidinger, Johann Baptist Schmirl und Andre Schneider.
Freistellungsgesuch abgelehnt
Für die Befreiung von der Wehrpflicht wurden auch damals Gesuche von Eltern gestellt, meist deshalb, weil sie ihren Sohn zur Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Existenz dringend brauchten. So stellte der „bürgerliche Bäck“ Anton Hastreiter (von Nr. 23/Marktstraße 2) am 20. Februar 1843 an das Königlich bayerische Infantrieregiment „Kronprinz“ für seinen Sohn ein „Urlaubsverlängerungsgesuch“. Er begründete dies mit folgenden Ausführungen: Er stehe im 69. Lebensjahre, „ist noch ansässiger Bäcker und Witwer, kann seinem Gewerbe bei diesem hohen Alter gleichwohl nicht mehr vorstehen, habe aber einen Sohn namens Georg Hastreiter, Soldaten der 7. Füßilier Kompagnie im obgenannten Regimente, welchem sein Urlaubspaß Ende März ausläuft, dieser aber ihn am besten unterstützen kann, indem (derselbe) der Bäcker Profession wohl kündig ist.“ Da Hastreiter seinen Sohn den kommenden Sommer über „recht nothwendig Behufs seines Gewerbes habe, wagt man für benannten Georg Hastreiter bittlich“ den Antrag auf Urlaub vom Wehrdienst zu stellen.
Fünf Tage später antwortete Oberst Hartmann vom Regiment Kronprinz, „daß dem zu Eschlkam beurlaubten Soldaten Georg Hastreiter aus dienstlichen Gründen keine weitere Urlaubsverlängerung ertheilt werden kann“. Vielmehr hatte er am 31. März abends beim „Regiment einzurücken“. Für den jungen Hastreiter endete Monate später endgültig der Militärdienst mit der Übernahme des elterlichen Betriebes am 5. Oktober 1843.
Werner Perlinger
Als Rittmeister Bertenhammer das Landgericht um Hilfe bat
+Eschlkam. Im Marktarchiv findet sich ein Vorgang, der thematisch und auch inhaltlich außer der Reihe der herkömmlichen Archivalien steht und eine besondere, nicht alltägliche Situation aufzeigt: Am 12. Juni 1828 wendet sich der bereits pensionierte Rittmeister (entspricht dem Rang eines Hauptmanns bei den Fußtruppen) und Ritter der französischen Ehrenlegion, Joseph Bertenhammer an das Königliche Bayerische Landgericht zu Kötzting mit der Bitte um „Zurechtweisung des Betragens seines in Eschlkam in Urlaub befindlichen Stiefbruders“. Das Landgericht antwortete unmittelbar und bat Bertenhammer „auf das dringenste, seinen beim Königlichen Infantrieregiment zu Passau stehenden, dermal aber zu Eschlkam in Urlaub befindlichen Stiefbruder Anton Wolf, den ihm eingeräumten Urlaub alsbaldigst auflösen zu lassen“.
Der um seinen nahen Verwandten offenbar sehr besorgte ehemalige Rittmeister erwähnt als „dringende Veranlassung“, dass Wolf „im Lande und in seiner heimatlichen Gegend gleichsam wie ein Landstreicher herumzieht, Schulden auf Schulden täglich macht, und sich so im allgemeinen aufführt, daß er unsere ganze Familie zu (in) Schande und Spott herumgeht (bringt), und die größten Ausschweifungen ausübt, wo die Verwandtschaft nicht zahlen genug kann, überdies so grob sich benimmt, daß er oft meine Schwester die Frau Oberzollbeamtin zu Eschlkam damit (be)droht, daß wenn sie seinen Wünschen und Begehren um Geld oder andere Sachen nicht willfahrt, werde er das Haus in Brand stecken und so anderes“. Insgesamt betrachtet zeitigte der wohl vorhandene Alkoholismus seines Stiefbruders bereits üble und auch nicht ungefährliche Folgen.
Weiter bringt Bertenhammer vor, der Gatte seiner Schwester, der königl. Oberzollbeamte Ruesch „ist ein alter Mann und kränklich“. Gerade in dieser Lage habe Wolf diesen „durch sein widriges Betragen so beleidigt, daß er es nicht länger mehr auszuhalten im Stande ist, und es mir zur Pflicht obliegt nicht allein für meine Schwester, sondern auch mich für meinen H. Schwager in dieser Hinsicht zu verwenden“.
Umgang mit liederlichen Leuten
Mein Bruder, so der Schreiber des Bittbriefes, sei bisher brav, fleißig und ordentlich gewesen. Allein „liederliche Leute“ hätten ihn auf Abwege gebracht. Daher sei „es das Beste wenn er stets in königl. Diensten fest verbleiben würde“. Dazu könne das Landgericht „das maiste beytragen“. Berthammer unterbreitete den Vorschlag, den Stiefbruder in den Dienst wieder „einzuberufen“. Letztlich bat er noch, es möchte seinem Stiefbruder untersagt werden, „solange vom Wald, nehmlich vom Holztheile, welcher meiner Schwester mit ihrem Haus seinem Mädchen zu kaufen gab, nichts abhauen dürfe bis er das Haus bezahlt, (er) vom Militär frei, und es förmlich und gerichtlich, allein, oder mit seiner haben sollenden (künftigen) Braut übernohmen hat. So (dürfe er) auch vom Pachtgeld des Hauses nichts einnehmen, sondern meiner Schwester vorabfolgen zu lassen. Ich getröste mich einer hochgerichtlichen Willfahrung meiner Bitte respectvoll und ergebenst Joseph Bertenhammer, pens. Rittmeister und Ritter der französischen Ehrenlegion“.
Das Landgericht leitete das Bittschreiben Bertenhammers an das Königliche Infanterieregiment in Passau weiter. Diese Behörde antwortete, „in Betracht der Einberufung wegen schlechter Aufführung und in Eschlkam ständig beurlaubten Soldaten Joseph Anton Wolf könne hier nicht eingegangen werden. Vielmehr wolle das Landgericht (Kötzting) über die Aufführung des abgedankten Soldaten selbst nähere Kunde einziehen und dem Regiment über die Notwendigkeit der Einberufung das Weitere mitteilen, woran dann nicht gesäumt werden wird, das geeignete hiernach zu verfügen“.
Unmittelbar darauf wurde der Magistrat von Eschlkam gebeten, all die von Bertenhammer „gegebenen Umstände zu erforschen“ und das Resultat dann „mit Vorlage an das Regiment“ weiter zu leiten, oder „wenn die Anzeige der Erforschung zum Besten ausfällt“, dies „dem H. Rittmeister zu seiner Beurteilung geschweige (zur) Notiz zu geben“. Hiermit schließt der Akt. Wie das ganze Verfahren ausging ist nicht überliefert. Anzunehmen aber ist, dass Wolf wieder beim Infantrieregiment seinen Dienst als Soldat antreten musste.
Das Rueschhaus
Interessant in dieser Angelegenheit ist die Frage um welches Anwesen es sich in der Schilderung Bertenhammers handelt. Bei Erarbeitung einer Chronik für die Eschlkamer Bürgerhäuser konnte diese Frage verhältnismäßig leicht gelöst werden:
Am 6. September 1828 schlossen Therese Wolf, Auditorentochter (Auditor ist ein Prüfer), geb. 1802 in Neumark in Böhmen und Karl Anton Ruesch, geb. am 22. Juli 1758 in Eschlkam und „kgl. Quieszierter Oberzollbeamter“ (in Ruhestand) einen Heiratsvertrag ab. Beide wohnten in Anwesen Nr. 30, heute Waldschmidtplatz 3. Bereits 1805 wird dieses Haus als Wohngebäude des „königlichen Beymautners“ Karl Anton Ruesch erwähnt. Ruesch stirbt bald und seine Witwe heiratet noch einmal und das Haus, bisher Wohngebäude ohne Ökonomie (nur) für Zollbeamte, wird sozusagen privatisiert und im Jahr 1846 an den Häusler Anton Späth veräußert. Das Haus verblieb bis heute bei der Familie Späth. Zwei Hausnamen sind von diesem Anwesen bekannt, einmal das „Rueschhaus“, erinnernd an die nun erwähnte gleichnamige Zöllnerfamilie; dann, bezogen auf die Familie Späth: „beim Späth’n Andredl“. Angeführt sei noch, dass auch Adalbert Schmidt, Zollbeamter und Vater des Literaten Maximilian Schmidt, genannt „Waldschmidt“, dieses Haus um 1835 angemietet hatte. Vorher wohnte er als Leiter des örtlichen Zollamtes in dem 1827 von dem Wirt und Metzger erbauten sog. „Mauthaus“, wo sein Sohn Maximilian am 19. Februar 1832 das Licht der Welt erblickt hatte.
Werner Perlinger
Der vergebliche Versuch eine Geschmeide-Warenhandlung zu eröffnen
+Eschlkam. „Gesuch des beabschiedeten Grenzaufsehers und bereits ansässigen Bürgers Wolfgang Riederer um Verleihung einer Geschmeide-Warenhandlung betreffend“ titelt ein Akt aus dem Jahreszyklus 1852/53. Insgesamt geht es in den einzelnen Vorgängen um die Eröffnung eines Geschäfts im Markt. Unwillkürlich denkt der Leser bei dem Wort „Geschmeide“ zunächst an Schmuck. Dem war früher nicht so, denn unter dem Wort >Geschmeide< verstand man vielerlei geschmiedete Gegenstände, meist Werkzeuge jeder Art. Erst später, in neuerer Zeit verstehen wir darunter Arbeiten aus Gold oder Silber, bzw. Schmuck allgemein, daher auch die Berufsbezeichnung Gold-oder Silberschmied.
Wolfgang Riederer, geb. 1815, übernahm im Jahr1852 das Anwesen Nr. 61/Großaigner Straße 1 seines Vaters, des Metzgers Anton Riederer. Am 12. Oktober gleichen Jahres erschien er als ansässiger Bürger vor dem Marktrat, legte ein Zeugnis „über erstandene Prüfung für das Geschmeidewarenhandelsgewerbe“ vor und bat, ihm dafür eine „Concession (Zulassung) nach Eschlkam“ zu erteilen, „da sich dahier weder ain Geschmeidehändler noch ein Geschmeidemacher befindet“.
Riederer hatte vorher bis 1851 als Grenzaufseher gearbeitet. In dieser Berufsphase besorgte er für den Geschmeidehändler Alois Zierhut aus Furth, damals auf Anwesen Pfarrstraße 2, dessen Bedarf aus den „Geschmeidewarenhandlungen zu Passau“, da er dort seinen Dienst versehen hatte. In einem am 22. September 1852 eigens ausgestellten Zeugnis bestätigte Zierhut dem Riederer beste Arbeit geleistet zu haben u.a. mit dem Hinweis, dass er „sich so viele, sowohl theoretische als praktische Kenntnisse erworben (hatte), daß er zur selbstständigen Führung eines solchen Gewerbes vollkommen qualifiziert ist“. Daher sprach sich der Marktrat mit Bürgermeister Moreth an der Spitze für eine „Dispensation (Befreiung) von den Handlungs- Lehr-und Servirjahren behufs Erlangung ainer Geschmeidewarenhandlungs-Concession“ aus. Auch sei er aufgrund des vorgelegten Zeugnisses dazu fähig. Ferner besitze er zur „Betreibung fraglichen Geschäftes das nötige Betriebs-Capital“. Außerdem befahl der Marktrat, das „Concessionsgesuch an der Rathaustafel zur allenfalsigen Mitbewerbung zu affigieren (anschlagen)“ Nach vierwöchigen Aushang, dieser geschah ab 12. Oktober, sollte dann über das Gesuch entschieden werden.
Nun schaltete sich in die Angelegenheit das Hauptzollamt ein, das seinen Sitz damals in Eschlkam hatte. Am 13. Oktober stimmte diese Behörde dem Vorhaben Riederers umso mehr zu, als dem Schmied Michl Dachauer (Nr. 6/Kleinaigner Straße 1) bereits am 7. April gleichen Jahres der Handel mit Eisenwaren bewilligt worden war. Nur durfte der „Pedent“ (Bittsteller) Riederer seinen Warenbedarf künftig nicht „unmittelbar aus dem Auslande, sondern nur von vereinsländischen (inländischen) Handlungen beziehen“. Außerdem habe er sich den im Zollverein geltenden Kontrollbestimmungen zu unterwerfen.
Die Konkurrenz schläft nicht
Wenige Tage später, am 20. Oktober, meldete sich der Schlossermeister Joseph Römisch (Nr. 68/Großaigner Straße 6) als „Mitbewerber um (die) fragliche Concession“. Auch er bat um „Dispensation“ von der herkömmlichen Lehrzeit. Der Marktrat stimmte zu, „weil zwischen dem Geschäfte eines Schlossers und dem eines Geschmeidehändlers eine Gewerbsverwandtschaft in Wirklichkeit besteht“ und er als „tüchtiger Schlossermeister ein fürs bürgerliche Geschäftsleben genügend gebildeter Mann“ ist.
Am 4. November beantragte der Eisenhändler Dachauer – er hatte bereits am 7. April 1852 die „Eisenhandlungs-Concession“ erhalten – das Gesuch des Riederers abzuweisen, „da das Bedürfnis nach einer zweiten Geschmeidewarenhandlung für den Markt Eschlkam nicht besteht und sein ordentliches Auskommen gefährdet werden würde“.
Einen Beschluss gefasst
Der Magistrat fasste am 13. November in einer ausführlichen Stellungnahme den Beschluss, „daß dem W. Riederer die nachgesuchte Geschmeidewarenhandlungs-Concessionun bedingt zu ertheilen sei“. Ferner sei das Gesuch des Mitbewerbers Römisch „nicht zu berücksichtigen und der concessionierte Eisenhändler Dachauer sei mit seiner Erinnerung zurückzuweisen“. Es unterschrieben Bürgermeister (Simon) Moreth (damals Nr. 42/Blumengasse 7) und die Markträte Schmirl, Pohmann und Forster. Am nächsten Tag mussten Riederer, Römisch und Dachauer im Rathaus diesen Beschluss entgegennehmen und signieren. Auch wurde den Betroffenen 14 Tage für eine „Berufungsergreifung“ eingeräumt.
Die Monate vergingen. Am 16. Juni 1853 erklärte die Regierung von Niederbayern als dafür höchste Instanz den Beschluss vom 13. November wegen eines eklatanten Formfehlers des Magistrats „als nichtig“, nachdem Dachauer dagegen eine „Nichtigkeitsbeschwerde“ erfolgreich eingelegt hatte. Doch bereits Wochen vorher, am 21. April, hatte die Marktführung erkannt, dass der Beschluss vom November des Vorjahres „ohne Mitwirkung der gesetzlich erforderlichen zwei Drittheile der Magistratsmitglieder geschah“. In der gleichen Sitzung entschied der gesamte Rat, dass es hinsichtlich der Entscheidung vom 13. November „lediglich sein Verbleiben habe“, jedoch mit der Einschränkung, dass Riederer keine gleichen Waren wie Römisch anbieten dürfe.
Die höchste Instanz entscheidet
Der Streit war jedoch noch nicht zu Ende: Am 28. April 1853 hatte zusätzlich das Hauptzollamt Eschlkam die Regierung in Niederbayern gebeten, die für Riederer erteilte „Concession nicht gewähren zu wollen“, da dieser sich an zollrechtlichen Vorgaben, wie z. B. die verbotene Einfuhr von Waren aus dem Auslande, nicht gehalten habe. Am 8. Juni schließlich entschied „im Namen seiner Majestät des Koenigs von Bayern“ die Regierung in Niederbayern, die Berufung Dachauers abzuweisen. Ebenso wurde das Gesuch Riederers wegen „der vorgebrachten Bedenken, die umso mehr eine besondere Würdigung verdienen, als auch vom gewerbspolizeilichen Standpunkte aus ein Bedürfnis zur Verleihung dieser Concession als nicht gegeben erachtet werden kann.“ Riederer musste sein Vorhaben vorläufig aufgeben. Erst ein erneuter Versuch im Jahr 1857 hatte Erfolg, wobei er nur die Waren verkaufen durfte, die gegenüber Römisch und Dachauer keine Konkurrenz darstellten.
Werner Perlinger
Aus der Tätigkeit der Kirchenverwaltung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
+Eschlkam. Über die Kirchenverwaltung erschien bereits der Artikel "Wahl der Kirchenverwaltung in Eschlkam im Jahr 1845". Nun sollen einzelne schriftlich festgehaltene Inhalte aus der Tätigkeit dieses Gremiums – wenn auch 30 Jahre später - angeboten werden.
Zunächst einführend: Das Kirchenrecht bestimmt, dass in jeder Pfarrei ein Vermögensverwaltungsrat bestehen muss, in dem ausgewählte Gläubige dem Pfarrer (der die Pfarrei bei allen Rechtsgeschäften vertritt) bei der Verwaltung des Pfarrvermögens helfen. Zu den Aufgaben des Pfarrverwaltungsrates bzw. der Kirchenverwaltung (in Folge: KV) zählen u.a. die Genehmigung des jährlichen Haushaltsplanes der Pfarrgemeinde sowie Miet- und Pachtangelegenheiten. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehört auch die Verantwortung für die zur Kirche gehörenden Gebäude und Personal, beispielsweise das der von der Pfarrgemeinde betreuten Kindergärten. Der jeweils wirkende Pfarrer ist kraft seines Amtes stets der Vorsitzende des Pfarrverwaltungsrates. Grundsätzlich ist der Aufgabenbereich der KV von dem des Pfarrgemeinderates zu trennen.
Wir schreiben das Jahr 1875. Am 6. Juni tagten die Mitglieder der Kirchenverwaltung und legten wegen des Friedhofs fest, „es sei an das königliche Bezirksamt in Kötzting (heute das Landratsamt) die Bitte zu richten, es wolle genehmigen, daß der amtliche Auftrag erst bei Beginn des nächsten Jahres vollzogen werde, da gegenwärtig zur Herstellung von dauerhaften eisernen Gittern keine verfügbaren Mittel vorhanden sind“. Die Niederschrift unterzeichnete an der Spitze des Gremiums Pfarrer (Joseph) Ludwig, er amtete von 1871-1877.
Ein Jahr später, 1876, wurde am 18. Februar im Beisein auch von dazu delegierten Gemeinderäten für den Zeitraum 1876 bis 1882 der Kirchenpfleger gewählt. Dieses Amt übernahm nun der Bierbrauer und Realitätenbesitzer Alois Neumaier (damals Inhaber des heutigen Gasthofes Penzkofer). Nach Annahme der Wahl wurden „demselben der Cassenschlüssel sowie die (bar) vorhandenen Gelder im Betrage von 638 Gulden 47 ½ Kreuzer ausgeantwortet“. Neumaier erklärte schließlich, dass er die Verantwortung über die Kirchengelder laufenden Ausgaben und Einnahmen vom heutigen Tage an übernehmen wolle“. Bereits am 4. März bemühte man sich um die „Richtigstellung des Capitalienstandes bei der Kirchenstiftung Eschlkam“. So fanden sich nach Öffnung der Kasse „die im beiliegenden Verzeichnisse aufgeführten Wertpapiere im Gesamtwert von 20.300 Gulden“. D.h. die Kirche Eschlkam war damals, fünf Jahre nach dem deutsch-französischen Krieg, vermögend. Wenig später, am 26. April befasste sich die KV mit der „Ablassung der sog. Heiligen Schupfe“ an die Gemeinde. Manchmal wurden diese Gebäude, die ausschließlich zum damaligen Ökonomiepfarrhof gehörten, auch als „Heiligen Stadel“ bezeichnet. Beschlossen wurde „die sog. Heiligen Schupfe der Feuerwehr zur Benützung als Requisitenhaus“ nur unter der Bedingung zu überlassen, wenn innerhalb des Gebäudes für die Kirche ein Raum zur Unterbringung von Geräten ausgewiesen werde und sämtliche künftige Bau- und Reparaturkosten die Marktgemeinde übernehme. Bereits 1849 waren die Feuerwehrrequisiten in diesem Stadel untergebracht. Da aber die für Löscharbeiten nötigen Leitern mittlerweile bei den Reparaturen an der Kirche abhandengekommen waren, wurde schon damals eine andere Unterbringungsmöglichkeit gesucht.
Ein Platz am Oratorium?
Am gleichen Tag des Jahres 1876 fasste die KV auf Initiative des Bezirksamtes noch folgenden Beschluss:
„Es sei den Bediensteten der hervorragenden Bürgerschaft, deren Frauen, sowie den im Aufenthalte dahier sich befindlichen anständigen Fremden der Besuch des Oratoriums (von lat. „orare“ - beten – kirchenlat. für: Bethaus, Andachtsraum) zu gestatten“. Zur Bestätigung der Beschlüsse unterzeichneten die Mitglieder der KV das Protokoll, wie Alois Neumaier als Kirchenpfleger, dann die damaligen Mitglieder Franz Dachauer, Franz Pfeffer, Sebastian Lechermaier und nochmals ein Franz Pfeffer. Lediglich der „Herr Vorstand verweigert die Unterschrift“, so der Eintrag im Protokoll. Gemeint ist damit der Pfarrer, der sich dafür wohl für zu befangen erklärte. Verfügt wurde zudem: „obiger Beschluß ist den Gesuchsstellern respektive den Betheiligten gegen Nachweis zu eröffnen“. In der Niederschrift sind diese jedoch nicht genannt. Der Aufenthalt in den Oratorien war früher nur besonderen Personen vorbehalten. Oratorien befinden sich meist logenartig auf einer Empore des Chores oder des Langhauses mit Fenstern zum Hauptraum.
1882 wurde für die Periode bis 1888 eine Neuwahl der KV durchgeführt; ebenso 1888 bis 1893. Als Kirchenpfleger bewährte sich in dieser Zeit stets der schon genannte Alois Neumaier.
Am 1. Juni 1887 wurde unter Pfarrer Johann Baptist Braun (1877-1897) von der KV beschlossen, „daß aus den Mitteln der Kirchenstiftung ein neues Velum im Preise von 120-130 Mark angeschafft werde, da das einzige vorhandene durch langjährigen Gebrauch ganz defekt und unbenützbar geworden ist“. Das „Velum“ ist ein meist kunstvoll gesticktes Tuch, mit dem die Monstranz z. B. während der Fronleichnamsprozession bedeckt ist und dann vor Segnung der Gläubigen abgenommen wird.
Bau einer Kapelle
Ein Jahr später, am 11. April 1888, erklärte „sich die KV bereit, die von dem Bauern Franz Wurm von Neuaign (vulgo „Stodlbauer“) wegen Erbauung einer Feldkapelle zu erlegende Kaution von 100 Mark in Verwahrung zu nehmen und zu verwalten“. Die Kapelle steht heute noch im Bereich des Anwesens. 1889, am 10. April, wurde von der KV das „dringende und unabweisbare Bedürfnis anerkannt“ den Friedhof zu erweitern. Die Kosten dafür wurden aus dem gerade aktuellen Kirchenvermögen“ bestritten. Zugleich wurde das Bezirksamt ersucht, „daß für 2 Jahre von einer Schuldentilgung Abstand genommen werde“. Der Erweiterung diente ein Teil des sog. „Mirtlgartens“. Drei Jahre später, am 17. Juli 1892, beschloss die KV, dass „ein Kelch neu vergoldet werde, ferner die Reparatur des Kirchturmdaches und die Erneuerung des Putzes an der Kirche selbst. Um für diese Maßnahmen die Mittel bereitzustellen, wurde wiederum das Bezirksamt ersucht, dass von der „Einhaltung des Refundierungsplanes Angang genommen (= die Art der Zurückerstattung erlaubt werde) bzw. auf 2 Jahre Nachsicht gewährt werde.“
Werner Perlinger
Bei Grabarbeiten für einen Bierkeller tödlich verunglückt
+Eschlkam. Das Brauen von Bier hat in unserem Markt eine althergebrachte Tradition. Demnach wurde in Eschlkam als Sitz eines Gerichtes der bayerischen Herzöge in deren Auftrag sehr wahrscheinlich noch im 13., nachweislich aber bereits im frühen 14. Jahrhundert, Bier gesotten und vertrieben. Wie Archivalien uns mehrmals berichten, konnten später im Kommunebrauhaus 61 brauberechtigte Bürger das Jahr über ihre „Suden“ von einem eigens dafür angestellten Braumeister herstellen lassen. Deshalb weisen die Wohnbereiche des Marktes unter den einzelnen Anwesen zum Teil stattliche Kelleranlagen auf, einst gegraben in den örtlichen Fels. Der Anlass für ihre Erbauung war die Umstellung der Bierherstellung. Schrittweise wurde begonnen von der oberen warmen auf die untere kalte Gährung überzugehen. Damit erzielte man ein süffigeres, vor allem aber länger lagerfähiges Getränk. Die Temperatur durfte bei diesem innovativen Gährprozess 10 Grad Celsius nicht überschreiten - klimatische Bedingungen also, die diese tief angelegten Felsenkeller noch heute bieten. Gerade das Graben und Anlegen von Kellern geschah stets in der kalten Jahreszeit, weil dafür die Tagelöhner, auch die Knechte und Mägde kaum Arbeit hatten und so dafür zur Verfügung standen. Für diese nicht ungefährlichen Arbeiten wurden sie meist mit „Bier und Brot“ entlohnt.
Uns beschäftigt ein besonders tragischer Vorfall vom Februar des Jahres 1851, als der Gastwirt Anton Baumann von Anwesen Nr. 21 (das Haus, einst gelegen zwischen dem Anwesen Wanninger und dem heutigen Ludwig Weber- Haus, existiert schon lange nicht mehr) seine bestehende, aber zu kleine Kelleranlage vergrößern wollte. Über das für die Eschlkamer Bürger furchtbare Geschehen unterrichtet uns im Detail zunächst ein außenordentlicher Eintrag im Totenbuch der Pfarrei. Der damalige Pfarrer Karl Pittinger – er amtete von 1843-1859 – schrieb zunächst in der herkömmlichen Sterbeliste: „Anna Schreiner, Bürgerstochter von Nr. 18, ledige Dienstmagd bei Anton Baumann, verunglückte im Keller durch Einsturz der oberen Wand am 13. Februar um 4 Uhr nachmittags, 19 Jahre alt, beerdigt am 16. Februar“.
Nur der Knecht überlebte
Den Eintrag ergänzte Pittinger am Rand der Matrikel mit folgender ausführlicher Schilderung: „Der bräuende Bürger und Tanzmusikhalter Anton Baumann, vulgo Schmauß, hat bei Vergrößerung seines Kellers keine Pelzbodenhölzer (sofort einzubauende Stützen mit Bohlenbretter darüber um das neue Gewölbe abzusichern) anwenden lassen, u. in Folge dieser Unvorsichtigkeit stürzten große Abrisse des Erd- und Streugrundes herab, begruben diese Magd, welche Anfangs halb verschüttet war und zu welcher nur ihr Bruder sich hergetraute, aber auch er davon eilte, weil ein ansehnlicher Erd-Steinfall sein Leben bedrohte. Der Knecht Andreas Hartl, geboren von Kleinaign, war auch dem Tode nahe, konnte jedoch noch mit den hl. Sakramenten versehen werden und genaß doch wieder so ziemlich“.
Das Unglück meldete der Magistrat tags darauf am 14. Februar an das Landgericht Kötzting: Demnach hatte der Gastwirt Anton Baumann vor zwei Jahren hinter seinem Wohnhaus Nr. 21 einen Bierlagerkeller gegraben, ohne dass er das Kellergewölbe bisher habe ausmauern lassen. „Am Tag zuvor, den 13. Februar“, so die Niederschrift, „schickte er nachmittags um 4 Uhr seine Dienstmagd Anna Schreiner, Hausbesitzerstochter von Eschlkam (Eltern: Mathias Schreiner und Barbara, geb. Gregori von Nr. 18/Further Straße 8) und seinen Dienstknecht Andreas Hartl, Häuslerssohn von Kleinaign, in den fraglichen Keller um das auf dem Boden dieses Kellers befindliche Gestein wegzuräumen. Kaum hatten die beiden Dienstleute im Keller mit der Wegräumung des Schuttes begonnen, als das Kellergewölbe einstürzte“. Andreas Hartl, so der Bericht, „wurde wiewohl schwer verletzt gerettet und wird an seinem Aufkommen nicht gezweifelt, aber die Anna Schreiner verschüttete es ganz und zwar so stark, daß sie bisher noch nicht ausgegraben werden konnte“. Unmittelbar nach dem Unglück schickte der Magistrat „um sachverständige Werkleute, nämlich um den Maurermeister Anton Großer und Zimmermeister Roßberger (beide) von Furth, damit zur Verhütung weiteren Unglückes die Ausgrabung der verunglückten Anna Schreiner unter Leitung dieser Männer geschehen kann“. Beigefügt ist dieser Stellungnahme als Makulatur die Schilderung der Auffindung von Anna Schreiner: „Nach mühevoller angestrengter Arbeit gelang es, die Verunglückte heute Nachmittags (am 14. Februar) 3 Uhr aus dem Schutte herauszubringen. Nach Angabe des Baders Herzog (damals praktizierend in Anwesen Großaigner Straße 3) ist die Brust der Verunglückten ganz eingedrückt, daher die Anna Schreiner unmittelbar nach der Verschüttung das Leben geendet haben dürfte“.
Weiterbau zunächst eingestellt
Infolge dieser Katastrophe reagierte das Landgericht sofort. Als Sachverständiger wurde Maurermeister Wilhelm aus Kötzting als Unparteiischer angewiesen, alle Vorkehrungen zu treffen, damit der Kellerbau weiterhin vorschriftsmäßig erfolge. Der beigezogene Fachmann zeigte an, „daß er in diesen seinen Verfügungen gehindert werde, und zwar nur durch den dortigen Marktschreiber“. Es war dies Joseph Anton Beutlhauser, der seit 1847 im Dienste war. Sollte dies stimmen, erhielt der Magistrat den Auftrag, „das obwaltende Hindernis zu beseitigen“. Auch rügte Meister Wilhelm, dass ohne Rücksicht auf das Geschehene der Kellerbau von Baumann „schon wieder in Accord (Bezahlung nach Leistung) gegeben worden sei“. Sofort wurde der Weiterbau eingestellt. Zugleich betonte die Behörde, „gegen den dortigen Marktschreiber bleibt die Einleitung der Untersuchung wegen ungeeigneten Benehmens vorbehalten“. Nach längerem Hin und Her – Baumann hatte in der Zeit vor dem Unglück schon gewisse Baumaßnahmen an seinem Anwesen ohne Bauplan vorgenommen, wie die Erhöhung des Hauses um ein Stockwerk sowie den Bau eines Stadels über dem Keller – erhielt der Gastwirt nach mehreren erfolgten Sicherungsmaßnahmen am 24. Februar die Erlaubnis den Bierkeller fertig zu bauen. Damit war das landgerichtlich verfügte „Bauinhibitorium“ (Bauhindernis) aufgehoben. Wie lange aber mag infolge des Unglücks das Verhältnis zwischen den nahezu benachbart wohnenden Familien Schreiner und Baumann belastet gewesen sein?
Werner Perlinger
Als Eschlkam von durchfahrenden Wägen den „Deixlzoll“ abverlangte
+Eschlkam. Der „D(T)eixlzohl“ (eine Zollabgabe für die einen Ort passierenden Wagen und Karren) für die durchfahrenden Fuhrleute betrug beispielsweise im Jahr 1640 in Eschlkam mit den dazu gerechneten Ausgaben 3 Gulden (f); so dass 1 f 30 Kreuzer Gewinn übrigblieben. Jahrzehnte später erfahren wir im Jahr 1706 aus der Kammerrechnung des Marktes, dass an „Deichslzohl“ über 29 f verbucht werden konnten, so zwei Nachrichten aus früher Zeit über eine Einrichtung, die heute genauer vorgestellt werden soll. Wie alle kommunalen Abgaben des Mittelalters entstand diese Art Zoll aus Regalien (im Mittelalter diejenigen Hoheitsrechte, deren Ausübung dem Inhaber der Staatsgewalt hinsichtlich der Regierung und Verwaltung des Staates zustanden) des jeweiligen Landesherrn. Er verlieh das Recht, Abgaben zu erheben, an Gemeinden, um sie für Leistungen zu belohnen oder allgemeine Aufgaben aus den Einnahmen zu finanzieren. Und das traf für Eschlkam als Durchgangsort zwischen Bayern und Böhmen zu.
Wie schon angedeutet, handelt es sich hierbei um eine Abgabe, die in einem Ort vom sog. Durchgangsverkehr erhoben werden konnte und staatlicherseits auch musste. In bezeichnender Weise wurde sie bei uns über Jahrhunderte hinweg als „Deichselzoll“ tituliert, da sie erst dann erhoben werden konnte, wenn die „Deichsel“ eines mit Waren beladener Wagen von der überregional verlaufenden Straße kommend in einen Ort einfuhr und der Wagen oder Karren so erstmals auf der der Kommune gehörenden Straße weiterfuhr. Mit diesen Abgaben, deren letztlicher Erlös sich je nach der Frequentierung einer Ortsdurchfahrt ausrichtete, waren von der jeweiligen Gemeinde die Straßen in einem guten Zustand zu halten.
Wir schreiben das Jahr 1813. Am 26. Juli wendet sich die „Königliche Ober Bauinspection Straubing“ an die damals titulierte „Königliche Communal Administration in Eschelkam“ und forderte zu melden, „wie viel das jährliche Erträgniß des Pflaster = Wege und Brücken Zolles betrage, nach welchen Tarif die Erhebung geschehe, wozu und namentlich für welche Brücken, Wege und Pflaster diese Gelder verwendet werden“. Die Marktgemeinde wurde „höflichst angegangen bald gefällige (hier: zutreffende) Angaben“ dazu an die Regierung zu liefern. Das Schreiben unterzeichnete als damals hoher Beamter der Oberbauinspektor Amman.
Die Marktführung, in diesem Fall nur der Marktschreiber Bach als der für die Führung der politischen Marktgemeinde seit 1808 eingesetzte „Kommunaladministrator“, listete bereits einen Tag später die Einnahmen von den Jahren 1801 bis 1812 auf und meldete einen jeweiligen Jahresdurchschnitt von 62 Gulden 59 Kreuzer (1 Gulden entsprach 60 Kreuzer)
Verwalter der Gemeinde
Zu dem amtlichen Titel von Bach sei erneut erklärt: Sämtliche bisherige Aufgaben wurden ab 1808 bis 1819 landesweit allein nur eigenen von der Regierung aufgestellten „Kommunaladministratoren“ übertragen. Für Eschlkam war, wie in anderen Gemeinden auch, für diesen neu geschaffenen Posten der entsprechend dafür verwaltungsjuristisch gebildete Marktschreiber als „Komunaladministrator“ bestimmt. Er führte die Rechnungsbücher der Marktgemeinde und bestimmte allein den Verlauf der für den Markt wesentlichen Initiativen.
Am 4. August erklärte Bach, „es bestehe ein Zoll, sog. Deichselzoll mit der Verwilligung, daß von einem beladenen Wagen 4 Kreuzer, von einem unbeladenen 2 Kreuzer und von einem Karren ebenfalls 2 Kreuzer zu erheben (seien), und (dieses Geld) auf die durch den Markt gehende Landstraße zu verwenden ist“. Im Jahre 1808 sei „beim Eintritt in die neue Marktorganisation die Existenz dieses Zolls bestätigt worden. Da es aber der Kommune an Mitteln mangelt, da die Erträgnisse desselben sich nach zehnjähriger Durchsicht (etwa nur) auf 62 Gulden 59 Kreuzer belaufen, die Reparatur der Straße (aber) in Anbetracht dessen (des geringen Betrages) der Bürgerschaft nach allerhöchster Verordnung aufgebürdet worden ist“.
Gleichwohl aber „befaßt (beträgt) das Kommunalvermögen selbst bisher so viel, daß die mit 2 Vicinalwegen (die zwei Handelsstraßen nach Neuaign und nach Neukirchen) ohnehin belästigte (stark belastete) Bürgerschaft von diesem Frohndienst immer befreit bleiben und von dem eingenommenen Gefäll (die geleisteten Steuern) so manche jährliche Reparatur bestritten werden kunte und erst der Überrest der Communal Cassa zu Gute kam“. Ferner informiert das Schreiben, dass vom Landgericht Kötzting von der Kommunaladministration zusätzlich „Überschläge über die allenfalls vorhandenen Straßenreparaturen einbefördert worden sind“. Aus dem Schreiben des Marktes geht eindeutig hervor, dass die Einnahmen an „Deichselzoll“ kaum reichen, davon die jeweils nötigen Reparaturen an den beiden Straßen zu bezahlen.
Bürger als Zolleinnehmer
Ergänzend sei erwähnt, dass in der Regel zwei Bürger als „Zolleinnehmer“ bestimmt wurden. Sie hatten die manchmal undankbare Aufgabe an dem die Straße sperrenden „Schrankbaum“ von den Fuhrleuten den Zoll zu kassieren. 1803 erfüllten diese Aufgabe der Hufschmied Michael Schamberger (Hsnr.6/Kleinaigner Straße 1) und Michael Schmotz (Hsnr. 20/Marktstraße 1). Der Schmied, sein Anwesen lag direkt an der Straße, musste bei jenen Wägen, die (von Furth kommend) „herein passieren“ und Schmotz bei denen, „die bei ihm vorbey und hinab (in Richtung Furth) führen“ die Steuer abverlangen, dies eigens protokollarisch vermerken und „die Zeichen (als Quittungen für die erfolgte Bezahlung) austeilen. Deren sicher nicht immer leicht zu verrichtenden Dienste wurden jährlich mit 6 Gulden abgegolten. Ausbezahlt wurde dieser Lohn, insgesamt 12 Gulden, vom damaligen Amtsbürgermeister Anton Prückl. Er war Eigentümer des Anwesens Nr. 60, heute Marktstraße 15. An diese damaligen Zolleinrichtungen erinnert noch der Name „Schrankbaumgasse“ im neueren Teil des Marktes.
Werner Perlinger
Interessante Inhalte aus den „Verlöbnisprotokollen“ des Marktarchivs
+Eschlkam. Bürger, die über ein gewisses Besitztum verfügten, ließen ihr Vorhaben, eine Ehe eingehen zu wollen, im Magistrat der Städte oder Märkte notariell niederschreiben. Damit wurden noch vor der kirchlichen Trauung feste Absprachen zwischen dem Bräutigam und seiner Braut getroffen. Es seien solche Vorgänge nun vorgestellt:
„Aus 61 Köpfen der hiesigen Bürgerschaft haben 44 (bereits am 12. April 1801) die Einwilligung erteilt, daß Franz, Sohn des Andrä Meidinger, gewesten Bürgermeisters und Schneidermeisters allhier, dann Elisabetha, dessen Frau Eheconsortin, beide nun seelich (+) ehelich erzeugter Sohn“, von Beruf auch ein Schneider, „sich mit der tugendsamen Katharina, Tochter des ebenmäßigen Schneidermeisters Johann Denzl und seiner Frau Margaretha in eine eheliche Verbindnis einlaßen darf“. Zwei Schneidermeister, nämlich Meidinger und Denzl waren bereits verstorben. Der junge Meidinger will das Handwerk seines Vaters weiterführen und deshalb wurden sämtliche hausansässigen Bürger, es waren damals 61, befragt, ob sie gegen diese Verbindung Einwände hätten. Wie die Zählung ergab, war mit über 70 % der Befragten eine satte Mehrheit dafür „Franz Meidinger auf so eine Art als Meister ordentlich an- und aufzunehmen“, so dass am 19. Mai 1801 das „Verlöbnis“, eine Ehe eingehen zu wollen, „obrigkeitlich ratifizieret und zur Legitimation (ein) Extrakt (Auszug) erteilt (wurde) im Beisein der Zeugen Paul Pach, Schreiber und Joseph Hölzl, Hafner.
Wir schreiben das Jahr 1802. Am 5. Februar erschien im Rathaus „Joseph Schöppel, als des Michael Schöppel gewesnen burgerlichen Fleischhackers allhier, und Theresia dessen Eheweib, beide seelig (verstorben) ehelich erzeugten Sohn, der heute als Bürger und Metzger (von Nr. 34/Marktstraße 5) an- und aufgenommen worden ist, mit der tugendsamen Jungfer Theresia, des Herrn Michael Grauvogel, gewesenen Baders und Bürgermeisters seelig; dann Rosalia dessen Hausfrau noch in vivis (am Leben) ehelich erzeugten und unter Beistandsleistung von Herrn Michael Schamberger, Hufschmieds, gegenwärtigen Tochter mit Einverständnis der beiden nächsten Anverwandten getroffenen Eheverlöbnis wird, nachdem die Teile das obrigkeitliche Handgelübd (mit Reichung der Hände versprochen) abgestattet, notificiert (angezeigt) und zur Legitimation (ein) Extrackt (Auszug) erteilt in Beisein der Gezeugen Franz de Paula Pach, Schreiber und Herr Joseph Hastreiter des Innern Rats Bürgermeister“. Insgesamt kostete die Niederschrift an Verwaltungsgebühr 1 Gulden und 36 Kreuzer. Diese wurde – so eigens vermerkt – „ad fundum pauperum“ (an den Armenfond) weitergeleitet.
Amtlich festgehalten
So und ähnlich lauten eine ganze Reihe von überlieferten sog. „Verlöbnisniederschriften“. Die Absicht zu heiraten war somit nicht nur privat sondern auch amtlich festgehalten. Einen ebenso gleichen Vertrag schlossen am 6. September gleichen Jahres der Hutmacher Jakob Fischer aus Oberrappendorf und die „verwitwete bürgerliche Hutmacherin Magdalena Lipplin“ (von Nr. 55/Blumengasse 7). Der gleichen amtlichen Prozedur unterzogen sich im Jahr 1803 am 28. Januar „mit Einverständnis der nächsten Anverwandten der ehrbare Andrä Kilger, Bürger und Weißbäcker allhier“, Sohn des Bäckers gleichen Namens (von Nr. 58/Blumengasse 2) und die „tugendsame Magdalena“, Tochter des bereits (+) und vorher genannten Baders Grauvogel. Am 8. November versprachen sich der Seifensieder Johann Georg Schreiner, Sohn des Schweinehändlers Michael Schreiner (von Nr. 35/Marktstraße 7) und dessen Frau Josepha und die „tugendreiche Jungfer“ Katharina, Tochter des Hufschmieds Michael Schamberger und seiner „Eheconsortin“ Magdalena. Zeugen waren hier Franz de Paula Pach, Schreiber und der Riemer Anton Hausladen. Im Gegensatz zum obigen Fall Meidinger war in den weiter geschilderten „ehelichen Verlöbnissen“ eine Befragung der Bürgerschaft nicht nötig, da der jeweilige Bräutigam im Gegensatz zum Schneider Meidinger hausansässig war.
Das „Kranzlgeld“ als Anspruch
War erst einmal ein solches „Verlöbniß Protokoll“ niedergeschrieben und angelegt, stand der in absehbarer Zeit folgenden Heirat eigentlich nichts mehr im Wege. Dennoch, wurde ein solcher sog. „Erstvertrag“ von einer Seite mutwillig oder aus welchen Gründen auch immer gebrochen bzw. aufgehoben, konnten von der Gegenseite meist Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Dies waren Ansprüche, die sich beispielsweise aus bereits getätigten Ausgaben für den künftigen Ehestand ergaben. Mit herein spielt auch das früher in der Regel gegen den männlichen Partner erhobene „Kranzlgeld“. Als >Kranzgeld< bezeichnete man in Deutschland eine finanzielle Entschädigung, die eine „unbescholtene“ Frau von ihrem ehemaligen Verlobten einfordern konnte, wenn sie auf Grund eines Eheversprechens mit ihm Geschlechtsverkehr hatte und er anschließend das Verlöbnis löste. Gleiches galt auch für neuverlobte Witwen.
Betrachten wir diese amtlichen Vorgänge, so ist zu erkennen, dass bereits vor über 200 Jahren erste Ansätze entwickelt waren, aus denen später sich die Institution „Standesamt“ entwickeln sollte, so wie wir es heute kennen.
Keine Heiratserlaubnis
Von diesen Darlegungen ist hier jedoch scharf die behördliche oder dienstherrliche Heiratserlaubnis zu trennen, die bis in die lehensherrliche Zeit des Mittelalters zurückgeht. Sie allein war früher ein allzu oft ausgeübtes Druckmittel auf die kleinen, besitzlosen Leute – vor allem Knechte und Mägde – die sozial und wirtschaftlich abhängig waren. Mit dem Gemeindeedikt von 1818 wurde im Königreich Bayern der „Heiratkonsens“ den Gemeinden übertragen. Grund- und Hausbesitz, Steuerabgabe, Heimatrecht, ein einwandfreier Leumund waren unter anderem Voraussetzung für eine Heiratsgenehmigung. Erst ein Gesetz von 1868 brachte wesentliche Erleichterungen, die im Zweiten Reich unter dem Reichskanzler Otto von Bismark im Reichszivilehegesetz vom Februar 1875 fortgesetzt wurden.
Werner Perlinger
Als die „Grenzfähnler“ den Schießübungen oft gerne fernblieben
+Eschlkam. In Fortsetzung der Inhalte aus dem ältesten Ratsprotokoll des Marktes sei folgendes angeführt: 1696, am 11. April „seint gesessen“ Johann Lährnbecher als Amtsbürgermeister, Wolf Sighardt Altmann, Andre Hastreiter und Peter Lährnbecher, Mitglieder des Inneren Rats, sowie Hans Fleischmann und Hastreiter als Mitglieder des Äußeren Rats. Anfänglich wurde der versammelten Bürgerschaft das „Steuermandat“ zur Information vorgelesen. Anschließend wurde der in „der Bürgerschaft eingerissenen schendlichen Mißbrauch, daß nemblich etwelche Burger in Nachtszeit umbgehen oder (ge)sehen werden, es habe dan die Tabakh Pfeifen im Maull“. Da dies eine „schendliche Gewohnheit (ist), also wird dies bei Androhung einer Geldstrafe in Höhe von 1 Pfund (= 1 Taler) verboten. Zum Ende des 17. Jahrhunderts machte sich allerorten die Gewohnheit breit in der Öffentlichkeit zu rauchen. Zigaretten gab es damals noch nicht. Man musste sich mit dem Pfeifenrauchen begnügen. Viel hat es wohl nicht geholfen, denn die „Sucht“ des Rauchens wurde - wie bekannt - im folgenden 18. Jahrhundert und danach immer beliebter.
In einem weiteren Punkt der Tagesordnung mussten sich die Ratsherren mit dem Schützenwesen beschäftigen: So wurde von Amts wegen befohlen, dass der Weißbäcker Hans Vogl, der Schmied Hans Stephl, der Müller Hans Penzkover, Wolf Späth, der Bäcker Georg Tenzl und der „Wöber“ Paulus Fritz beim nächsten „Zihl Schiessen sich als Schützen einfünden, und damit 3 Jahr continuiren sollen“.
Im Hohenbogen-Winkel waren damals sämtliche wehrfähigen Männer in der sog. „Grenzfahne“ militärisch organisiert. Dazu gehörte es, dass sämtliche Mitglieder in Eschlkam, so auch in Neukirchen b. Hl. Blut und in der Stadt Furth an den regelmäßig festgesetzten Schießübungen zu beteiligen hatten, um gute Schützen „heranzuziehen“. Bei vorsätzlichem Fernbleiben gab es Strafen, meist in Geld. Die Protokolle berichten häufig von solchen Verstößen. Das hatte seinen Grund darin, dass die Schießübungen meist an den Sonntagen nach dem Gottesdienst stattfanden. Und mancher Schütze blieb fern, um sich mehr den sonntäglichen Vergnügen hinzugeben.
In der gleichen Ratssitzung wurde ein Michael Stich aus Neuhaus „aus dem Königreich Böhmen, seines Handtwerks ain Strimpf strickher“ nicht als Bürger, jedoch als „Insass“ (nur in Miete wohnend und nicht als Hausbesitzer) aufgenommen, da ein solches Handwerk im Markte noch nicht vorhanden war, aber ein Bedarf dafür bestand. Damals gehörten zur Tracht der Männer wie auch der Frauen meist blaue oder weiße gestrickte Strümpfe, wie uns beweislich heute noch viele Votivbilder aus dem 17. und 18. Jahrhundert zeigen.
1697, im Oktober, wurde der Markt von einem schweren Gewitter heimgesucht. Dessen ungeachtet erlaubte der Gastgeber Wolf Späth (Nr. 4/Waldschmidtstraße 6) für die Leute, „welche seinen Flax ausgeprecht (den Flachs „gebrochen“ bis zu einem spinnfähigen Faden), den sogenanten alten Man / gleichsamer Gunkhel / nachtlicher Weill bei dem am Himmel gehabten Hochgewitter zu halten“. Dabei nahmen teil „etwelche Manspurschen“ (wie die Schneider) Wolf Zilkher, Stephan Meidinger, dann die Brüder Andre Fridl, Weber und Christian, Hafnergeselle. Deshalb wurden am 29. Oktober zur Strafe der Wirt Späth „6 Stundt ins Markhthaus, (die) übrigen aber in das Kellerl (kleiner Gefängnisraum im UG) condemniert“ (hier: verurteilt bzw. gesperrt).
Eine „Kunkel“ oder „Gunkel“ ist ein Spinnrocken. Die Kunkel- oder Spinnstuben waren früher Treffpunkte meist für die Frauen im Ort. Gewöhnlich wurden Handarbeiten verrichtet, aber auch magisches Frauenwissen weitergegeben. Oft trafen sich dabei auch die unverheirateten Männer und Frauen zu Tanzveranstaltungen, die aber die Kirche gar nicht gerne sah und sie stets zu verhindern suchte.
Georg Vaist, Mitglied des „Äußeren Rates“ hatte an den Sattler Wolf Cramer sein Haus (Hsnr. 50/Blumengasse 20) verkauft. Aber weil „bei hiesigen Markt von alters Herkommen, daß kein unangesessener (hausansässiger) Burger für ain Ratsfreindt zugelassen werden solle“, musste Vaist seinen Sitz im Marktrat abgeben. Für seine bisherige „aufrichtige Ratsverrichtung“ dankte ihm die Bürgerschaft. Im neuen Jahr 1698 wurden von der aufgerufenen Bürgerschaft am 31. Januar für Hans Fleischmann der Weißbäcker Hans Peter Thirankh und für Georg Vaist Hans Späth in den „Eyssern Rhat erwöhlt“.
Am 8. Mai 1699 klagte der Bader Stephan Mauser, damals auf Anwesen Nr. 7/Kleinaigner Straße 3, gegen den Bürger Wolf Zilkher (es war dies wohl der Schreiner „in der Paindt“, Nr. 9/Kleinaigner Straße 7). Dieser habe am Palmsonntag im Gasthaus des Wolf Späth (siehe oben) ihm „beim Pier“ vorgeworfen, „er seye ihm nit gleich, wann heint ain Paur herein khombt und Bürger wirdt, ist er so guett als wür“. Als dann der beklagte Zilkher dem Mauser „ain Glas Pir ins Gesicht geschidt“, haben beide mit einander ein „Haargereif gehalten“ (eine eher harmlose Rauferei). Dem Ganzen ging ein Kartenspiel voraus, wobei Mauser den Zilckher öfter „einen alten Mahn hin- und her gehaißen“ hat, dann „weil du derzeit ein Viertelmaister (Ortsteilsprecher) bist, soll man auch was auf dich geben“. Und obwohl Zilckher bereits als ein „50.jähriger Mann“ und der „Cleger als ain junger Burger, zum Rauffen- und schlagen nit gleich sei“ habe er das Restbier in seinem Glas, „so (nur)bei 2 Löffel voll geschidt“, dabei aber den Mauser nicht getroffen. Vielmehr habe der Bader dem Zilckher „ainen solchen Maulstraich (Watschen) versezt, daß dieser „über die Panckh hinab gefallen und ihm also das Blut starkh aus der Nasen geflossen ist“.
Der Streit ging in den Aussagen hin und her, und das Marktgericht erkannte, dass beide sehr „bezecht“ gewesen, und das zur „österlichen Communions Zeit: und (weil das) in so spätter Nacht nit gebührt hat“, wurden beide „zu besserer Beschaidenheit ermahnt“ und zu gleichen Teilen mit einer Geldstrafe in Höhe von 1 Pfund Pfennige (1 Reichstaler) belegt, was für jeden ½ Taler bedeutete.
Werner Perlinger
„Instrumente sehr nothwendig“ - aus dem Sessionsprotokoll des Marktes von 1848/49
+Eschlkam. Im Archiv des Marktes Eschlkam finden sich neben Ratsprotokollen auch sog. „Sessionsprotokolle“ aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Name ist für den Leser vielleicht nicht sofort verständlich. Protokolle mit diesem Titel sind nichts anderes als sog. Sitzungsprotokolle oder Niederschriften. Dabei wurden – wie in den herkömmlichen Ratsprotokollen auch – die in den Sitzungen der Markträte gefällten Entscheidungen niedergeschrieben bzw. protokolliert. Wir wählen den Jahreszyklus 1848/49. Dabei fällt ein Vorgang ins Auge, der am 21. Dezember 1848 abgehandelt wurde. Thema war „die Bitte des Baderlehrlings R. Kleebauer um Ankauf chirurgischer Instrumente“. Einen Beschluss darüber fassten der Magistrat mit Bürgermeister Sämmer an der Spitze und auch Mitglieder der Lokalarmenpflege, wie Pfarrer Karl Pittinger. Gerade in diesem nur kurz geschilderten Vorgang kommt bereits soziales Denken der Entscheider zum Tragen: Demnach war R. Kleebauer, der Vorname ist nur abgekürzt erwähnt, bei dem Chirurgen (Anton) Schoepperl in Furth in der Lehre. Dieser übte den Beruf eines Baders und Chirurgen (Wundarzt) um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Anwesen Kreuzkirchstraße 1aus, dem heutigen Thomas-Morus-Haus. Kleebauer stellte als „gänzlich unbemittelt“ an die „Localarmenpflege Eschlkam“ die Bitte, „ihm ein halb Dutzend Rasiermesser mit einer Scherr, ein Aderlaßzeug, einen Schröpf- apparat, einen Zahnschließl mit einer Zange, einen Rasiermesserstein zum Abziehen (des Bartes) und ein Aderlaßlanzett“ insgesamt im Wert von etwa 15 Gulden aus den Mitteln der Armenpflege zu finanzieren. Er betonte, dass diese „Instrumente während der Lehrzeit nach Zeugnis seines Lehrherrn sehr nothwendig“ seien.
Da die Mittel des Armenfonds sehr beschränkt waren, beschloss das Gremium dennoch, dem Kleeberger aus dem Fond wenigstens „3 Rasiermesser, einen Rasiermesserabzugsstein und ein Aderlaßzeug anzuschaffen“. Er durfte diese Gegenstände „während seiner Lehrzeit (so lange) gebrauchen, als er bei dem Chirurgen Schoepperl in Furth verbleibt und sich ordentlich daselbst aufführt“. Die so vorfinanzierten Gebrauchsgegenstände hatte er am Ende seiner Lehrzeit an die Lokalarmenpflege zu geben. Als soziale gemeindliche Einrichtung war sie tätig geworden, weil Kleeberger nach Feststellung des Magistrats „gänzlich unbemittelt sei, da ihm seine Mutter, welche nur so viel hat, als sie durch Händearbeit sich verdient, nicht das minderste geben kann“. Insgeheim hofften die Entscheider, dass Kleeberger sich im Markte als Bader niederlassen könnte, nachdem die sog. Baderei im alten „Badhaus“ (Kleinaigner Straße 3) bereits einige Jahre nicht mehr existierte (siehe dazu Artikel: Das ehemalige „Badhaus“ im Markte). Anzumerken wäre noch, dass Kleeberger vor Beginn der Lehre offenbar beste schulische Noten vorweisen konnte, denn die Möglichkeit den Beruf eines approbierten Baders zu erlernen, der zugleich auch als „Wundarzt“ (Chyrurgus) tätig war, stand nicht jedem offen.
Heirat des Marktdieners
Wenig später genehmigte der Magistrat mit Bürgermeister Sämmer an der Spitze die Verehelichung des Marktdieners Franz Pinzinger mit der Häuslerstochter Anna Prantl aus Stachesried. Dabei wurde festgestellt, dass Pinzinger als „Markt- u. Polizeidiener“ vorerst wohl nur „provisorisch angestellt“ ist, (ferner) über „ein Besitzthum an Gründen laut Übergabscontract vom 23. Jänner 1848 verfügt, daß sich von den Erträgnissen derselben eine Familie allein schon ernähren kann“. Auch bezieht Pinzinger als „Markt-, Polizei- und Kirchenverwaltungsdiener u. als Hauptzollamtsbote einen jährlichen Gehalt von 200 Gulden“. Somit sei der „Nahrungsstand nachgewiesen“. Die Bewilligung zur Verehelichung sei somit zu erteilen. Ebenso erhielt am 2. April der bereits seit zwei Jahren als Marktschreiber in der Gemeinde tätige Joseph Anton Beutlhauser die Erlaubnis, Anna Serve, Glashüttenverwalterstochter von Herzogau, zu heiraten. Gelobt wurde die Dienstpflicht des Antragsstellers, wie auch, dass sein jährliches Gehalt genüge, eine Familie zu ernähren.
Keine Brauerlaubnis
Am 9. Mai stellte Joseph Neumaier, damals Besitzer des „Hoamater“-Anwesens Nr. 1 (heute Gasthof Penzkofer) den Antrag, ihm den „Austritt aus dem dortigen Communbräuhause (zu erlauben) und (zugleich) um die Conceßion zu einer (eigenen) Braunbierbrauerei“. Das Gesuch wurde vom Magistrat rundweg abgelehnt, „weil die Errichtung eines Bräuhauses an dem beabsichtigten Platze als feuerpolizeiwidrig erscheint, da in der Nähe herum hölzerne Gebäude stehen, weiters, weil Neumaier die vorgeschriebene Gewerbskunde nicht besitzt und drittens, weil durchaus keine Nothwendigkeit zur Errichtung eines neuen Bräuhauses vorhanden ist, da der Gesuchsteller so viel in dem Communbräuhause brauen kann, als er nur immer will“. Es sollte noch sehr lange dauern, bis sich im Markte eine private Brauerei etablieren konnte (siehe dazu ausführlich in „Eschlkam in alter Zeit – von den Anfängen bis zur Moderne“, Band I, S. 323 den Absatz: Eine neue Brauerei im Markte?).
Die Erntezeit ging ihrem Ende, da beschloss der Marktrat, „auf dem der Gemeinde gehörigen Platzl zunächst der Behausung des bürgerlichen Bäckermeisters (Franz) Rötzer (Further Straße 4 u. 6) und des Hausbesitzers Georg Weber (Marktstraße 1) eine Feuerrequisitenhütte“ im Wert von 10 Gulden aufzustellen. Gründe für den Bau waren, dass die Feuerleitern und die Feuerhaken bisher in der sog. „Heiligenschupfe“ (d.h. zum Ökonomiepfarrhof gehörig) lagern. Da aber bisher die Leitern beschädigt (wurden), ja sogar „abhanden kamen, da die bei dem Kirchenumbau beschäftigten Arbeiter die Leitern ohne Anfrage zu ihrem Gebrauche nahmen“, war es nötig geworden, einen Ort für eine sichere Aufbewahrung zu suchen. Dafür wurde nun der damals noch der Gemeinde gehörende Platz unmittelbar neben dem Anwesen des Bäckers Rötzer ausgesucht. Noch dazu musste die Gemeinde dafür nicht bezahlen. Mit ein Grund dafür war auch die zentrale Lage des Platzes innerhalb des Marktes und die „leichte Zugänglichkeit“. An Stelle dieser Einrichtung für die damalige Feuerwehr steht heute die Doppelhaushälfte Further Straße 6.
Werner Perlinger
Der Stadelbau des Joseph Lemberger ohne baurechtliche Genehmigung?
+Eschlkam. Der Bäckermeister Joseph Lemberger hatte im Jahr 1847 eine größere Baumaßnahme in seinem Hausbereich Nr. 37/38, heute Marktstraße 11, getätigt. Am 16. Juli schreibt das Landgericht Kötzting an den Magistrat von Eschlkam, dass Lemberger „an seinem Stadel eine Hauptreparatur vorgenommen hat, indem er denselben um 8 Schuh (ca. 2,5 Meter) erhöht und neue Säulen gesetzt hat, und gab derselbe am 2. Juli dahier zu Protokoll, daß der Magistrat ihm die polizeiliche Bewilligung zur Vornahme dieser Reparatur ertheilt habe“. Mit diesem Verwaltungsakt der Gemeinde – die Erteilung der Baugenehmigung - gab sich die dem Magistrat übergeordnete Behörde nicht zufrieden; sie fühlte sich übergangen, da der Magistrat „zur Ertheilung einer solchen Bewilligung und überhaupt in Bausachen nicht kompetent ist“, so die scharfe amtliche Rüge. Daher wird der Magistrat, insbesondere der Bürgermeister, „welcher hiermit haftbar erklärt wird, beauftragt, sich binnen acht Tagen schriftlich hierüber zu verantworten“.
Der Bürgermeister antwortete „gehorsambst“, dass der Bäcker Lemberger „nur bei seinem Stadel eine etwas einwärts hängende Säule gerade stellen und dann zugleich den Stadel ein wenig höher machen wolle“. Da der von Lemberger vorgebrachte Bauantrag vom Magistrat fälschlicherweise nicht „als Hauptreparatur erkannt wurde, ebenso nicht als ein Neubau und in solchen Fällen auch kein Bauplan nothwendig ist“, habe man das Landgericht „mit diesem Gesuch nicht behelligen“ wollen. Offenbar gab sich das Landgericht mit dieser Stellungnahme letztlich zufrieden.
Den Rechtsweg eingehalten
Am 26. August erschien Lemberger erneut vor dem Magistrat, übergab einen vom „Maurermeister von Furth (der Name ist nicht genannt) ausgefertigten Plan gemäß welchen er beabsichtigt, sein altes neben dem Hauptgebäude stehendes Häuschen niederzureißen und neu aufzubauen.“ Hierbei handelte es sich um die Nummer 38, das als Austragshaus zu Nr. 37 diente.
Der Magistrat zeigte sich mit dem Wunsche des Lemberger zufrieden, forderte aber in seiner gegen ihn gerichteten Verfügung, unterzeichnet vom damaligen Marktschreiber Beutlhauser, die „Adjacenten“ (Anlieger) zu fragen, ob sie dagegen Einwände hätten. Es kam aber nur einer in Frage. Das war der Bürger Georg Forster von Haus Nr. 36, heute Marktstraße 9. Er hatte gegen das Vorhaben keinerlei Einwände, ebenso nicht auch das Landgericht Kötzting, das nun entsprechend der gesetzlichen Vorgaben befragt worden war. Vom Magistrat wurde lediglich gefordert, „die planmäßige Bauführung, welche unter Leitung eines konzessionierten Werkmeisters zu geschehen hat, zu überwachen“. Lemberger konnte sein Vorhaben, nämlich „Neubau eines Stalles mit darüber befindlicher Wohnung“ nun verwirklichen. Bei Durchsicht einzelner dieser und ähnlicher Akten sehen wir, dass bereits im 19. Jahrhundert der Bereich >Bauwesen< langsam den rechtlichen Normenkatalog erhielt, wie er heute bei Bauvoranfragen und Genehmigungen amtlicherseits in entsprechenden Variationen zur Anwendung kommt.
Alte Hausnamen
An dieser Stelle sei ergänzend einiges zur Geschichte dieses doch stattlichen Anwesens angeführt: Gelegen direkt an der Abzweigung der Blumengasse, trägt es heute noch den Hausnamen „beim Lichtseiderer“, erinnernd an den ehemaligen Besitzer, den Elektromeister Xaver Seiderer. Älter jedoch ist der Hausname „beim Brücklbäck“. Das erklärt sich daraus, dass der Bäcker Joseph Lemberger im Jahr 1822 durch Einheirat in den Besitz dieses Anwesens kam. Er selbst stammte aus dem Haus Nr. 61, Großaigner Straße 1. Von dort brachte Lemberger den Hausnamen mit, denn dieses Anwesen war von 1758 bis 1804 in Besitz einer Familie Brückl, die dort zeitweise auch eine Bäckerei betrieb. Noch älter sind bei dem hier behandelten Anwesen in der Markstraße die Beinamen „im Hof“, oder auch „Hoamater“, da das gesamte Anwesen Nr. 37/38 wohl noch im 17. Jahrhundert durch eine „Wegteilung“ von einem der „Hoamater“-Höfe an der Waldschmidtstraße entstanden ist.
Ein Ersatz für den Pfarrhof
Eine interessante Geschichte weist auch das unmittelbar benachbarte Anwesen des Forster auf:
Im Jahr 1634 fallen die schwedischen Völker von der mittlerweile niedergebrannten und ausgeplünderten Stadt Furth kommend in Eschlkam ein, plündern und brennen den Markt zum Großteil nieder. Dabei wird die nach den Hussitenkriegen wieder erbaute Kirchenburg stark zerstört und damit auch die darin enthaltenen Wohnbereiche für den Pfleger und den Pfarrer. Letzterer zieht daraufhin in das wahrscheinlich einigermaßen heil gebliebene Anwesen Marktstraße 9 um. Es diente dann für längere Zeit bis 1679 als Ausweichquartier für die am Ort tätigen Pfarrer. Erst ein Hans Hauser, Weißbäcker, kauft für 240 Gulden „des Gottshaus oder Pfarrers Behausung, so ein Burgersgut ist“. Aus dieser knappen Formulierung ist zu erkennen, dass Jahrzehnte vorher dieses Haus sich in privatem Besitz befand. Von 1660-1682 wirkte in Eschlkam als Pfarreiprovisor der Pater Johann Altmann. Er kam vom Kloster Windberg. Ihm war es vergönnt in den letzten Jahren seiner Tätigkeit in den neuen Pfarrhof einziehen zu können, nun erbaut in der Mitte des Marktes.
Werner Perlinger
Wahlen zum Armenpflegschaftsrat in Eschlkam im Jahr 1842
+Eschlkam. Im 19. Jahrhundert spielte in den Städten, Märkten und auch in den Dörfern die Organisation der Armenpflege eine nicht unbedeutende Rolle. Dieses Thema, das im politischen Geschehensablauf einer Gemeinde eine Nebenrolle zu spielen schien, gehörte dennoch zu einem wichtigen Bereich bei der Führung einer Gemeinde. Die Tradition der Armenpflege und die damit befasste Organisation sind weit älter als man zunächst vermuten möchte.
Dazu folgende allgemeine Erörterung: Im Mittelalter wurde die Armenpflege ausschließlich von der Kirche organisiert und durchgeführt. Klöster, Stifte und Spitäler waren die federführenden Einrichtungen. Im Spätmittelalter verlagerte sich die Finanzierung auf die Städte und Gemeinden, da diese beim Volke ein größeres Vertrauen genossen. Von den Landesherren wurde mitunter angeordnet, dass die ärztliche Betreuung der Armen kostenfrei war, wie es beispielsweise bereits in der „Heidelberger Apothekerordnung“ von 1471 niedergelegt worden war. Die Erbauung städtischer und öffentlicher Badehäuser sollte das unentgeltliche Baden von Armen und Hilfsbedürftigen ermöglichen, wobei diese Angebote auch mit städtischen oder staatlichen Hygiene- und Gesundheitspraktiken in Verbindung zu bringen waren.
Die Organisation der Armenpflege war zur Zeit der Reformation, zwischen 1517 und 1648, auf eine grundlegende Regelung festgelegt, sie war als allgemeine Bürgerpflicht fest verankert. Neben der öffentlichen Armenpflege entwickelte sich parallel ein genossenschaftliche Zweig, der sich als eine wichtige Rolle zur späteren Sozialversicherung entwickelte. Berufliche Organisationen, Verbände und Gemeinschaften übernahmen die Unterstützung von kranken und notleidenden Mitgliedern.
Mit der wirtschaftlichen und industriellen Revolution in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ebenfalls eine soziale Revolution. Die großbetrieblichen Werkstätten und Fabriken brauchten viele Arbeitskräfte. Das Landvolk wanderte in die Städte. Es entstanden dort bisher nicht gekannte soziale Probleme. Die Armenpflege in den ländlichen Regionen verblieb bei der Familie, bei der Kirche oder letztlich bei der Gemeinde.
Einen Wahlausschuss gebildet
Und so war es auch im Markte Eschlkam, gelegen nahe an der Grenze zu Böhmen. Ein ganzer Fundus von Akten berichtet den Archivbenützer über dieses Thema. So musste beispielweise um die Mitte des 19. Jahrhunderts wieder ein „Armenpflegschafts-Rath“ gewählt werden, so für die Periode der Jahre 1842/45. Befasst damit war ausschließlich der Magistrat.
Am 3. Dezember 1842 wurde eigens ein Protokoll über die „Kostituierung des Wahlausschusses zur vornehmenden Wahl des Armenpflegschaftsrathes im Markte Eschlkam“ angefertigt. Anwesend dazu waren Pfarrer (Wolfgang) Kolbeck (er leitete die Pfarrei von 1828-1843), Bürgermeister Michel Kaufmann und der Marktschreiber (Franz) Bach, letzterer, bereits in hohen Jahren stehend, war der Vater des Genre-, Tier- und Landschaftsmalers Alois Bach. Laut Inhalt dieses Protokolls wurden zunächst die 12 Gemeindebevollmächtigten auf das Rathaus vorgeladen und gemäß der vorgegebenen Wahlordnung der Wahlausschuss, einmal aus zwei Abgeordneten des Magistrats und dann zwei aus der Reihe der Gemeindebevollmächtigten bestimmt. Vom Magistrat wurden dafür Joseph Römisch und Mathias Späth bestimmt, von den Gemeindebevollmächtigten Ignaz Koller und Joseph Neumaier. Ihr nunmehriges Amt bestätigten die vier Bürger mit ihrer Unterschrift.
Im Anschluss wurde „dem ¾ Theile der erschienenen 9 Gemeindebevollmächtigten eröffnet, dass die Wahl schriftlich mittels Wahlzettel vor sich zu gehen habe und daß jeder Gemeindebevollmächtigte 6 Individuen zu wählen hat, von denen 4 als Armenpflegschaftsräthe und 2 als Ersatzmänner vorbehalten bleiben“. Anschließend wurden von diesem Gremium die nummerierten Wahlzettel „gehoben“ und zur Wahl geschritten. Diesen Vorgang bekräftigten mit ihrer Unterschrift Bürgermeister Kaufmann und der Marktschreiber Bach. Es folgte „die Ausscheidung (Zählung) der Wahlstimmen“. Als Ergebnis ergab sich, dass „Michael Meidinger, Schneider, Franz Vogl, Bäck; Alois Schmirl, Schuster; Ignaz Schmirl, Schuhmacher und Anton Joseph Schöppl, Metzger, „alle fünf mit 9 Stimmen, dann Anton Baumann, bräuender Bürger mit 8 Stimmen durch absolute Stimmenmehrheit als Armenpflegschaftsräthe gewählt worden sind“.
Das Los entscheidet
Da nun von den „6 Individuen 4 als Armenpflegschaftsräthe bestimmt sind, und 2 als Ersatzmänner vorbehalten bleiben, so wurde zwischen den obigen fünf mit 9 Wahlstimmen Gewählten zum Lose geschritten“. Dieser Vorgang ergab, dass der Metzger Joseph Schöppl „zum Rücktritt als Reserverath das Los getroffen hat“. Er wurde somit mit Anton Baumann als Ersatzmann aufgestellt, sollte bei Beratungen einer der vier anderen aus welchem Grund auch immer ausfallen. Das Ergebnis wurde mittels öffentlichen Anschlags bekannt gemacht und die vier neu gewählten Räte „ins Handgelibd genommen“. Sie mussten also eine eidesstattliche Erklärung abgeben, „ihrer Verantwortung bei den sensiblen Entscheidungen über ihre armen Mitbürger gerecht zu werden“.
Letztlich nennt uns der Akt die Namen der wahlberechtigten Gemeindebevollmächtigten. Es waren dies folgende Bürger: Simon Moreth, Lederer von Nr. 42; Georg Meidinger, Hafner von Nr. 51; Andreas Pohmann, Schuster von Nr. 51; Wolfgang Korherr, Kufner von Nr. 10; Anton Riederer von Nr. 61; Joseph Lemberger, Bäcker von Nr. 37/38; Georg Leutermann, Oekonom von Nr. 2; Ignaz Koller von Nr. 12 und Joseph Neumaier, Ökonom von Nr. 1. Am 15. Dezember forderte das Landgericht Kötzting als übergeordnete Behörde den Magistrat auf, nach Bestätigung des Wahlergebnisses, das „Verpflichtungsprotokoll binnen 8 Tagen abschriftlich vorzulegen“, was auch geschah.
Werner Perlinger
Über die „Biersuden“ wurde ordentliche Rechnung geführt
+Eschlkam. Das Brauen von Bier hat in unserem Markt eine althergebrachte Tradition. Demnach wurde, in Eschlkam als Sitz eines Gerichtes der bayerischen Herzöge, sehr wahrscheinlich noch im 13., nachweislich aber bereits im frühen 14., Jahrhundert Bier gesotten und vertrieben. Es dürfte dies im Winkel hinter dem Hohenbogen, dem damals eigentlichen Gerichtsbezirk, die einzige Braustätte gewesen sein. Nächste Braustätten für diese Zeit finden sich erst wieder in Cham, Chammünster und Kötzting. Im Gegensatz zu den anderen Orten im Winkel hinter dem Hohenbogen besaß der Markt bereits zu Anfang des 14. Jahrhunderts ein eigenes Brauhaus.
Das Kommunebrauhaus
Wie Archivalien uns mehrmals berichten, konnten im Brauhaus von Eschlkam in der Regel 61 brauberechtigte Bürger das Jahr über ihre „Suden“ von einem eigens dafür angestellten Braumeister herstellen lassen. Bis in die neuere Zeit herein gab es für die Marktbürger das Kommunbrauhaus an der Westflanke des Berges unmittelbar gegenüber dem Gasthaus Späth/Binder und hinter dem „Bruihausschreiner“ Wanninger (Bräuhausgasse 1). Es hatte die alte Hausnummer 14. Im Plan der Erstvermessung des Marktes vom Jahr 1831 sind sein Standort und seine Dimension im Grundriss eingezeichnet. Das Gebäude steht schon lange nicht mehr. Nach dem gänzlichen Niedergang des kommunalen Brauwesens wurde es noch vor 1931 ersatzlos abgebrochen. Der letzte Braumeister war Heinrich Stauber vom Anwesen Kleinaigner Straße 3.
Gemeinschaftssinn gepflegt
Die Zahl der „Suden“, auch „Preu“ genannt, war verschieden groß und abhängig vom Umfang des jeweiligen Hauswesens des brauberechtigten Bürgers, seines Vermögens, auch von den vorhandenen Kelleranlagen. Oft taten sich mehrere Bürger für eine einzelne „Sud“ zusammen. Diese umfasste etwa 48 Eimer, wobei der damalige Eimer Bier auf 64 Liter gerechnet wurde. Für jedes Jahr wurde vom jeweiligen „Kesselverwalter“ eine Brau- oder Kesselrechnung erstellt. Diese Rechnungen geben uns vielfältige Einblicke in das Brauwesen, so z. B. auch die Rechnung des Jahres 1800, die den Zeitraum Georgi (23. April) 1800 bis ebenfalls Georgi 1801 abdeckte.
In dieser Rechnung wird anfangs eigens der Status „Commun-Bräuhaus“ vermerkt, das der „bräuenden“ Bürgerschaft gehört. Der in diesem Jahr tätige und für die Einnahmen und Ausgaben verantwortliche Kesselverwalter war der Weißbäcker Franz Rötzer (damals in Further Straße 4/6).
Unter den Einnahmen ist anfänglich vermerkt, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr ganze 93 „Bräubier“ (Suden) gebraut wurden, wobei die daran beteiligten Bürger insgesamt 372 f (f = Symbol für Gulden) zu entrichten hatten; pro Sud also 4 f als sog. „Keßlgeld“. Jeweils 1 f als „Zugabung“ hatten der Stiftwirt Michael Aunzinger (Großaigner Straße 1), der Lederer Peter Leutermann (Blumengasse 7) und Johann Bomann (Blumengasse 12) zu leisten. Um in diesem Jahr die Ausgaben insgesamt bestreiten zu können, hat „der Keßtlverwalter aus eigenem Säckel 100 f (vorerst) hergeschossen“ (geliehen), so dass sich die gesamten Einnahmen auf 511 f Gulden beliefen.
Vielfältige Ausgaben
Die über das Jahr entstandenen und in „einer Rubrik“ eigens zusammengefassten Ausgaben betrugen 517 Gulden. So wurden für die aus den brauberechtigten Bürgern gebildete „Grenadier Compagnie“, die an der Fronleichnamsprozession teilnahm, 12 f ausgegeben. Der Marktdiener Franz Pinzinger wurde für die herkömmliche „Einsagung“ der bräuenden Bürgerschaft mit 1 f entlohnt.
Neben vielen kleinen Ausgaben für Dienste und Leistungen der am Ort ansässigen Handwerker, stellte der Maurer Georg Altmann „mit 2 Gesellen ein neues Biergewölb“ her, ferner besserte er Schäden aus auf der „Malzthenn“ (Malztenne, um dort das Getreide zum Keimen zu bringen), am „Schwelchboden“ (temperierter Trockenboden für nasses Malz), am „Bräuofen“ und im Bräustübel, wo meist der Bräumeister und seine Mitarbeiter eine Ruhepause einlegen konnten. Insgesamt erhielt Altmann 98 f. An Ausbesserungsarbeiten war mit 75 f Lohn auch der Zimmermeister Erhard Siebenhärl aus Furth beteiligt. 25 f erhielt der Hufschmied Michael Schamberger für seine im Bräuhaus über das ganze Jahr geleistete Schmiedearbeit. Auch wurden um 7 f für den Bräumeister und den Bräuknecht zwei „Bölster“ und zwei „Strohsäck“ für eine angenehme Nachtruhe gekauft. Der Kufner Andrä Korherr wurde für seine jährlich geleistete Arbeit mit 36 f entlohnt. Dafür schuf er, wenn nötig, neue Fässer und besserte die schadhaften auch aus. In der Endabrechnung überstiegen die Ausgaben mit 517 f die oben genannten Einnahmen um 6 Gulden. Im Vergleich zu den Rechnungen anderer Jahrgänge hatte Franz Rötzer als Kesselverwalter gut gewirtschaftet. Am 4. Mai 1801 wurde im Rathaus im Beisein der versammelten „Bräubürgerschaft“ die Jahresrechnung öffentlich verlesen. Einwendungen wurden nicht vorgebracht. Erwähnenswert sei noch, dass Franz Rötzer selbst, der Leinenweber Michael Weß und Michael Schreiner dem „Kesselamt“ in letzter Zeit einmal je 100 Gulden geliehen hatten. Nach heutigem Wert entspräche 1 Gulden (f) etwa dem Wert von 10 Euro.
Keine Ausnahme geduldet
In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist, dass im Jahr 1818 der Wirt Johann Adam von Warzenried (heute Gasthof Altmann, „beim Weiß’n“) von dem Bürger und Mitglied des Kommunbrauerverbandes, dem Hafner Joseph Hölzl (Hsnr. 51/Blumengasse 18), das auf dessen Haus liegende Braurecht kaufen wollte. Adam beabsichtigte, in Eschlkam das eigene Bier brauen zu lassen. Sein Wunsch wurde entschieden abgelehnt mit dem Hinweis, kein auswärtiger Wirt dürfe im Kommunbrauhaus eigenes Bier brauen lassen. Noch hielt die Vereinigung der brauenden Bürger eng zusammen, was sich Jahrzehnte später aber ändern sollte.
Werner Perlinger
Als Eschlkamer Bürger einer verfehlten „Gußführung“ bezichtigt wurden
+Eschlkam. Zunächst einführend allgemeine Erklärungen zum Brauwesen im Markte: Bis in die neuere Zeit herein gab es für die Marktbürger das Kommunbrauhaus, gelegen an der Westflanke des Berges unmittelbar gegenüber dem Gasthaus Späth/Binder und hinter dem „Bruihausschreiner“ Wanninger. Es hatte die alte Hausnummer 14. Im Plan der Erstvermessung des Marktes vom Jahr 1831 sind sein Standort und seine Dimension im Grundriss eingezeichnet. Nach dem gänzlichen Niedergang des kommunalen Brauwesens wurde es noch vor 1931 ersatzlos abgebrochen.
Wie Unterlagen uns mehrmals berichten, konnten im Brauhaus an die 61 brauberechtigte Bürger das Jahr über ihre „Suden“ von einem eigens dafür angestellten Braumeister herstellen lassen. Wie anderorts auch blieb die Zahl der brauberechtigten Bürger meist konstant. Die Zahl der Suden, auch „Preu“ genannt, war verschieden groß und abhängig vom Umfang des jeweiligen Hauswesens des brauberechtigten Bürgers, seines Vermögens, auch der bei ihm vorhandenen Kelleranlagen. Oft taten sich mehrere Bürger für eine einzelne „Sud“ zusammen. Diese umfasste etwa 48 „Eimer“, wobei ein Eimer Bier auf 64 Liter gerechnet wurde.
Aus dem Jahr 1827 datiert ein Akt, niedergelegt im Archiv des Marktes, mit dem Titel: „Tarifwidrige Gußführung bey Erzeugung des braunen Bieres“. Dazu für das Verständnis folgende Erklärung: „Haupt“- und „Nachguss“ bezeichnen das in zwei Teilmengen aufgeteilte Brauwasser beim Maischen. Der Hauptguss ist der Teil des Wassers, in den das geschrotete Malz eingemaischt und anschließend während der Rasten verzuckert wird. Der Nachguss ist dagegen der Teil des Brauwassers, der nach dem Abläutern zum Ausschwemmen des in den Trebern noch enthaltenen Extraktes dient. Der Nachguss wird üblicherweise in mehreren Teilmengen vorsichtig auf die Treber aufgebracht. Die Größe der Güsse und deren Verhältnis ist abhängig von der Biersorte und der Größe der Schüttung, so eine amtliche Erklärung zum Brauvorgang. Die damalige Zollbehörde prüfte daher beim Brauvorgang wie viel Wasser und Malz im Verhältnis zueinander sein dürfen, bzw. müssen.
Gerade hinsichtlich der Vermeidung einer möglichen tarifwidrigen Gußführung (= die Überprüfung des richtigen Verhältnisses von Wasser und Malz) bei Erzeugung des Braunbieres wurde am 25. Juni 1827 sogar ein „höchster Regierungsbefehl“ erlassen, um im Lande für die Erzeugung des gesunden braunen Bieres zu sorgen. Mehrere inhaltlich gleiche „Circulare“ (amtliche Rundschreiben) dazu wurden immer wieder an die Kommunen verschickt. Galt doch damals gut erzeugtes (eingebrautes) Bier als ein täglich genossenes Nahrungsmittel. Nicht umsonst gilt heute noch der Spruch: „Bier ist flüssiges Brot“. So bestand früher eine Brotzeit oft nur aus „Bier und Brot“.
1828, am 27. Oktober, zeigte die „koenigliche Unteraufschlags Stell Neukirchen (b. Hl. Blut)“ beim Magistrat Eschlkam an, dass der bräuende Bürger Joseph Lemberger (HsNr. 37/38-Marktstraße 11) am 24. Oktober eine „Pollete“ (Palette) auf 3 Schäffel 3 Metzen auf eingesprengtes (nach der Keimung aufgesprengt-heute sogar geschrotet) Malz erholte und gleich am Tag darauf frühmorgens versott. Bei der Visitation im Kommunbrauhaus traf man auf 1 Sch(effe)l eingesprengtes Malz 10 Eimer ohne Hinzurechnung des Nachbieres. So war dies nach dem strengen Gesetz vom 25. April 1811, die Qualität des Bierquantums, das aus dem Malz gewonnen werden durfte betreffend, ein „taxmäßiger Überschreitungsguß“, da das „quantitaxe (das zu versteuernde mengenmäßig zugelassene) Verhältnis der wesentlichen Ingredenzien (Zutaten), aus welchen das „Braune Bier“ erzeugt wird, zur Produktion des Bieres bestimmt und auf 6 Eimer Sommerbier und 7 Eimer Winterbier mit 1 Schäffel trockenen Malz festgesetzt ist.“
Grob und protestierend verhalten
Folgende polizeiliche Maßregel und Strafen wurden angeordnet: „Da sich Lemberger gegen den königl. Unteraufschläger (der prüfende Zollbeamte) protell (protestierend) und grob betragen hat“, und der Prüfer feststellte, dass er zu viel Bier „gemacht“ habe, sagte Lemberger, „das geht Ihnen nichts an, sondern (nur) den Magistrat“. Auch sagte Lemberger, „wenn sie mein Bier abeichen, so müßen sie es allen bräuenden Bürgern thun, aber kein Bräuer hat mir weder Lekus (eine Lektion) zu geben noch Gesetz vorzuschreiben, besonders von einem solchen“. Als „Defraudant“ (Betrüger) bekannt, gebe es schon seit dem 6. Juni 1825 den Auftrag, „auf diesen verdächtigten bräuenden Bürger Joseph Lemberger ein vorzügliches wachsames Aug zu haben“, so der aktenmäßige Inhalt.
Die gleiche Behörde aus Neukirchen meldete am 31. Januar 1829 den Bürger Joseph Späth (HsNr. 5/Further Straße 3) wegen eines „Überschreitungsgußes von 23 Eimer“ gegen die amtlich festgelegte Brauordnung. Eine weitere Anzeige folgte am 30. Oktober gleichen Jahres gegen Joseph Pfeffer (HsNr. 59/Marktstraße 13). Da bei seinem „Bräu“ 5 Scheffel „trockenes Malz genommen wurden, so ist 5 mal 7 = 35 Eimer, so ergibt sich eine tarifwidrige Gußführung von 10 Eimer, so dass das erzeugte Produkt kein pfennigvergeltliches (sein Geld wertes) Bier ist“, somit auch ein Betrug gegenüber dem „Publikum“ (den Biertrinkern) vorliege. Abhilfe wurde gefordert und auch vollzogen. Zuständig für die Ahndung dieser Verstöße war vorerst der Magistrat.
Die „koenigliche Unteraufschlags Stell Neukirchen“ (die damalige Steuerbehörde) war zuständig, dass „die bräuenden Bürger das hergestellte Bier nur gemäß den gegebenen Vorschriften“ versteuerten. Die sog. gesetzlich einzuhaltende „Gußführung“ diente staatlicherseits zur Festsetzung der Steuer auf die Bierproduktion. Gerne versuchte daher so mancher brauende Bürger für den Eigennutz diese streng geregelten Vorschriften zu umgehen, was aber – wie hier geschildert - nicht immer gelang.
Werner Perlinger
Attesttatenbücher informieren über frühere Bürger
+Eschlkam. Im Marktarchiv befindet sich eine nicht geringe Anzahl sog. „Attestatenbücher“. In zeitlicher Abfolge besteht ihr Inhalt aus sog. Bescheinigungen, wie der Name „Attest“ schon erklärt, die einzelne Bürger immer wieder benötigten, um z. B. als Bürger aufgenommen zu werden, eine Heiratserlaubnis zu erhalten, für übergeordnete Behörden den Besitzstand erklärend, um den Beruf oder eine gewisse Tätigkeit ausüben zu können oder auch als Beweis im Besitz eines guten Leumunds zu sein. Aus diesem Fundus berichtet auch schon Artikel "Attestatenbücher geben Einblick in frühere bürgerliche Verhältnisse".
Aufgrund der für den Leser wirklich interessanten Inhalte wenden wir uns dem Jahreszyklus 1855/56 zu. So wird am 12. Oktober 1855 – es ist dies in der uns überlieferten Niederschrift der erste Eintrag - dem Glasermeister Anton Lamecker (Hsnr. 49 ½/Steinweg 2) amtlich attestiert, dass gegen die von ihm beabsichtigte Vergrößerung seiner Schupfe weder von seinen 3 Nachbarn Alois Stauber, Joseph Rötzer und Michl Hastreiter, noch vom unterfertigten Magistrate eine Erinnerung bestehe.
Das herkömmliche Badehaus (Nr. 7/ Kleinaigner Straße 3) war schon seit 1845 nicht mehr in Betrieb. Dennoch wird am 6. November 1855 dem approbierten Bader Jakob Herzog, „welcher sich seit 10 Jahren zu Eschlkam befindet, auf Verlangen amtlich attestiert, daß er während des genannten Zeitraumes seine Badergerechtsame mit allem Fleiße und zur vollsten Zufriedenheit des Publikums ausgeübt und in moralischer Beziehung sich stets so verhalten habe, daß er sich des besten Leumundes (Rufes) erfreut“. 1845 hatte Herzog, zugezogen aus Deggendorf, die „Badergerechtsame“ von Haus Nr. 7 gekauft, übte dann seinen Beruf in Anwesen Nr. 34 (heute Ludwig Weber-Haus) aus und findet sich dann als Bader von 1854-58 in Anwesen Nr. 61 ½, heute Großaigner Straße 3.
Heiratserlaubnisse vergeben
Der Bürgerstochter Anna Riederer wird am 6. Januar 1856 vom Magistrat wegen „ihrer vorhabenden Verehelichung auf Verlangen hiermit amtlich attestiert, daß sie durch ihr stets gepflogenes ordentliches Betragen“ sich einen ausgezeichnet guten Leumund erworben habe“. Zugleich wird erwähnt, dass sie „ein Elterngut von 150 Gulden“ und ein erspartes Vermögen „von ebenfalls 150 Gulden nebst 3 Betten, Leinwäsche u. sonstige Hauseinrichtung“ habe. Somit stand einer Heirat nichts mehr im Wege. Ein ebenso für eine Eheschließung vorausgesetzter guter Leumund wurde wenig später am 24. Januar der Bürgerstochter Anna Maria Hausladen für die geplante Heirat bestätigt.
Mit dem Gemeindeedikt von 1818 wurde in Bayern der „Heiratkonsens“ den Gemeinden übertragen. Grund- und Hausbesitz, Steuerabgabe, Heimatrecht und vor allem ein einwandfreier Leumund waren unter anderem Voraussetzung für eine Heiratsgenehmigung. Erst ein Gesetz von 1868 brachte wesentliche Erleichterungen, die im Zweiten Reich unter dem Reichskanzler Otto von Bismark im Reichszivilehegesetz vom Februar 1875 fortgesetzt wurden. Demnach wurde von den Gemeinden darauf geachtet, dass bei Heiratswilligen beim Eintritt in das Eheleben „der Nahrungsstand“ gesichert war. Man wollte so vorsorgen, dass die Kommune von armen Familien, die sie letztlich zu unterhalten hätte, so weit wie möglich verschont blieb.
1856, am 6. März wird „dem vormaligen Studenten und Bürgerssohn Alois Meidinger, welcher sich nach Altötting begeben will, um im dortigen Kapuzinerkloster die Aufnahme als Frater nachzusuchen auf Verlangen attestiert, daß er sein Heimatrecht in der Markt-Gemeinde Eschlkam anzusprechen habe“. Dieses Attest diente dazu, sollte Meidinger dem Kloster wieder den Rücken kehren, er im Notfalle von seiner Heimatgemeinde Eschlkam unterstützt werden musste.
Bestand des Heimatrechts
Das Heimatrecht beschreibt die Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Gemeinde. So hatte der Wegzug aus einer Gemeinde in eine andere nicht den Verlust des Heimatrechts zur Folge, vielmehr musste die Heimatgemeinde später den verarmten Heimatberechtigten notfalls wieder an- und aufnehmen und versorgen. In Bayern galt das „Heimatrecht“ noch bis zum Jahr 1917.
Am 5. Juli wird dem Bürger Joseph Schmauß „auf Ansuchen amtlich hiermit attestiert, daß gegen die von Ihm beabsichtigte Untermauerung seines Wohnhauses Nr. 40 weder von seinen Nachbarn Alois Schmirl und Anna Seidl, noch vom unterfertigten Magistrat eine Erinnerung (Einwand) gemacht werde“. Am 20. Januar 1854 hatte Schmauß von seinem Vater das Anwesen übernommen. Es war wohl noch aus Holz als sog. Waldlerhaus erbaut. Nachdem der Wohnbereich „abgewohnt“ war, ersetzte er den ehemaligen Blockbau als Mauerwerk aus Stein.
Der Bürgersohn und Säcklergeselle Sebastian Lechermeier will sich selbstständig machen. Dazu waren verschiedene Formularien zur Vorlage nötig wie ein tauf- und Religionszeugnis, der Entlassungsschein aus der Werk- und Feiertagsschule, ein Leumundszeugnis, das nur die Gemeinde ausstellen konnte, ein Impfschein gegen die Blatternkrankheit, der Lehrbrief sowie das Wanderbuch, versehen mit den Einträgen über die drei Jahre andauernde Wanderschaft außerhalb seines Heimatortes und letztlich die Urkunde, beinhaltend seinen Abschied vom Militärdienst. Nachdem diese Voraussetzungen von Lechermeier erfüllt waren, erhielt er vom Magistrat den „Zulaßschein zur Prüfung für das Säcklergewerbe“. Der Wunsch Lechermeiers ging in Erfüllung. Er konnte sein Handwerk als Säcklermeister in Anwesen Hsnr. 39/ Blumengasse 1 ausüben. Ergänzend sei erwähnt, dass im 17. Jahrhundert der „Säckler“ als Hersteller von stabilen Mehlsäcken zuständig war, für die man vorwiegend gegerbtes Leder verwendete. Mit dem Aufkommen des Leinens wurde dann der „Säckler“ zum Bekleidungsschneider bzw. Lederbekleidungserzeuger. Der alte Begriff „Säckler“ wird aber von den renommierten Betrieben in Österreich und Bayern heute noch aufrechterhalten.
Werner Perlinger
Ein Rausch am "Fasnachtsdienstag" blieb nicht ohne Folgen
+Eschlkam. Wurde im Beitrag "Aus einem alten Sitzungsbuch des Marktrates" die doch schwere Körperverletzung an einer Bürgersfrau durch einen sehr erzürnten Bürger im Jahr 1696 als ein Inhalt des Ratsprotokolls vorgestellt, so sei an dieser Stelle ein Vorkommnis geschildert, das im gleichen Protokoll erstmals in einer Ratssitzung am 16. Juli behandelt wurde. Über den Fall verhandelten die in diesem Jahr sich abwechselnd amtierenden Bürgermeister Wolf Sighardt Altmann, Andre Hastreiter und Peter Lährnbecher; als Mitglieder des sog. „Eissern Rathes“ die Bürger Hans Fleischmann, Georg Vaist, Wolf Korherr und Hans Hastreiter. „In puncto verursachten Wundtschaden, und also begehrten Satisfaction“ klagte der Bürger und Marktschreiber Veith Adam Wurzer. Letztere Person lernten wir bereits im Artikel "Dem Marktschreiber Veith Adam Wurzer wird der Dienst aufgekündigt" kennen. Darin werden am 4. Juni 1698 seine unverzügliche Entlassung als Marktschreiber aus dem Dienst und deren Ursachen behandelt.
Was war geschehen? Wurzer, der damals Inhaber des Anwesens Nr. 17/Kleinaigner Straße 4 war, klagte gegen den Hufschmied Hans Stephl (damals in Hsnr. 6/Kleinaigner Straße 1), dieser sei am „verwichenen Vasnachts Erchtag“ (Faschingsdienstag) zwischen „12 und 1 Uhr nach mitternacht in sein Clegers Würths Behausung ohne Begehrung eines piers“ laut schreiend zur Stubentüre „herein gelaufen, da er doch den ganz(en) Tag in einem andern Würths Haus getrunkhen“, und Stephl rief: „Seids auch Bürger, das ist schön, ließt mich umpringen, kam mir kheiner zu Hilf, da gleich vor Eurer Thür seint die Reitter, haben mich tractiert, (so) daß ich mich nicht getraue alleinig nach Haus zugehen.“ Der Kläger Wurzer antwortete, wir hätten nichts gehört, wir wollen euch in euer Haus „belaitten“ (geleiten). Zur Sicherheit nahm Wurzer „einen Degen in die Handt“, ging vor die Tür in der Meinung Stephl werde nachfolgen. Dieser aber blieb „erweislich zurück“, in der Stube bis endlich das „Weib“ Wurzers „mit üppigen und zohrnigen Wortten“ sagte: „Geht mein Mann wegen euch aus dem Haus, so schauet gleichwoll daß ihm nichts geschieht“. Darüber lachte Stephl und ließ sich zur Haustüre hinaus stoßen.
Verwundet durch Säbelhiebe
Als Wurzer zum Hause Stephls kam, „ist in der Fünstern an einem Haus öckh der Reiter Neyner mit blossen (blanken) Säbl gestanden und gleich auf (den) Cleger (Wurzer) unvergebens (unversehens) einen Hib in den andern (mehrere) solang gefiehrt, bis Cleger einen starkh gefehrlich(en) Hib auf die rechte Axl, und (der) Reiter Neyner einen Stoß durch den rechten Armb bekhommen. Darbey (habe) der Beklagte (Stephl) ainige Abrettung (Hilfe geleistet) gethon, und wehre gahr gewiss ainer auf dem Plaz gebliben“, wäre nicht der Knecht Wurzers mit „ainen Körz Leicht in ainer Lathern khomen“. Daraufhin sei der Reiter, „welcher sich nit mehr wöhren khönen“ davon gelaufen. Der sog. „Reiter“ dürfte einer Gruppe bayerischer Soldaten angehört haben, welche wegen einer gerade in Böhmen grassierenden pestähnlichen Seuche als Tag und Nacht reitende Stafette zur Grenzabriegelung im Markt stationiert waren.
Da nun Stephl ihn, den Kläger „aus seiner Behausung und wer waiß aus wessen Anstüfftung, so mithin (ihn) auf die Fleischpankh zu führen gedenkt hat“, wodurch Wurzer durch die „Falsch- und Vermessenheit ainen solchen Hib bekhommen (hatte), den er zeitlebens empfünden werde“. Wurzer forderte daher, dass Stephl als Beklagter „nit allein den Pader des Arzterlohnes befriedige, sondern auch alle Schmerzen und 6 Wochen lange Versaumbnus (Arbeitsausfall, berufliche Versäumnis)“ erstatte, sowie auch die weiteren angefallenen Unkosten.
Der beklagte Stephl wollte sich aus der ganzen Angelegenheit herauswinden. Er sagte, er habe sich „zwar in des Clegers Behausung salviert (gerettet)“, aber daß Wurzer gleich aus dem Hause gelaufen sei und dadurch solche Hiebe erhalten habe, dafür könne er nichts. Er bitte daher „umb Absolution“ (Freisprechung). Wurzer erklärte, er habe den ganzen Tag über mit keinem der Reiter „khein Handl“ (Auseinandersetzung) gehabt. Auch habe er nicht mehr vor das Haus gehen wollen, „sondern es haben die in der Stubn gewesenen (Gäste), und schon bei der Stubn Thür gestandene haimb und ins Pett gehen wollen“, da sei Stephl zur Stubentüre hereingekommen.
In einem ersten Bescheid stellte noch am gleichen Tag, den 16. Juli, das Marktgericht fest, „weillen dem Beklagten nit gebührt hat, solchen Tumult in des Clegers Haus nächtlicher Weill anzufangen, also wollen Bürgermeister und Räte, dass sich Wurzer und Stephl innerhalb 14 Tagen „vergleichen“ (sich gütlich einigen).
Wochen später, am 21. August bat Wurzer um eine endgültige Entscheidung. Das Marktgericht urteilte: „weillen dem beklagten Hans Stephl, Hufschmiedt nit gebührt hat, so spatt und mitternachtszeit aus einem anderen Würtshaus hergegangener und in des Marktschreibers Behausung mit solcher Tumult gelauffen, als wann ihn die Reitter gleichsamb ermortten wollen, dadurch so viel verursacht, daß sich (der) Marktschreiber seiner angenommen und dessentwegen so gefehrlich verwundet worden; also wollen Bürgermeister und Rhäte hirmit erkhennen, daß er Stephl die Helfte des Arzterlohnes und solche Gerichtsgebühren neben dem Marktschreiber abgestattet schuldig sein solle“.
Damit war die Angelegenheit für den Schmied Stephl noch nicht ausgestanden. Am 25. August stellten der Bürgermeister und seine Räte weiterhin fest, dass Stephl sich darüberhinaus den obrigkeitlichen Anordnungen widersetzt habe, und so wurde er „nit nur hochgehörigen Orts angewissen, sondern wegen seiner gebrauchten Unmanier und Vermessenheit wieder seiner vorgesezten Obrigkheit 4 stundt lang in (den) Stokh condemniert“; d.h. Stephl musste öffentlich meist vor dem Rathaus sitzend und eingespannt mit den Armen und Füßen in einem prangenähnlichen „Stock“ zur allgemeinen Schau ausharren und damit auch den Spott der Vorübergehenden ertragen.
Werner Perlinger
Als Joseph Pfeffer sich als Sattler und einziger seines Handwerks niederließ
+Eschlkam. Der Magistrat der Königlichen Stadt Straubing bezeugte am 3. Januar 1831 dem Fuhrmannssohn Joseph Pfeffer von Eschlkam „auf Grund des vorliegenden Protokolls des hierortigen Sattler Gewerbs Vereines, daß derselbe bey Joseph Lehner b. Sattlermeister dahier die Sattler Profeßion mit Pünktlichkeit ordnungsmäßig erlernte und untern 1. Februar 1830 von der Lehre frey und zum Gesellen gesprochen worden sey“. Unterzeichnet hatte dieses Patent der damalige Bürgermeister von Straubing, Kolb.
In der nächsten Zeit begab sich Pfeffer als Geselle auf Wanderschaft – so wie es damals vorgeschrieben war – um in anderen Handwerksbetrieben dazuzulernen. Zwei Jahre später, am 4. April 1833 stellte der Marktmagistrat Eschlkam ein Zeugnis aus. Darin wird einleitend vermerkt, dass bereits im Jahr 1806 Wolfgang Lehrnbecher, Sattlermeister (Nr. 32/Waldschmidtplatz 1) verstorben ist und seitdem „besteht hierorts kein Sattler mehr und hat sich auch um Verleihung dieses Gewerbes niemand eingefunden“. Die Wichtigkeit eines Sattlers im Markt betonte der Magistrat mit dem Hinweis, dass sich hier viele Ökonomen und Fuhrleute befinden, „als auch in der ganz weitsichtigen Pfarrei kein Sattler vorhanden ist“. Gerade deswegen erlernte der Bürgersohn Joseph Pfeffer dieses Handwerk. Sein Vater besaß das Anwesen Nr. 59/Marktstraße 13 und betrieb ein Fuhrgeschäft, und der Vater wusste was ein gutes Geschirr für seinen Beruf wert sein konnte. Letztlich sagte der Magistrat dem Joseph Pfeffer, geb. 1813, zu, dass ihm „nach Wunsch und Willen der Bürgergemeinde die Sattlerprofession magistratsseits ertheilt werde“.
Am 9. August 1833 beschloss der Magistrat mit Zusicherung der Gemeindebevollmächtigten – insgesamt zehn Bürger – unter Bürgermeister Michael Meidinger dem Pfeffer die „personale Sattler Conceßion“ zu verleihen, wenn er ein Zeugnis über die nötige „Gewerbsfähigkeit“ vorlegt; dann einen Ausweis über die geleistete Militärpflicht und schließlich – da er die drei Jahre Wanderschaft nicht voll erfüllte – ein ärztliches Zeugnis wegen „körperlicher Unfähigkeit“. Dazu legte Pfeffer sein Prüfungszeugnis vor, ausgestellt am 13. September 1833 von der Prüfungskommission in Amberg. Demnach hatte er „zum Behufe seiner dortigen Ansässigmachung die Fähigkeitsprobe, bestehend in der Verfertigung eines Fuhrmannssattels hierorts abgelegt. Derselbe erscheint nach einstimmigen Urtheile der Prüfungs Mitglieder zur selbstständigen Ausübung des Sattlergewerbes vollkommen tüchtig“.
Gesundheitlich angeschlagen
Eine Woche später, am 20. September, informiert der Magistrat, dass die Wanderschaft des Pfeffer nur vom 18. Februar bis 15. November 1831 „wegen körperlicher Unfähigkeit“ andauerte, wobei betont wird, dass er „von seinem Knabenalter an Masern litt, gleich darnach mit einer chronischen Hautkrankheit an beiden Ober- und Unterschenkeln befallen wurde, so daß er öfters schon im Gehen verhindert wurde“. Das sollte aber kein Hindernis sein, da diesbezüglich auch die „einschlägige Polizeibehörde“ eine „theilweise Dispensation ertheilen kann“. Noch einmal wurde betont, die „Concession“ zu erteilen, da in der Gemeinde seit 1806 „ein Sattler umsomehr nothwendig ist“.
Bürokratische Hürden
Monate später, am 24. April 1834, schaltet sich das Landgericht Kötzting ein. Diese Behörde bedeutete dem Pfeffer, dass er nach „der hierher gediehene Regierungs Entschließung die beantragte Caution durch Deponierung seiner Hypothek-Urkunde genehmigt werde, und es ihm nunmehr freistehe seine Ansässigmachung geeigneten orts einzuleiten“. Zugleich wird ihm vom Landgericht „ein Zertifikat zur Verehelichung ausgestellt“. Am 28. Mai schließlich verleiht der Magistrat von Eschlkam dem Joseph Pfeffer, da er „zur selbständigen Ausübung des Sattlergewerbes vollständig tüchtig befunden worden ist“, die „Concession“, nun in eignener Verantwortung tätig zu werden.
Jahre später, 1841, befand sich Pfeffer auf Freiersfüßen. Seine Auserwählte war die Bäckerstochter Franziska Rötzer vom „Kreigerbäckhaus“. Am 22. Juli werden beide vom Magistrat als zugleich amtierende Lokalpolizeibehörde angewiesen, sich beim Landgericht Kötzting die „Sponsalienverbriefung und Sigelung der ihnen zugestellten Zeugnisse gehorsambst zu erbitten“. Diese Zeugnisse bestanden jeweils aus einem Taufschein für Franziska Rötzer, geb. am 7. Mai 1812 als Tochter der Bäckerseheleute Franz Rötzer und Anna geb. Hastreiter (von Nr. 19/Marktstraße 4 u. 6), und Joseph Pfeffer, geb. am 22. Februar 1813 als Sohn des Joseph Pfeffer und der Theresia, geb. Späth. Dazu musste Pfeffer nur einen sog. „Blattern-Schein“ vorlegen, da er bereits am 18. April 1830 daran erkrankt war „und daher von aller fernern Schutzblatter-Impfung frey gesprochen worden ist“. Dagegen konnte die Braut Franziska einen „Schutzpocken-Impfungs-Schein“ vorlegen, da sie bereits 1815 gegen diese Krankheit erfolgreich geimpft worden war. Unwillkürlich erinnern wir uns an die derzeit herrschende Covid 19-Pandemie, wenn es gilt Impfnachweise vorzulegen.
Weitere vorzulegende Unterlagen waren die jeweiligen schulischen Enlassungszeugnisse, wobei anzumerken ist, dass beide fleißige und gute Schüler waren. Für Joseph Pfeffer stellte am 12. Oktober 1835 der „oberste Rekrutierungsrath des Unterdonaukreises“ in Passau eine Urkunde aus, nach der er offenbar aufgrund seiner schon geschilderten Krankheiten als „militärdienstuntauglich“ befunden wurde.
Nachdem beide geheiratet hatten, bezogen sie das elterliche Anwesen des Bräutigams, wo Pfeffer zunächst als Sattler arbeitete. Einige Jahre später, 1847, erwarb der junge Pfeffer als selbstständig arbeitender Sattlermeister käuflich das Anwesen Nr. 65/ Großaigner Straße 13. Noch ist auf diesem Haus der Hausname „beim jungen Soadla“ bekannt; während das Elternhaus Nr. 59/Marktstraße 13 den Hausnamen „beim alten Soadla“ führt.
Werner Perlinger
Hilfe für den Bau einer Brücke bei Kreuzbach über den Schwarzen Regen
+Eschlkam. „Dem von Seite des Königlichen Landgerichts Koetzting bey Kreuzbach über den schwarzen Regen begonnenen Brückenbau, um die hierzu aufzubringen seyende Kösten betreffend, Anno 1822“, so tituliert ein Archivale im Marktarchiv. Der Titel klingt verwirrend, befindet sich doch der Ort Kreuzbach als Ortsteil von Blaibach, gelegen am Schwarzen Regen, weitab vom Eschlkamer Gemeindebereich. Die Brücke dort in Kreuzbach ist heute noch vorhanden, jedoch als ein späterer, moderner, für die heutigen Verkehrserfordernisse ausgerichteter Bau.
Interessant dazu ist, dass für den dortigen Brückenbau vor 200 Jahren abgabenmäßig auch die Region hinter dem Hohenbogen beigezogen wurde. Der alleinige Grund liegt wohl in der Tatsache, dass in diesem Bereich des Schwarzen Regen seit Urzeiten ein Fernweg den Fluss quert, der das Land Böhmen sowie das Grenzgebiet zwischen Furth im Wald und den Hohenbogen-Winkel nicht nur topografisch sondern auch wirtschaftlich mit dem Donauraum um Straubing verbindet. Dieser Wegeabschnitt ist ein wichtiges seit jeher bedeutendes Teilstück des sog. „Baierweges“– eines alten, seit Urzeiten genutzten Völkerwegs zwischen Bayern und Böhmen; davon aber später genaueres.
Am 27. März 1822 erging an alle Gemeinden der Auftrag, sich an dem Bauvorhaben zu beteiligen. Der Kostenvoranschlag für diese Brücke bei Kreuzbach belief sich auf stattliche 3964 Gulden, wobei diese Summe durch „unentgeltlichen Handlang“ die Kosten um 781 Gulden gemildert werden könnten. Am 26. Juli schlug der Magistrat vor, wegen der Kosten des Brückenbaus „die gesamte Bürgerschaft zu vernehmen“. Eine Woche später, am 29. Juli, wurden die Bürger „auf das Rathaus berufen“. Gegen das Vorhaben „erinnerten“ die Eschlkamer Bürger, dass die geplante Brücke „hiesig wenig, oder gar nichts nützt, vielmehr für als nachtheilig anzusehen ist, indem das Fuhrwesen nicht mehr hier durchpaßiert, sondern den nechst gelegenen Weg dafür nimmt und (so) einen Abtrag verursacht“. Unterschrieben haben Bürgermeister Joseph Bartl (Nr. 25/ Waldschmidtplatz 8) und vier Markträte im Namen der Bürgerschaft.
Brücke bereits gebaut
Am 4. November informiert den Markt das Landgericht Kötzting (heute wäre es das Landratsamt in Cham), die Brücke sei bereits gebaut. Die Gerichtsdiener der einzelnen Gemeinden wurden beauftragt, „jede gegen 1 Gulden täglich zu exeguieren (dort einzutreiben), bis sie die anerpartierten (zugeteilten) Leistungen zur Brücke bezahlt haben“. 1823, am 29. Januar wurden sämtliche für den Brückenbau infrage kommenden Gemeinden, die noch nicht gezahlt haben, angewiesen, innerhalb von drei Tagen „die rückständigen Executionsgebühren dem Gerichtsdiener sogleich zu bezahlen, ansonsten würden die Gemeindevorstände sogleich um den fälligen Betrag der Executionsgebühr (Gebühr für Zwangsvollstreckung) und des Bothenlohnes ausgepfändet“.
Der Markt fügte sich
Die Bürger „bissen in den saurern Apfel“, sie fügten sich und am 6. Februar 1823 erstellte der Marktmagistrat ein Register, in dem sämtliche Hausbesitzer mit ihren geleisteten Beiträgen aufgelistet sind, je nach gegebener wirtschaftlicher Lage aufgeteilt in sog. „Portionen“. Demnach leisteten die wenig vermögenden Bürger, ausgewiesen als „1 Portion“, je 28 Kr. (Kreuzer - 60 Kr. galt 1Gulden). Mit Abstand den höchsten Betrag von allen gab mit 4 f (Gulden) 12 Kreuzer (9 Portionen) der Gutsbesitzer Joseph Weber (Nr. 1/Waldschmidtstraße 14); der Krämer und Bürgermeister Joseph Bartl (Nr. 25/Waldschmidtplatz 8) 1 f 24 Kr.(3 Portionen). Eigens wird am 23. Januar 1825 nachträglich bestätigt, dass Pfarrer Alois Wagner bereits am 7. Oktober 1822 seinen Beitrag in Höhe von 3 f 19 Kr. 8 Heller dem Magistrate im Voraus eingehändigt habe. Insgesamt brachten die Bürger einen Betrag von 65 Gulden 20 Kreuzer zum Brückenbau auf. Abzüglich der Nebenkosten verblieben so für die Staatskasse 57 Gulden 38 Kr. Eine weitere Auflistung informiert letztlich, dass Neukirchen 191 f , Rittsteig 76 f, Zenching 102 f, Sengenbühl 105 f, Schwarzenberg 156 f, Kleinaign 67 f und Großaign 132 f aufzubringen hatten.
Ein alter Fernweg
Zur Geschichte des Baierweges sei folgendes angeführt: Der Name >Baierweg< sagt es deutlich aus: Er ist einer der alten bedeutenden Saumwege, der von Böhmen aus in das Nachbarland Bayern führt. Sein Name gibt die Zielrichtung und damit auch seinen Ausgangsraum an. Dieser Baierweg ist eine Fernwegtrasse, die eine wohl mindestens jungsteinzeitliche, wenn nicht bereits frühere, dann keltische und schließlich andauernde Nutzung bis ins 8./10.-13. nachchristliche Jahrhundert wahrscheinlich werden lässt.
Ich beginne bewusst in der umgekehrten Richtung. Im Süden nimmt der Baierweg seinen Anfang unmittelbar unterhalb der Donau bei Stephansposching, überquert dann den Strom und führt von Mariaposching über Loham, Niederwinkling, Perasdorf, Sankt Englmar nach Markbuchen.
Von dort erreicht er vorbei an der Kollnburg Viechtach um dann die Stadt durchquerend vorbei an der Rugenmühle den Schwarzen Regen zu überqueren. Über Pirka und Höllenstein führt die Trasse vorbei an den Altsiedlungen Wettzell und Sackenried und erreicht vom Ludwigsberg kommend Bad Kötzting. Als sog. >alte Kötztinger Straße< führt der Weg über das Bachmeierholz, Ramsried, Kettersdorf und Thenried nach Madersdorf am Fuße des Hohen Bogen und der ihm vorgelagerten Burg Lichteneck. Dort, nahe dieser Wehranlage gabelt sich die Trasse. Während die eine Wegführung am Fuße des Hohen Bogen über Oberdörfl nach Schwarzenberg und - sich dort erneut abzweigend - einmal nach Neukirchen b. Hl. Blut führt, verläuft der andere Zweig nach Eschlkam bis an den Grenzwald nach Neumark/Všeruby. Die Hauptwegeführung aber verläuft als Teil des grün-weiß markierten europäischen Fernwanderwegs durch die Gruber Waldungen nach Grasmannsdorf um dann Furth zu erreichen. Von der Stadt aus führt der Baierweg über die alte Hochstraße nach Domažlice/Taus. Von Taus/Domažlice verläuft der in Richtung Prag zielende Weg bis zum Ende des 13. Jahrhunderts über Crastavice, Koloveč, Podevousy, Merklin, Dnešice, Clumčany, Šternovice nach Stary Plzenec und von da über Rokycany, Myto nach Prag.
Werner Perlinger
Aus einem alten Sitzungsbuch des Marktrates
+Eschlkam. Im Archiv des Marktes, wohlgeordnet sich dem forschenden Besucher anbietend, finden sich unter den älteren Vorgängen neben den Kammerrechnungen auch Rats- und Verhörsprotokolle. Ein reichhaltiger Fundus, der uns teils sehr anschaulich das Leben der Bürger im Markt vor über 300 Jahren vor Augen führt.
Das älteste Protokoll des Marktes, in dem die Thematik und der Verlauf von Ratssitzungen von 1683-1695 verzeichnet sind, stellt sich dem Leser als ein dicker in Schweinsleder gebundener Foliant vor, der die Niederschriften mehrerer Jahre beinhaltet. Das nächste Ratsprotokoll beginnt mit dem Jahr 1696. Aus diesem Fundus seien anschließend an ähnliche frühere Veröffentlichungen einige Inhalte vorgestellt, um so in das Leben der Marktbürger und die Alltagsprobleme vor über 300 Jahren einen Einblick zu erhalten. Zugleich werden wir dabei über die Wechsel der einzelnen Amtsbürgermeister, auch über die Mitglieder des inneren- und äußeren Rates informiert.
In der Ratssitzung vom 22. März werden wir über ein besonders heikles, zugleich aber auch brutales Vorkommnis informiert:
Hans Georg Vischer, Bürger, klagt im Namen seiner Frau gegen den Weißbäcker Hans Peter Thirankh wegen sehr schwerer Körperverletzung – so würde man heutzutage die folgend geschilderte Gewalttat beurteilen. Thirankh selbst hatte mit der Ehelichung der Witwe Magdalena Hauser in das Anwesen Nr. 36, heute Marktstraße 9 im Jahr 1685 eingeheiratet. Er war der Sohn eines „wellischen Crambhandlers“ (Krämer aus Südtirol oder Norditalien). 1706 taucht er zeitweilig als Bürgermeister von Eschlkam auf. 1709 verkauft er das Anwesen an seinen Berufskollegen Hans Georg Hastreiter.
Im März ließ sich der Bäcker Thirankh zu folgender Tat hinreißen: Er habe die Klägerin unvermittelt in ihrer Wohnung „überloffen (überrumpelt), und ihr ohne Ursach in höchster Verbitterung (Zorn) mit einer Riedhauen ins Angesicht aine gefehrlich sichtige Wunde gehauen, sye auch durch solch vermerkhten Kopf straich halb todter zur Erde geschlagen“. Ergänzend sei angeführt, dass Vischer seit 1691 Mieter einer Wohnung im wieder hergestellten Rathaus (Nr. 33/Waldschmidtplatz 2 u. 4) war und dies somit auch der Tatort war.
Damit nicht genug. Thirankh schlug die am Boden „halber Todter unwissend“ (bewußtlos) und hat auf die gelegene Frau mit einem Fuß noch „in mediate (mitten) auf den schwangeren Leib ainen solchen gross nachdenkhlich furi (wilden) Stoss versezt“, wovon das Kind im Mutterleib „leuchtlich auf dem Platz bleiben khönde“. Hätte seine dazu gekommene Frau, sich nun einmischend, nicht zu schreien begonnen, hätte er die Bedauernswerte „noch weiters tractiren wollen“.
Ehemann Vischer kam nun, jedoch „zu spatt hinzu“, nachdem der Täter „entwichen“. Er hob seine Frau auf und hat sie „ganz verblütten (stark blutend) in sein Stüffts wohnung geschlept“, sie so lange mit Wasser besprengt, bis wie „widerumben in etwas zum Verstandt khommen, und so kreftig worden ist, daß er sye zum H. Ambts Burgermaister führen“ konnte, um „disse grausamme Unthat anzaigen (zu) khönnen“.
Ärztliches Gutachten eingeholt
Auch wurden durch den „de novo brauchenten (eigens hinzugezogenen) Wundarzten und andre unpartheyische Bürger“ die Verletzungen begutachtet. Der „gefehrliche Leib Stoß“ wurde von der dafür beauftragten „aufgestölten Hebam ordentlich besichtigt“. Auch wurden acht Tage Bettruhe verordnet. Wegen der „empfündlichen Straich, (und der) gehaute Wundten“ sollte der Beklagte sofort 30 fl (Gulden) „erlegen, auch absonderlich des Arzterlohn und aller anlaufente Unkosten“.
Die ganze Angelegenheit nahm seinen rechtlich herkömmlichen Verlauf. Die einzelnen Einlassungen der Parteien wurden protokolliert. Letztlich wurde die ganze Angelegenheit vom Marktgericht, wohl aufgrund der schwerwiegenden, blutenden Verletzungen und den daraus resultierenden rechtlichen Folgen, aus Kompetenzgründen an das kurfürstliche Pfleggericht zur „Abwandlung“ (Verhandlung) verwiesen mit dem Hinweis: „die Abwandlung hat kheineswegs dem Markt- sondern dem churf(ürstlichen) Pfleggericht gebührt, und dahin der Abstraffungs willen remittiert (zurückgeschickt) werden sollen“. Letztlich wurde die ganze umfangreiche Niederschrift durchgestrichen.
Seit 1654 hatte dieses Gericht seinen Sitz in Neukirchen b. Hl. Blut. Wie für den Bäckermeister Thirankh die ganze Sache letztlich ausging, kündet uns deshalb das Protokoll nicht. Auffällig ist nur der äußerst brutale Verlauf der Auseinandersetzung. Bei Thirankh muss sich vielleicht über längere Zeit ein entfesselter Zorn gegen die Frau des in der Nachbarschaft lebenden Bürgers Vischer aufgestaut haben. Es wird einmal nur von „diffamoser“ (verleumderischer) Handlung der Gegenseite gesprochen, was aber keine direkt schlüssige Erklärung zulässt.
Damit die Parteien in den drei Wochen bis „zum Austrag ordenlichen Rechtens (nun durch das Pfleggericht) in Fridt und Sicherheit leben“, wurden zum „Poenfall 6 Reichsthaler obrigkeitlich gesezt“; d. h. bei nochmaliger Straffälligkeit in dieser Zeit hatte der Friedensbrecher diese Geldstrafe zu entrichten.
Erwähnenswert sei noch, dass am 8. Juni vom Marktrat der Bürger und Hufschmied Hans Stephl, damals wohnend und arbeitend in Anwesen Nr.6/heute Kleiaigner Straße 1, mit 2 Talern Strafe belegt wurde, da „bei ihm neben dem Rauchfange bei hellem Tage das Feuer ausgeschlagen, (so) daß die Schindl aufm Tach angezündet worden…woraus leichtlich aine grosse schedliche Feuers prunst hette entstehen khönnen“. Hier handelt es sich um einen sog. Kaminbrand. Damals trugen sämtliche Häuser, ausgenommen vielleicht die der kirchlichen Einrichtungen, Schindeldächer. Gerade über diese setzten sich bei günstigen Windverhältnissen Großbrände walzend und oft kaum löschbar fort. So brannte am 29. Juni 1863 die Osthälfte der Stadt Furth völlig nieder, da sich das Großfeuer hauptsächlich über die hölzernen Schindeldachungen verbreitete. Einzig das 1862 erbaute Amtsgericht blieb verschont. Es trug bereits Ziegeldach.
Werner Perlinger
Das Hausierwesen des 19. Jahrhunderts im Hohenbogen-Winkel
+Eschlkam. Auch für Eschlkam mussten Bestimmungen erlassen werden, damit die Wanderhändler – wenn gegeben – erfasst werden konnten.
Als „Hausierer“ werden noch heutzutage von Haus zu Haus gehende Händler bezeichnet. Sie bieten im Gegensatz zum Handelsvertreter oder Handelsreisenden, die im Auftrag eines Unternehmens unterwegs sind, ein eigenes Warensortiment auf eigene Rechnung an. In der heutigen Zeit gelten für Hausierer in Deutschland die Bestimmungen für ein Haustürgeschäft und sie benötigen eine Reisegewerbekarte. Früher galt die Bezeichnung „Hausierer“ auch für Anbieter von Dienstleistungen, z. B. Kesselflicker und Scherenschleifer, die früher häufig noch ihre Dienste anboten. Während der Ausübung seiner Tätigkeit transportierte der Hausierer seine Ware aus eigener Kraft mit dem Schubkarren oder Handwagen, in einem Rückentragekorb oder einem übergeworfenen Quersack, oder er bot sie in einem Bauchladen an. Als sozialer Aufstieg galten ein Hundegespann, Fahrrad, Pferdefuhrwerk und in der Zeit zunehmender Technisierung das Automobil. Sie waren fester Bestandteil insbesondere der ländlichen Sozialstruktur. Vor allem die Bauern und auch deren Bedienstete, die Ehehalten, richteten sich auf ihr durchaus erwünschtes, oft herbeigesehntes Kommen ein. Ihr Warenangebot umfasste nämlich meist die Artikel, die in ländlichen Gegenden nicht erhältlich waren und auch nicht selbst hergestellt werden konnten. Eine ihrer wichtigsten Nebenfunktionen war auch, dass sie Nachrichten und Informationen aus dem weiteren Umfeld überbrachten und das in einer Zeit als das Radio oder die Tageszeitung im ländlichen Haushalt noch nicht üblich waren. So viel zu einer Berufsgattung, die es heute so nicht mehr gibt.
Wie viele andere Kommunen im Lande auch musste sich der Markt Eschlkam im Jahr 1847 eingehend mit dem „Hausier- und Kleinhandel“ beschäftigen. Um eine organisatorische, vor allem aber eine rechtliche Hilfe den Gemeinden anbieten zu können, gab für den Hohenbogen-Winkel das Königliche Landgericht für den Hausier- und Kleinhandel zu erfüllende Richtlinien vor:
Stutzig wird der Leser wenn es dazu einleitend heißt, „Der Hausier- und Kleinhandel ist im Allgemeinen und aus Rücksicht der Gewerbe, der Zollverhältnisse und der allgemeinen Sicherheit verboten“, und doch kommt dazu noch eine Einschränkung: „Nur ausnahmsweise dürfen Hausier- und Kleinhandelsbewilligungen ertheilt werden“. Um eine Übersicht über die sog. Hausierer zu erhalten „und um Unterschleife zu verhüten, erachtet man es für angemessen alljährlich im Monate Oktober die Gesuche zum Hausier- und Kleinhandel aufzunehmen“ und zwar mit folgender Anordnung:
- Alle bisher erteilten Genehmigungen für diese Art Handel werden eingezogen.
- Ein Gesuch müsse erneut gestellt werden.
- Dabei müsse jeder Gesuchsteller vorlegen den bisherigen „Handelsbewilligungsschein“, sowie ein Zeugnis der Gemeindeverwaltung. Dieses musste enthalten die genaue Adresse, das Alter, den Familienstand, ein Leumundszeugnis, bisherige „Erwerbsart“, die genaue Bezeichnung seiner Handelsware sowie bei „Gegenständen der Handarbeit die bestimmte Bezeichnung und dass der Gesuchssteller den Artikel selbst verfertigt“.
Mit letzterem Hinweis wollte man in erster Linie das heimische Handwerk vor unliebsamer Konkurrenz schützen. Das Landgericht appellierte weiter, „man erwartet von den Bürgermeistern, daß sie bei Ausfertigung der Zeugnisse gewißenhaft verfahren und insbesondere keinem Individuum ein Zeugnis ausfertigen, welches zu anderartigen Gewerbe die physischen Kräfte oder auch nur den geringsten getrübten Leumund hat und überhaupt nicht Personen, von denen zu befürchten ist, daß sie die ihnen dargebotene Gelegenheit statt zu einem ehrlichen Fortkommen zu einem unehrlichen Gewerbe, zum Vagieren (herumstreunen), zum Betteln, zum Schwärzen (Schmuggel) und sonstiger Belästigung des Publikums mißbrauchen.“
Termine festgelegt
Für die Aufnahme der Gesuche wurde für die Gemeinden, die „zum Gebiete Hohenbogen und Haidstein gehören, der Mittwoch, 13. Oktober 1847 festgelegt; für die Gemeinden, die „zum Gebiete in der Lam u. in Zell u. am Regen gehören, auf Donnerstag den 14. Oktober l(aufenden) J(ahres), was in der Gemeinde auf gehörige Weise bekannt zu machen ist“. Unterschrieben hat diese Anordnung der damals amtierende Landrichter von Paur.
Eigentlich war der Staat grundsätzlich gegen den Hausier- und Kleinhandel. Leicht hatten es die Bewerber für diese Berufssparte nicht eine Konzession zu erhalten. Andererseits versuchte der Staat mit den (strengen) Auflagen zu verhindern, dass vielleicht Kleinkriminelle sich um diese Tätigkeiten bemühten, um andererseits so die Möglichkeiten zu erhalten Straftaten zu begehen.
Dementsprechend wurden Hausierer auch mit Misstrauen betrachtet, man unterstellte ihnen Diebstähle oder ein Auskundschaften für Diebe; auch Betrügereien mit minderwertiger oder überteuerter Ware wurden immer wieder weiter erzählt, nicht zuletzt weil der Hausierer nach dem Verkauf weiterzog und daher, anders als ein ortsansässiger Händler, nicht für Reklamationen erreichbar war. Im 20. Jahrhundert wurden verschiedene Vorschriften erlassen, die den Hausierhandel reglementierten. Pflicht ist es letztendlich eine Reisegewerbekarte mitzuführen. Heutzutage und das darf gesagt werden, ist der Hausierhandel völlig ausgestorben.
Werner Perlinger
Die Türkenkriege - eine mögliche Verbindung zu Eschlkam?
+Eschlkam. Vorerst ein kleiner Blick in die Geschichte des Abendlandes:
Im Jahre 1453 eroberten die Türken Konstantinopel, das heutige Istanbul. Somit stand dieses Volk, eine im Mongolensturm nach Kleinasien verschlagene Gruppe von muslimischen Turkmenen, auf dem endgültigen Sprung in das Abendland, nachdem die Osmanen das europäische Hinterland von Konstantinopel schon seit 1354 besetzt und im Jahr 1389 in der Schlacht auf dem Amselfeld die Serben entscheidend besiegt hatten. So setzte die kriegerische Bedrohung des christlichen Europas ein. Der Expansionswille der Sultane nach Westen war gewaltig. Die härteste Situation für das Abendland entstand im Jahr 1683, als die Türken erneut vor Wien standen. Nur mit Hilfe von Truppen aus dem gesamten Reich, dann päpstlichen und in der Endphase polnischen Kontingenten konnte dieser zweite Angriff auf Wien entschieden abgewehrt werden.
Die darauffolgende Vertreibung der Türken aus Ungarn und Siebenbürgen ist das militärische Ergebnis der österreichischen Heldenepoche unter Herzog Karl von Lothringen, Kurfürst Max Emanuel von Bayern und dem Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen. Im Sommerfeldzug des Jahres 1688 unternahmen die bayerischen Kontingente unter Führung von Kurfürst Max Emanuel einen tollkühnen Sturm auf Belgrad, der den Ruhm Max Emanuels als „Blauen Kurfürsten“ durch ganz Europa trug.
Es mag bei diesen letzten Ereignissen geschehen sein, dass durch einen oder vielleicht auch mehrere Männern aus dem Raum Eschlkam als Teilnehmer an diesem letzten Feldzug bei der Heimkehr im Gefolge zwei Frauen türkischer Herkunft mitgebracht wurden. Denn in der Taufmatrikel des Marktes, niedergeschrieben von dem damaligen Pfarrer Adam Muck, finden sich auf einer eigenen Seite des Buches als eine Besonderheit und nicht in der üblichen tabellarischen Aufreihung der Taufen folgende Einträge, die bei erster Betrachtung dem Leser rätselhaft erscheinen mögen. Die originale Schilderung lautet jeweils, gefolgt von der Übertragung in unsere Sprache:
„Anno 1690 die 7. May, incidente in dominicam Exaudi; ego Adamus Muck S: Th: Lcts p.b: parochus Eschlcambensii solemniter baptizavi turcam Sufficienter instructam, Mariam Franciscam Theresiam, tringinta ciciter annorum, nata ex Patre Mustapha Smeil de Belgrado et matre Einon Euscha eius uxore. Matrina erat Praenobilis domicella Anna Maria Francisca Ungelterin de Theissenhausen, adhuc soluta.“
Übertragung: Im Jahre 1690, es geschah am 7. Mai, am Sonntage Exaudi („höre oh Herr“ = der 6. Sonntag nach Ostern), dass ich Adam Muck, Sancte Theologie Licentiat, Pfarrer von Eschlkam feierlich eine Türkin als Maria Franziska Therese getauft habe, ungefähr 30 Jahre alt, genügend eingewiesen (in den katholischen Glauben). Der Vater (ist) Mustapha Smeil aus Belgrad und Einon Euscha, seine Frau. Patin war das adlige Fräulein Anna Maria Franziska Ungelter von Teissenhausen (Deisenhausen, Landkreis Günzburg), (diese) bisher frei und ungebunden.
Ein bildlicher Abschnitt im Ortswappen von Deisenhausen stammt aus dem Wappen der Ulmer Familie Ungelter, die sich auch Ungelter von Deisenhausen nannte und von 1409 bis 1554 in Deisenhausen belegt ist. Eine Beziehung dieser Patin zur Familie Altmann dürfte im befreundeten Bereich zu suchen sein.
Muck schreibt weiter: „Eodem anno, die vero 16. May, incidente in feriam tertiam Pentecostes idem ego Adam Muck eadem solemnitate baptizavi aliam Turcam, pariter in Sufficientis fidei Catholica instructam, Mariam Rosinam 30 circiter annorum, prognata ex Padre Mustapha mercatore quondam Belgradi et uxore eius Saligabola. Matrina erat domina Anna Rosina Altmannin, domini Wolfgangi Sighardi Altmann, Consulis in Eschlcamb uxor.“
Übertragung: Im gleichen Jahr, am 16. Mai, am 3. Tage nach Pfingsten, habe ich Adam Muck ebenso feierlich getauft eine andere Türkin, in gleicher Weise eingewiesen in den katholischen Glauben, als Maria Rosina, ungefähr 30 Jahre alt, abstammend von dem Kaufmann Mustapha, ehedem von Belgrad und seiner Frau Siligabola. Patin war Frau Anna Rosina Altmann, Gemahlin des Herrn Wolfgang Sighardt Altmann, Ratsherr in Eschlkam.
Die bisherige, einmal geäußerte Meinung, der Gutsbesitzer Wolf Sighardt Altmann (heute Gasthof Penzkofer) selbst habe diese beiden türkischen Frauen aus dem erfolgreich verlaufenen Krieg sozusagen als „Beute“ mit nach Eschlkam gebracht, kann insoweit nicht stimmen, als besagter Altmann laut Inhalt der Ratsprotokolle in den fraglichen Jahren von 1685 bis einschließlich 1690 stets an allen Ratssitzungen in seiner jeweiligen Eigenschaft als Bürgermeister oder Ratsherr teilgenommen hatte. Er war demnach nicht außer Landes gewesen. Auch die Meinung, dass Altmann eine der beiden geheiratet hätte, ist aus folgenden Gründen zu revidieren: Seine Frau tritt bei der zweiten türkischen Frau als Patin auf. Sie stirbt erst viel später. Das zweite Mal heiratet der Witwer Altmann am 11. Februar 1721 die Tochter des Schusters Anna Zilckher von Nr. 18, heute Further Straße 8. Elf Jahre später, 1732 stirbt Altmann im Alter von 73 Jahren.
Man könnte in diesem Fall auch von sog. „Beutetürkinnen“ sprechen. Der anfängliche Status als Sklaven - wenn es wirklich so gewesen sein sollte - wandelte sich - wie bei vielen Beispielen landesweit bekannt - schnell in Patronage-Beziehungen von quasi-familiärem Charakter. Der Entlassung in die Freiheit und Einbürgerung der damals vielen nach Bayern verschleppten Türken war landesweit ein Integrationskonzept vorgeschaltet, welches nach Erlernen von der „Teutsche(n) Sprache und Haubtstücke der Christlichen Lehre“ in die Konversion vom Muslimen zum Christen mündete. In unserem Fall ist daher zu vermuten, dass die beiden Frauen, betrachtet vom Status der Patinen her, vielleicht zu deren Dienerinnen wurden. Das weitere Schicksal der beiden Frauen, ob sich die eine in Eschlkam oder die andere im schwäbischen Bereich verheiratete, kann vorerst nicht in Erfahrung gebracht werden. Tatsache ist vielmehr, dass sich bei gründlicher Nachschau bis zum Jahr 1690 kein Heiratseintrag fand, der auf eine der beiden Frauen auch nur annähernd zutreffen könnte.
Werner Perlinger
Maul- und Klauenseuche in Eschlkam
+Eschlkam. Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hoch ansteckende, nicht immer aber tödliche Viruserkrankung bei Klauentieren wie Rindern, Ziegen, Schafen und Schweinen. Sie ist und war schon früher eine anzeigepflichtige Tierseuche. Pferde sind nicht und Menschen nur selten für MKS anfällig.
„Die so genannte Klauen- und Maulseuche unter dem Hornvieh und die vorgeschriebenen Mittel zur Unterdrückung betr.“, tituliert ein Akt aus dem Jahr 1827, der die damalige Lage in Eschlkam beschreibt. In einem Circulare (Rundbrief), herausgegeben von der Regierung am 20. August, werden Methoden und Mittel „zur Abwehrung gegeben, die in den betroffenen Gemeinden den Viehbesitzern bekannt zu machen sind“. Dabei werden erst die Anzeichen geschildert, an denen die Seuche zu erkennen sei. Bei der „Maulseuche“ heißt es u.a. „das Vieh wird traurig, unruhig, verliert die Lust zu fressen, es läuft ihm häufiger Speichel aus dem Maul. Das Kauen und Schlucken wird beschwerlich“. Genau werden die äußeren Anzeichen wie Blasenbildungen und Geschwülste im Maul der Tiere geschildert, damit die Landwirte die Krankheit leicht erkennen können. Ähnlich genau ist die Schilderung beim Befall der Klauen. Symptome wie Hitze, Empfindlichkeit und die schmerzhaften Geschwülste im Hufbereich werden detailliert erwähnt.
Gegenmaßnahmen vorgeschlagen
So sei für die entzündenden Mäuler „hartes stänglichtes Futter“ zu vermeiden. Nur mehr „frische und weiche Nahrungsmittel“ kämen in Frage. Das galt auch für die Gesundung der Klauen. Hierbei sei auf „die Reinigung der Ställe vom Mist und Odel“ zu achten. Stets sollte trockene „weiche Streu, Schwemmen und Trinken in kalten Wasser“ wie auch „öfteres Abwaschen der Füße mit Salz oder Essigwasser, Einschlagen der spröden warmen Klauen mit Lehm-Essig-Brei mit Sauerteig oder auch mit Wagenschmiere empfohlen“.
Am 1. Oktober 1827 informiert das Landgericht Kötzting den Markt, „nach einer hierorts eingelaufenen Anzeige soll in Eschlkam u. in der Umgebung die sog. Maulseuche unter dem Hornvieh herrschen“. Der Magistrat habe „sogleich nachzuforschen“ ob diese Situation gegeben sei. In einem Circulare informiert zwei Tage später das Landgericht, in Böhmen sei die Seuche schon ausgebrochen und erste Erkrankungen zeigen sich bereits in mehreren bayerischen Grenzorten. Tags darauf meldet der Markt, die Seuche „herrsche im Markt dermal nicht“, sie trete aber in den Dörfern Großaign, Kleinaign und Stachesried auf. Man konnte in Erfahrung bringen, „daß keine Viehstücke (bisher) gefallen (verendet) sind“.
Die Seuche ließ sich jedoch nicht aufhalten. Am 13. Oktober musste der Markt berichten, dass in den Stallungen des Joseph Weber, des Pfarrhofes und bei den Bürgern Anton Riederer, Georg Schreiner, Joseph Pfeffer und dem Hutmacher Jakob Fischer „einige Stücke an Ochsen und Kühen erkrankt“ seien. Wenige Tage später, am 24. Oktober, forderte Kötzting eine genaue Auflistung „über samentliche erkrankten und krepierten Thiere“. Am 10. November wurde der Markt nochmals aufgefordert innerhalb von acht Tagen eine Liste über die „erkrankten Stücke Viehes herzustellen und zugleich darin anzuführen, wie viele Stücke an dieser Krankheit krepiert sind“.
Seuche ausgebrochen
Daraus ist zu erkennen, dass innerhalb weniger Wochen bei 20 Ökonomiebürgern in den Viehställen die Seuche ausgebrochen war. Im Einzelnen aufgezählt wurden Ochsen, Stiere, Kühe und das Jungvieh. So waren bei Joseph Weber (heute Penzkofer) 18 Tiere, bei seinem Nachbar Leitermann (Gutenthaler) 10, im Pfarrhof sechs oder bei Georg Schreiner acht Tiere erkrankt. Keines der von der Maul- und Klauenseuche befallenen Tiere „ist hiervon krepiert“, so der abschließende Bericht.
Mit sorgsamer Behandlung konnten die Eschlkamer ihren Viehbestand über diese leidige Zeit bringen. Trotzdem, Einbußen gab es allemal. Die Kühe lieferten in der Zeit dieser Pandemie nahezu keine Milch mehr. Auch magerten die zum Verkauf gedachten Tiere wie Stiere und Ochsen stark ab und bedeuteten so für die Ökonomiebürger zunächst einen erheblichen Verlust.
Ein erneuter Ausbruch
Im Jahr 1890 brach im Markt erneut die gefürchtete Seuche aus. Betroffen davon war zunächst das Vieh des Krämers Peter Seiderer und des Gastwirts Franz Baumann. Am 20. Juli wurde vom Bürgermeisteramt eine sofortige „Gehöftesperre“ verhängt, d.h. es durften daraus weder Tiere verkauft noch „aufs neue wiederkauernde Tiere und Schweine in den Stall gebracht werden“. Nur einen Tag später war auch der Stall des Ludwig Riederer betroffen. Tafeln mit dem Titel der Seuche „Maul- und Klauenseuche“ mussten an den Toren dieser Gehöfte angebracht werden. Die nächsten mit der Seuche belasteten Landwirte waren der Häusler Georg Seidl und der Schuhmacher Franz Schmirl. Bereits am 25. Juli wurde nun über den „ganzen Ortsgemeindebezirk Eschlkam“ eine „Gehöftesperre verhängt. Ab Anfang August konnten die Sperrmaßnahmen Zug um Zug wieder aufgehoben werden. Befohlen wurde, die betroffenen Ställe gründlich zu reinigen. Auch durfte der dort angefallene Mist als Dünger auf „solchen Grundstücken welche vom Vieh seuchenfreier Gehöfte betreten werden nicht verbracht werden“. Die Seuche war letztlich bis zum Winteranfang glücklicherweise abgeklungen.
Welche Auswirkungen die Maul- und Klauenseuche auch auf das gesellschaftliche Leben der Menschen haben konnte zeigt sich darin, dass beispielsweise im Jahr 1920 in der Stadt Furth wegen der Verbreitung dieser Krankheit der Drachenstich als Festspiel nur in einem Saal stattfinden konnte, so dass die geplante Aufführung am Stadtplatz ausfallen musste.
Werner Perlinger
Bürger im Streit um Grenzmarkungen – Steuern wurden unnachsichtig eingetrieben
+Eschlkam. Es war früher nicht selten, dass einzelne Marktbürger wegen oft nur geringfügiger Angelegenheiten miteinander in Streit gerieten und sich nicht vor dem offiziellen Amtsgericht, sondern vorerst auf unterster Instanz zunächst vor dem Magistrat trafen und hier ihre Anliegen vorbringen konnten. Dieser war darauf bedacht eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen, um so einen vielleicht für die eine oder andere Partei teuer werdenden Rechtsstreit zu vermeiden.
Wir schreiben das Jahr 1800. Der Bürger und Krämer Mathias Bartl (Hsnr. 25/Waldschmidtplatz 8) klagte am 30. August gegen die verwitwete Baderin Rosalia Grauvogel (Hsnr. 7/Kleinaigner Straße 3) wegen „Versetzung der Zaunstatt“ und wegen „Herabackerung des Feldes“ in seinen Wiesengrund. Im Bereich der „Paindt“, heute das fast völlig bebaute Gebiet im Westen des Marktberges, trafen beider Gründe aufeinander, ordentlich mit Marksteinen abgemarkt und getrennt nur durch einen sog. Speltenzaun, bezeichnet im Akt auch als „Zaunstatt“.
Dazu sei vorweg folgendes gesagt: In der sehr kleinteiligen Landwirtschaft von damals gehörte jeder noch so kleine Feld- oder Wiesenstreifen unabdingbar zur meist knapp bemessenen Existenzgrundlage. Daher wurde stets peinlichst auf die Bewahrung der Grundstücksgrenzen geachtet und jede noch so kleine Veränderung vor Gericht gebracht. Lesen wir die Erinnerungen des Literaten Ludwig Thoma über seine Zeit als Anwalt in Dachau, so findet sich ein Hinweis, dass mancher Streit um Ackergrenzen so viel kostete wie eine mögliche Vergoldung der umstrittenen Grenzfläche.
Einig wurden sich die Parteien beim ersten Termin vor dem Magistrat zunächst nicht. Eine Inaugenscheinnahme der Grundstücke wurde beschlossen. Als sog. „Beschaumänner“ wurden mit Zustimmung der Parteien vom Magistrat ausersehen der 51 Jahre alte Bürger und „Haimater“ Anton Kolbeck von Anwesen Nr. 3, heute Waldschmidtstraße 8 und der Totengräber Franz Würz. Dieser wohnte in Haus Nr. 29, heute Kirchstraße 10.
Der Bauer Kolbeck erkannte, dass mittig „ein Zaunstecken einen Handbreit zu weit“ in die Wiese des Bartl „beigezogen“ worden sei. Er empfahl zwischen beiden Grundstücken einen „Rain“ einen Schuh breit (ca. 30 cm) anzulegen. Ein Taglöhner sollte die „Zaunstecken“ (neu) einschlagen.
Totengräber Würz, 53 Jahre alt, glaubte ebenso festzustellen, dass die Frau Grauvogel „gegen die Mitte des Feldes einen Zaunstecken um eine Handbreit zu weit in die Wiese des Bartl habe setzen lassen“. Auch er empfahl die Anlage eines „Rains“ um künftige Irrungen zu vermeiden.
Damit schließt der Akt, was vermuten lässt, dass sich beide Parteien schließlich gütlich einigten.
Als Fuhrleute jahrelang unterwegs
Das (noch) kurfürstliche Landgericht Kötzting beauftragte am 8. Oktober 1805 den „Bannmarkt“ Eschlkam den „beyden Fuhrleuten und Gebrüdern Johann und Georg Späth zu bedeuten: sie hätten auf Samstag den 10. dieß Monats zu dem Ende unausbleiblich hier zu erscheinen, um in ihrem bei dem K(aiserlich) K(königlichen) Landrichter in Prag anhängigen Confiscationsprozeße (Verfahren wegen Beschlagnahme) das Weitere zu vernehmen“. Zwei Tage später antwortete der Magistrat, dass beide Brüder nicht erscheinen können „weil sie sich auf dem Land befänden und nicht wissent ist, wann sie zu Hause ankommen werden“. Beide Brüder stammten aus dem „Hoamater“-Hof, Nr. 4/Waldschmidtstraße 6. Georg ist später als Inhaber von Nr. 36/Marktstraße 9 nachweisbar. Am 18. Oktober befahl Landrichter Pechmann von Kötzting, beiden Brüdern die Klage bei ihrer Rückkunft sofort zuzustellen. Die Angelegenheit zog sich hin. Der Magistrat von Eschlkam informierte am 4. März 1806 das Landgericht, dass die beiden Brüder „in Betreibung ihres Fuhrwerks in einem Zeitraum von 3 und 4 Jahren zu Hause nicht ankommen und gegenwärtig wieder abwesend sind“. Daher könne die „Konfiskations Klage“ nicht zugestellt werden.
Frühe Spediteure
Diese Hinweis lässt den Schluss zu, dass die beiden aus dem Markt stammenden Fuhrleute weit über ihre Heimatregion hinaus für ihre Auftraggeber wohl nicht nur im damaligen Reichsgebiet sondern auch in den angrenzenden Ländern, wie aus dem Akt hervorgeht, hauptsächlich in den böhmischen Landen unterwegs waren, die als Kronland zum Hause Habsburg mit Regierungssitz in Wien gehörten. Heute würde man sie als Spediteure bezeichnen können, denn nach Aktenlage bildeten die Brüder ein Unternehmen, das den nationalen sowie internationalen Transport von Gütern betrieb.
Der Staat wurde mittlerweile ungeduldig. Am 9. Oktober 1807 wandte sich das Königliche Hofgericht von Niederbayern im Namen seiner (nun) königlichen Majestät von Baiern (seit 1806 König Max I.) an den Markt mit der Frage, wann die „kaiserlich königliche fiskalische Klage“ den Gebrüdern Späth nun zugestellt worden sei. Erst am 13. Juli 1808 erfahren wir, dass der K. und K. Fiskus von den Späths für den „zu erlegenden Warenwerth“ (Preis einer Ware für den Endverbraucher) in puncto Debiti (Schulden) eine Steuer(nach)zahlung in Höhe von 199 Gulden 30 Kreuzer forderte. Das war damals nicht wenig Geld. Zugleich sei innerhalb acht Tagen zu melden, wann „die fiskalische Klage“ den Brüdern zugestellt worden sei.
Am 10. August 1808 bedauerte der Magistrat gegenüber dem „königlich-bairischen Hofgericht“ in Straubing, dass die „Späth‘schen Bürgerskinder und Brüder Johann und Georg in den letzten zwei bis drei Jahren hinsichtlich Betreibung ihres Fuhrwerks gar nicht zu Hause ankommen, und auch dermal sind sie wieder abwesend“. Am 10. August meldet der Magistrat, dass die Späth’s sich in Prag befänden, da sie dort „die meisten Ladungen erhalten“.
Der Staat ließ aber nicht locker. Am 27. Oktober 1808 befahl das Landgericht, sollten die Brüder abwesend sein, so sollten deren nächste Angehörige ermittelt werden, um denen die Klage des königl. böhmischen Kammer-Fiscus zustellen zu können. Am 3. November antwortet der Magistrat, es werde die Mutter der beiden Brüder – da sie wieder abwesend seien – „zur Behändigung der Kaiserl. Königl. böhmischen Fiscalischen Klage abgeordnet“. Zugleich meldete der Magistrat, dass ihr Vermögen „genugsam hinreicht, eine allenfalsige Ausschreibung in den Zeitungen bestreiten zu können“. Damit endet der Akt. Die Späth’s dürften ihre Schuld gezahlt haben. Letztlich behielt sich der böhmische Staat vor, die Schulden bei den nächsten Angehörigen einzutreiben. Damals regierte von 1792-1835 Kaiser Franz I. als römisch-deutscher Kaiser, zugleich war er König von Böhmen.
Werner Perlinger
Der Bürger Mathias Schreiner kämpfte weiter um eine Heiratserlaubnis
+Eschlkam. Wie wir im letzten Beitrag gesehen haben, hatte das Schreiben des Anwalts Himmelstoß vom 5. Dezember 1842 für seinen Mandanten Mathias Schreiner keinen Erfolg. Aber, bedingt sicherlich durch seine schwierige familiäre Lage, unternahm der Witwer in der Folgezeit erneut einen Anlauf, um eine Frau für seine kinderreiche Familie zu finden. Monate später, vom 28. August 1843 datiert eine längere Niederschrift, tituliert als „Petitum“ (Bittschrift), verfasst vom Marktschreiber (Franz) Bach. In dieser sog. Bittschrift wendet sich Schreiner wiederum an den „Marktsmagistrat“, an dessen Spitze immer noch als Bürgermeister der Schreiner (Michael) Kaufmann (damals Burgweg 2) stand, um die amtliche Erlaubnis das zweite Mal eine Ehe eingehen zu dürfen.
Wie eigentlich schon hinreichend bekannt, schilderte der „behauste Bürger und Grundbesitzer“, dass sein „Eheweib Barbara, geb. Gergor“ bereits vor zwei Jahren „mit Tod abgegangen und aus dieser Ehe sind 6 Kinder vorhanden, wovon wenige majoren (erwachsen) sind“. Noch einmal betont Schreiner, dass er als „Wittwer zu seiner Hausführung und guter Erziehung meiner Kinder ein zweites Eheweib“ benötige. Auch führt er an, dass er „als ansässiger Bürger“ sein Besitztum nicht verändert habe. „Auch gebe ich meine Steuer (und leiste) auch die jährlichen Communal-Abgaben“.
Als „meine Braut habe ich mir (nun) die Halbbauerstochter Anna Fischer von Niesassen erwählt, welche nach Zeugnis der Landgemeindeverwaltung Liebenstein vom 2. August 1843 ein Vermögen von 150 f (Gulden) besitzt, (und) nach (dem) Taufschein der k(atholischen) Pfarrei Rimbach vom 22. August 43 Jahre schon alt ist“. Auch habe sie nach Zeugnis der Lokalschulinspektion Zenching vom 18. August 1843 die Werk- und Feiertagsschule fleißig besucht, „auch der Sonntags-Christenlehre ebenso fleißig beygewohnt“. Interessant ist auch der Hinweis, dass seine Braut sich „mit einem Blatterschein ausgewiesen hat“. Bereits damals war die als „Pocken“ oder „Blattern“ bezeichnete Seuche eine für den Menschen gefährliche und lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die schon im frühen 19. Jahrhundert mittels Impfungen erfolgreich bekämpft wurde.
Schreiner schloss sein Bittschreiben mit den Worten „da ich mit dieser Heyrath nichts anders beabsichtige, als die Wohlfahrt für mich und meine unmündigen Kinder“, so bitte ich die Heiratsbewilligung mit der Anna Fischer „großgünstig zu beschließen“.
Die Gemeindebevollmächtigten, sechs Mitbürger des Schreiners, sahen nun die „Notwendigkeit“ einer Eheschließung allein schon aus dem Umstand der vorhandenen Kinder aus 1. Ehe ein und gaben dazu einstimmig ihr Plazet. Diesem Votum schlossen sich die Mitglieder des sog. „Armenrathes“ uneingeschränkt an. Bevor jedoch die amtliche Zustimmung gegeben werden konnte, musste die Braut, die mittels Heirat nun auch Mitglied der Bürgerschaft in Eschlkam wurde, amtliche Zeugnisse vorlegen, die sämtliche auch akzeptiert wurden. Laut Ehematrikel der Pfarrei heiratete der Witwer Schreiner am 11. September 1843 die fast gleichaltrige „Halbbauernstochter“ Anna Fischer (geb. 1800) von Niesassen.
Der Regenschirmmacher
Letztlich sei auch das Bemühen des „Parapluimachers“ Georg Hausladen, eine Heiratserlaubnis von der Marktführung zu erhalten, in wesentlichen Inhalten vorgestellt. Georg Hausladen fertigte Regenschirme, damals gerne als „Paraplui“ bezeichnet. Dieses Wort kommt aus der französischen Sprache und ist abgeleitet von „parapluie“ für Regenschirm. Hausladen, geb. am 26. Juli 1806 in Schafhof bei Rimbach, hatte für seine Zeit einen modernen Beruf. Nicht nur dass seit Jahrhunderten die bestehende alte Kleidertracht von der städtischen Mode immer mehr verdrängt wurde, auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie die Benützung von Sonnen- und Regenschirmen wurden von der ländlichen Bevölkerung allzu gerne von den Städtern übernommen. Für Hausladen ergab sich als sog. Regenschirmmacher so eine wirtschaftlich günstige Ausgangslage.
1859, am 14. Juni, sprach er beim Marktrat vor und erbat eine Heiratslizenz mit der Inwohnerstochter Anna Maria Neumeier von Offersdorf. Er sei seit 5. Mai im Besitze eines Anwesens im Wert von 700 Gulden, denn er hatte von Joseph Klessing das Anwesen Nr. 9/Kleinaigner Straße 11 gekauft. Seine „Parapluimachers-Konzession“ habe er bereits am 5. Juli 1858 vom Magistrat erhalten und die derzeitige Barschaft betrage sogar 800 Gulden. Seine Braut, geb. 1831, verfüge über 200 Gulden. Dennoch, mit dem deutlichen Hinweis, „dass Hausladen bereits das 58. Lebensjahr überschritten, über dieß kränklich und sich ein Mädchen von 27 Jahren zum Weibe ausgewählt hat, so daß er um 31 Jahre mehr zählt, wodurch noch große Nachkommenschaft zum Vorschein kommen kann, während bei dem Gesuchsteller eine baldige Arbeitsbeschwerlichkeit vorauszusetzen ist…so ist der Nahrungsstand (sogar) einer kleinen vielweniger großen Familie hinreichend nicht gesichert“, wurde Hausladen abgewiesen.
Wie Schreiner ging auch er in Berufung. Das Landgericht Kötzting als Vermittlerbehörde übermittelt am 21. September die Entscheidung der Königlichen Regierung von Niederbayern, Kammer des Innern mit Sitz in Landshut. Demnach sei dem Beschwerdeführer Georg Hausladen die „nachgesuchte Bewilligung zur Verehelichung zu ertheilen, nachdem Gesuchssteller als im Besitze einer mit Beschluß vom 5. Juli v(origen). Jahres verliehenen persönlichen Parapluimachers Konzession die Ansässigkeit bereits erworben hat und weil kirchenrechtliche Hindernisse und ausserordentliche Polizeirücksichten (mögliche Einsprüche dieser Behörde wegen begangener Straftaten) aber nach Lage der Akten nicht obwalten, sohin die Bewilligung des Gesuches…zum Rechte des Beteiligten erwachsen ist“. Der Magistrat konnte sich auch in diesem Falle nicht durchsetzen. Georg Hausladen heiratete seine um über 30 Jahre jüngere Braut im November 1859. Die Ehe dauerte keine zwei Jahre. Georg Hausladen verstarb bereits am 15. Oktober 1861. Damit endete abrupt ein bisher im Markt nicht, und dann nur kurze Zeit dagewesener Handwerkszweig, der wahrscheinlich entsprechend der aufkommenden Mode eine einigermaßen sichere Zukunft gehabt hätte.
Resumee: Der Staat tat mittlerweile alles um familiär ordentliche Verhältnisse zu schaffen. Er legte den heiratswilligen Leuten so weit wie möglich keine Steine in den Weg und förderte somit die Gründung von Familien. Darüber hinaus verhinderte er ebenso die Geburt von noch mehr unehelichen Kindern, was letztlich auch die Kirche gutheißen musste.
Werner Perlinger
Die Heiratserlaubnis musste im 19. Jahrhundert oft hart erkämpft werden
+Eschlkam. „Mathias Schreiner, behauster und bräuender Bürger im Markt Eschlkam wegen Wiederverehelichung mit beschlossener Abweisung“, lautet der Titel eines Aktes aus dem Jahr 1842. Der Inhalt dieses Vorgangs ist insofern interessant, als damals es für die wenig vermögenden Bürger sehr schwierig war, eine Heiratserlaubnis von der Marktführung zu erhalten.
Dazu folgende allgemeine Information: Bei dem Wort „Heiratserlaubnis“ denkt man zunächst an die Einwilligung der Eltern zu einer Ehe. Hier jedoch ist die behördliche oder dienstherrliche Heiratserlaubnis gemeint, die bis in die lehensherrliche Zeit des Mittelalters zurückgeht. Sie war ein Druckmittel auf die kleinen, besitzlosen Leute – vor allem Knechte und Mägde –, die sozial und wirtschaftlich abhängig waren. Mit dem Gemeindeedikt von 1818 wurde in Bayern der „Heiratkonsens“ den Gemeinden übertragen. Grund- und Hausbesitz, Steuerabgabe, Heimatrecht, ein einwandfreier Leumund waren unter anderem Voraussetzung für eine Heiratsgenehmigung. Erst ein Gesetz von 1868 brachte wesentliche Erleichterungen, die im Zweiten Reich unter dem Reichskanzler Otto von Bismark im Reichszivilehegesetz vom Februar 1875 fortgesetzt wurden.
Wir blicken zurück: Am 4. Februar 1821 hatte Mathias Schreiner, geb. in Klitschau (Klicov) in Böhmen, 25 Jahre alt, eine Barbara Gregor zur Frau genommen und so in das Anwesen Nr. 18, heute Further Straße 8, eingeheiratet. Gut 20 Jahre später, am 29. Oktober 1842 erschien Schreiner als „behauster und bräuender Bürger“ vor dem Magistrat und gab vor, er sei seit einem Jahr nun Witwer und alleiniger Besitzer des Bürgeranwesens. Er habe „in der Ehe 6 jedoch alle noch unversorgte Kinder erzeugt und bin daher genötigt mich, 45 Jahre alt, zu verehelichen“. Als „dermaligen Brautgegenstand“ habe er die Inwohnerstochter Therese Arnold von Schwarzenberg gefunden. Sie verfüge über ein Vermögen von 150 Gulden. Unterschrieben hatte Schreiner als Bittsteller des Schreibens unkundig, mit drei + + + als damals amtlich gültiges Handzeichen.
Geordnetes Haushaltswesen angestrebt
Schreiner suchte allein schon wegen der vielen Kinder und der Führung eines geordneten Haushaltswesens nach einer Ersatzmutter, Gründe die eine Entscheidung der Gemeindebevollmächtigten als erste Entscheidungsinstanz zu Gunsten des Witwers eigentlich leicht machen sollten. Aber das Gremium lehnte am 5. November entschieden ab mit dem Hinweis, „daß wir dieses Gesuch nicht gut heißen können“, weil die Braut erst 23 Jahre alt, bereits ein uneheliches Kind besitze und erneut „in gesegneten Leibesumständen“ sei und somit zwei Kinder in die Ehe mitbringe. Auch ist „sie von niederem Stande und leichtfertigen Wandels“. Bei schließlich acht Kindern und es seien „noch so viel zu hoffen, andererseits sein Besitzthum an Grund und Boden gewiß (er) der Geringste ist, womit also zu ernähren, so liegt vor Augen, daß er sich gänzlich schade, seine Familie aber der Gemeinde zur Last fallen müßte“. Letzteres war der Hauptgrund für die Ablehnung des Gesuchs, bestätigt mit den Unterschriften der zehn Bevollmächtigten, sämtliche Bürger des Marktes.
Das Gesuch Schreiners wurde von Bürgermeister (Michael) Kaufmann (Hsnr. 31/Burgweg 2) am 8. November „urschriftlich“ an den „Armenschaftsrat“ der Gemeinde weitergeleitet. Dieser, bestehend aus vier Bürgern, lehnte aus den gleichen Gründen Schreiners Bitte ab. Zu groß war die Sorge, dass die groß angewachsene Familie einmal von Gemeinde unterhalten werden müsste. Der dann offizielle „magistratische Beschluß“ folgte am 25. November mit dem Hinweis, „daß dem Schreiner die Abweisung zu bedeuten sei“. Begründet wurde dies damit, dass die Arnold mit 23 Jahren für den „Wittman“ (Witwer) Schreiner“ zu jung sei, dann „6 lebende alle noch unversorgte Kinder vorhanden seien“, und „es vor Augen liegt, daß durch den Anwachs von Kindern aus der zweiten Ehe Schreiner unmöglich sich behaupten kann, solche zu ernähren, sondern kein anderes Mittel überbleibt, seine Familie einstens der Marktsgemeinde überzubürden“.
In Berufung gegangen
Schreiner gab jedoch nicht auf. Er fand sich durch diese Entscheidung „beschwert, die Berufung an den höheren Richter zu ergreifen“. Dazu nahm er sich als „Advocat“ zu Hilfe den Rechtsanwalt Himmelstoß aus Cham. Nicht nur dass dieser in seinem ausführlichen Schreiben vom 5. Dezember 1842 an die Königliche Regierung von Niederbayern die von der Gemeinde vorgebrachten Gründe gegen die Wiederverehelichung insgesamt verwarf, erinnerte er vielmehr daran, dass für seinen Mandanten als Bürger und Besitzer einer „Realität“ (Haus mit Grund und Boden und Braurecht) der „gesetzliche Titel zur Wiederverehelichung vorhanden“ sei, er für seine Kinder aus erster Ehe bereits das „Muttergut ausgezeigt“ (das sind die von der Mutter erworbenen Gegenstände, deren Eigentum den Kindern zustehen) habe und Schreiner zur Wiederverehelichung „gezwungen“ sei, da er „eine offene Wirthschaft hat“ und die 6 Kinder „zur Aufziehung eine Mutter nöthig haben“.
Was die Therese Arnold als Braut betreffe, habe diese „die zur Vorlage gebrachten Zeugniße über einen guten Leumand und über den vorschriftsmäßigen Schul- und Religionsunterricht ausgewiesen“. Auch bezeichnete der Anwalt die Ablehnung des Magistrats als „sämtlich unstichhaltig“, denn gerade die Schwangerschaft der Arnold „spricht für die Bewilligung“, da Schreiner diesem Kinde (ansonsten) eine „Alimentation reichen muß (regelmäßige Unterstützung mit Geld)“. Als Vorteil für den künftigen Haushalt des Schreiner mit doch vielen Belastungen sah der Advokat, dass Schreiner wegen der vielen zu erwartenden Arbeit – in seiner Wirtschaft kocht er auch für Fremde aus - „ein junges kräftiges Weib zu heurathen“ habe. In Anbetracht der vorhandenen sechs Kinder argumentierte Himmelstoß, „daß die offene Wirtschaft – derzeit eben wegen Fehlens einer Hausfrau an Joseph Leitermann verpachtet – wenn eine tüchtige Hausfrau an der Spitze steht, eine Familie nachhaltig nährt“. Das Schreiben des Anwalts hatte wider Erwarten keinen Erfolg. Das Gesuch Schreiners wurde abgewiesen.
Werner Perlinger
Als Pfarrer Wagner das Kirchenwachs aus Neukirchen doch nehmen musste
+Eschlkam. „Die Anna Maria Stöber von Neukirchen wegen in schlechter Qualität zum Pfarrgotteshaus Eschlkam gelieferten Wachses, und die ihr Magistratsseits hierauf verweigerte Wachsabnahme betreffend, 1819“, lautet der Titel eines Vorgangs, niedergelegt im Marktarchiv.
Der Begriff „Lebzelter“ als Standes- und Berufsbezeichnung ist lange schon nicht mehr gebräuchlich. Dazu sei erklärt: Der „Lebzelter“ steht sprachlich veraltet für den Lebkuchenbäcker. Dieser stellte Backwerk aus Mehl und Honig (Honig- oder Pfefferkuchen) her und verfeinerte es mit Gewürzen, Mandeln und Nüssen. Daneben übten die Lebzelter sehr häufig auch den Beruf des Wachsziehers aus, denn für beide Produkte waren der Honig und damals auch das Wachs der Bienen erforderlich.
So wandte sich die Anna Maria Stöberin, bürgerliche Lebzelterswitwe am 5. April 1819 an das Landgericht Kötzting und klagte in einem umfänglichen Schreiben, dass es dem damaligen Eschlkamer Pfarrer im Jahr zuvor „gefiel, auf einmal eine Abänderung zu treffen und das Wachs für die dasige Kirche bei seinem Vetter, (dem) Lebzelter Riederer in Cam (Cham) abzunehmen, wozu ihn nur freundschaftliche (hier im Sinne von „verwandtschaftlich“) Verhältnisse“ seinerseits, „auf Seite des Riederer aber Gewerbsneid veranlaßt haben können“.
Wegen „Gewerbsschmälerung“, so der weitere Inhalt des Briefes vom 5. April, protestierte dagegen die Stöber bei der Königlichen Distriktsstiftungsadministration in Viechtach. Diese Behörde rief das Pfarramt Eschlkam „zur Verantwortung“ auf und letztlich wurde behördlicherseits veranlasst, „das Wachs für die Zukunft wie ehedem bey mir weiter abzunehmen“. Dennoch war die Angelegenheit noch nicht beendet. Die Regierung des Unterdonaukreises, Kammer des Innern, musste sich nun mit dieser Sache beschäftigen und mit zwei Einlassungen wurde zu Gunsten der Stöber entschieden. Pfarrer Wagner (er stand der Pfarrei von….) aber akzeptierte diese Entscheidung nicht, denn nach geraumer Zeit ließ er durch den Mesner wissen, „daß der nunmehrige Eschlkamer Bürgermeister Schreiner „als Handelsmann die Wachslieferung zum Gotteshause selbst übernommen hat und ich dahin keines mehr abgeben dürfe“.
Jedoch hatte die Stöber wegen des nahenden Osterfestes bereits „für dieses Gotteshaus schon eine Menge Vorrath an Kerzen zubereitet“, für die sie nun keine Absatzmöglichkeit mehr habe. Sie stellte daher an das Landgericht Kötzting „die demüthigts gehorsambste Bitte, dem Magistrat Eschlkam als Kirchenverwaltung aufzutragen“, dass die erforderlichen Wachskerzen von ihr abgenommen würden, „und mich mit ferneren Anträgen zu Gunsten eines in einem anderen Landgericht entlegenen Lebzelters um so richtiger verschonen wolle“, nachdem sie das Wachs wie bisher auch in bester Qualität zum gleichen Preis wie bisher abgebe, „als es (in) anderen Orten nach dem Satze abgegeben wird“.
Der Landrichter von Kötzting, Pechmann, befahl am 17. April dem Magistrat, „die Anna Maria Stöber klaglos zu stellen – oder in 14 Tägen Erläuterung (Erklärung) abzugeben“. Am 27. Juni wiederholte Kötzing gegenüber dem Magistrat die Aufforderung zur Stellungnahme. Am 16. Juli erklärte sich dazu ausführlich der Magistrat: So habe man „nach der Übernahme des Stiftungsvermögens keine andere Gesinnung, als ferners das Wachs in Neukirchen abzunehmen“. Das Pfarramt und auch der Mesner (damals Josef Zirngibl) hätten jedoch gemeldet: „da das Wachs von schlechter Qualität seit längerer Zeit wieder geliefert“ werde, habe der Pfarrmesner der Stöber „mündlich eröffnet, daß sie ihren Konto übergebenes Geld erheben soll, ein Wachs aber von hier aus nicht mehr abgenommen wird“. Auch dass die Lebzelterin „auf das heurige Osterfest die Schauerkerzen, ferners Dreyangl hat anfertigen laßen, ist ihre Schuld, denn sie habe schon seit vier Wochen gewußt, dass gar nichts mehr bestellt und abgenommen werde“. Auf die „Vetternwirtschaft des Pfarrers mit Lebzelter Riederer von Kam wird magistratsseits nicht gesehen, sondern (nur) auf die gute Qualität des Wachses, welches er auch liefert, und den doch geringen Preis mit welchen man allerdings zufrieden seyn kann“.
Am 22. Juli „notifiziert“ (informiert) das Landgericht den Magistrat, dass die Stellungnahme auch der Anna Maria Stöber zugestellt worden sei. Die Lebzelterin gab aber nicht auf. Am 16. August beklagt die Stöber in einem langen ausführlichen Schreiben, dass die Stellungnahme des Eschlkamer Magistrats „nicht nur meiner Ehre, sondern auch meinem Gewerbe äußerst nachtheilig“ sei. Vor allem bestreitet sie die angebliche schlechte Qualität ihres Wachses „als grundfalsch“. Auch betont sie, dass Pfarrer Wegner unbedingt dem Rieder in Cham als seinem „nächsten Blutsverwandten“ die Wachslieferung „eigenmächtig eingeräumet“ habe. Auch habe eine unabhängige Kommission ihr Wachs gegenüber dem des Riederer „in einer sehr guten, fast noch beßerer Qualität, als jenes vom Lebzelter Riederer in Cham erfunden“. Auch sei von Pfarrer Wagner veranlasst worden, dass Riederer das Wachs nach Eschlkam liefere und dieses Bürgermeister Schreiner als Krämer und Handelsmann „selbst im Verlage (als Ware) halten“ solle. Sie betont auch, dass „jedem Lebzelter von jeher zur Subsistenz (zur eigenen wirtschaftlichen Existenzmöglichkeit) schon gewiße Gotteshäuser zugetheilt worden sind und weil ich das Pfarrgotteshaus Eschlkam (deshalb) schon 40 Jahre continuierlich mit guter Ware bedient habe“.
Die Hartnäckigkeit der Lebzelterswitwe Stöber lohnte sich. Sie bekam Recht und setzte sich durch. Das Landgericht Kötzting wies in einem Notificationsschreiben (zur Kenntnisnahme) am 19. August 1819 den Magistrat und Stiftungsadministration Eschlkam kurz und bündig an, „von nun an das Wachs wie bisher bei der Stöber abzunehmen“.
Werner Perlinger
Als der „Cameralwald Karpfling“ im Jahr 1788 an die Eschlkamer Bürger verteilt wurde
+Eschlkam. Eine breit sich dehnende Waldfläche nördlich des Hohenbogen, seit 1972 zur Oberpfalz gehörend, trägt den Namen „Karpfling“. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um einen alten Siedlungsnamen. Dafür ist ein Blick in die Geschichte des Waldes „Karpfling“ nötig, dessen höchste Erhebung ca. 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Zu den wenigen Orten, die bereits im Hochmittelalter an den Landesherrn eine eigene Abgabe als Heeresteuer zu entrichten hatten, zählte im ehemaligen Landgerichtsbezirk von Eschlkam eine Siedlung namens „Karpfling“. Diesen ihren Namen überliefert uns seitdem nur mehr besagter Wald, gelegen südlich des Marktes Eschlkam. Im niederbayerischen Urbar (Güterverzeichnis) für den damaligen Regierungsbezirk Straubing, verfasst in den Jahren 1301 bis 1309, heißt die Siedlung „Chaepfing“. Bis zu ihrer Zerstörung im Hussitenkrieg zwischen 1420 und 1430 lag sie etwa inmitten der heutigen Waldung, wo heute noch Quellen ihren möglichen Standort markieren helfen. „Chapf, kapf“ bedeutet sprachgeschichtlich >Aussichtspunkt, runde Bergkuppe<, und dort befand sich auch die abgegangene und nicht wieder aufgebaute Siedlung, wohl an der Stelle der höchsten Erhebung in der heutigen Waldung.
Der Rohstoff „Holz“ – darum geht es im Folgenden – hatte früher, im Gegensatz zu manch heutiger Vorstellung, für die Bewohner unserer Region einen hohen wirtschaftlichen Wert. Nicht selten waren gerade im 18. Jahrhundert größere Waldungen Gegenstand von Verhandlungen, wenn es galt neue Eigentumsverhältnisse zu schaffen. Verbunden damit waren in der Regel langwierige rechtliche Auseinandersetzungen mit den staatlichen Stellen.
Wir schreiben das Jahr 1767. Am 1. Dezember wurde den Bürgern des Marktes Eschlkam in einer ausgefertigten Rentamtsresolution (Beschluss der Regierung) bewilligt, das „gemeine Markts Gehölz den Karpfling genannt“ an die einzelnen Hausbesitzer „abzutheilen“, jedoch nur insoweit, als der Marktkammer „ein zulänglicher Antheil zur Unterhaltung der Markts Gebäude reserviert“ bleibe, und zwar mindestens der achte Teil des bestehenden Waldes. Es dauerte nur zwei Jahre, da widerrief am 4. Dezember 1769 die Regierung die erteilte Erlaubnis mit dem Hinweis, dass die Waldung „Karpfling“ nicht ein der Gemeinde angehörendes „gemaint gehölz sei“, sondern „immediate (ausschließlich) ein Kammer Gut“. Unter „Kammergut“ ist zu verstehen, dass eine Sache, hier der Wald Karpfling, von der Gemeindeverwaltung nur dahingehend genutzt werden durfte, um Investitionen allein nur für den Markt zu finanzieren, wie z.B. die schon angesprochene Erhaltung bzw. Renovierung gemeindeeigener Gebäude. Die Nutzung des Kammergutes sollte somit zeitweise der Entlastung der Kommunalkasse dienen.
Ein erneutes Gesuch
Die Jahre gingen ins Land. Am 31. Dezember 1780 wendet sich der Bürger und Zimmermann Georg Limböck und „Consorten“, gemeint sind die Bürger von Eschlkam, erneut an die Regierung in Straubing um die „hochgnädige Bewilligung das Marktgehölz der Karpfling genannt, abtheillen zu dürfen“. Etliche Gründe dafür, wie vorteilhaft es sei, diese Waldung als ein dem Markt insgesamt „angehöriges Kammergut“ endlich aufzuteilen, werden in diesem mehrseitigen Schreiben angeführt. So bringen die Antragssteller u.a. vor, es könnten nach der Aufteilung an die Bürgerschaft bisherige Holzdiebstähle besser verhindert werden; auch stünde nach Feuersbrünsten für jeden Betroffenen sofort Bauholz zur Verfügung, um nur zwei von den zahlreichen Argumenten zu nennen. Am 3. Januar 1781 forderte Max, Freiherr von Verger, der Rentmeister von Straubing, damals der höchste Beamte im Regierungsbezirk Straubing, das Landgericht Kötzting als die ihm untergeordnete Behörde auf, ein Gutachten über das „Anlangen“ der Eschlkamer Bürger zu erstellen. Nahezu zwei Monate später, am 23. Februar 1781, lehnt dann die kurfürstliche Kammeralrentdeputation (damals das Rentmeisteramt) Straubing das Gesuch der Bürgerschaft erneut mit dem entscheidenden Hinweis ab, dass „dieses Gehölz undispunierlich ein (nur) dem Markte Eschlkam angehöriges Kammergut“ sei. Darüber sei unverzüglich die Bürgerschaft zu informieren, und vor allem dahingehend, dass diesbezüglich das „Holzabtheilungsgesuch für allezeit abgewiesen seyn solle“.
In 72 Lose aufgeteilt
Die Zeit verfloss, und plötzlich änderte sich die bisherige Vorstellung der Regierung zu Gunsten der Eschlkamer Bürger. 1788, am 16. Februar wurde die Marktführung beauftragt, die gesamte Bürgerschaft auf das Rathaus einzuberufen und zu fragen, „ob sie den mittlerweile auf 72 Lüst (Lose, Anteile) vertheilten Kammerwald“ kaufen wolle. Ausgenommen sei davon nur der Teil rechts von der Straße in Richtung Furth. Denn der Nutzen daraus sollte weiterhin zur Unterhaltung der Gemeindegebäude herangezogen werden. Am 28. „Hornung“ (alter Name für Februar) wurde im Rathaus im Beisein des Grenz- und Waldforstmeisters von Furth, Johann Benedikt von Sonnenburg, die Verteilung des Waldes, „parzeliert in 72 List“ (Lose), vorgenommen. Der Kaufpreis pro Teil betrug jeweils 15 Gulden sowie 20 Kreuzer an „Jahresgilt“ (Jahressteuer zugunsten der Gemeindekasse). Das darüber ausgefertigte Protokoll datiert vom 10. März 1788. Jeder hausbesitzende Bürger hatte mit dieser Aktion für seinen eigenen Bedarf günstig ein Waldgrundstück erwerben können, was eine gewünschte Mehrung des einzelnen Besitzstandes bedeutete. Um sich heutzutage eine Preisvorstellung zu machen, sei erwähnt: Für 1 Gulden musste in jener Zeit ein Zimmermann drei Tage arbeiten, ein Scheffel (222 Liter) Weizen kostete über 20 Gulden.

Bildtext: Einem unregelmäßig sich darstellenden Viereck zeigt sich im Liquidationsplan vom Jahr 1840 der Wald „Karpfling“, im Norden begrenzt von der Straße, die von Furth (im Wald) nach Eschlkam führt. Seit 1788 ist der ehemalige „Cameralwald“ in private Parzellen aufgeteilt. Die rote Linie markiert die Gemeindegrenzen Eschkams zu Schwarzenberg und Furth im Wald. Gegenüber der Straße befindet sich der zum Markt Eschlkam gehörende „Kammerholz“-Teil, seit Generationen ebenfalls privatisiert und in Wiesenland umgewandelt.
(Bildnachweis: Markt Eschlkam, Historische Karte - Bayernatlas)
Werner Perlinger
Aus der Geschichte der „Truckhen“- oder Penzenmühle
+Eschlkam. Der letzten der drei Mühlen im Bereich der Marktgemeinde, der >Penzenmühle< sei die folgende historische Betrachtung gewidmet. Wie bei der benachbarten Bäckermühle schon erwähnt liegt die Penzenmühle ebenfalls am Freibach, der aus dem Tal von Neukirchen b. Hl. Blut kommend an der Mühle vorbei bald in den Chamb mündet. Die Traditionen können genau so weit zurückverfolgt werden wie bei den anderen Mühlen.
In der schon erwähnten Steuerliste aus dem Jahr 1477 wird erstmals die „Truckenmühl“, so der alte, längst in Vergessenheit geratene Name, erwähnt. Dazu gehört ein Acker neben der Mühle vor der „Taubenwies“.
Die Bäckermühle, siehe Artikel darüber, hieß ursprünglich auch „Nassmühle“, wohl zur Unterscheidung der etwas höher und damit trocken gelegenen Penzenmühle, die im 17./18. Jahrhundert häufig „Truckenmühle“ genannt wurde. Dazu einige namentliche Einzelheiten:
- 1659 auf der Palbersdorfermill;
- 1686 Druckhen, oder anietzo Lährnbecher Mihl;
- 1688 Truckhenmüll...Druckhen Mihl;
- 1694 Pentzlkhoverische Mill;
- 1695 Hannsen Pentzkhover Millern uf der Truckhenmill;
- 1739 auf der Penzkhofermihl;
- 1747 Penzenmill;
- 1780 Andrae Penzkofer Mühler auf der Truckenmihl;
- 1840 Pratzmühle, Penzenmühle.
Das Bestimmungswort des Erstbelegs gehört zum Familiennamen Balbersdorfer; dieser zum Ort Balbersdorf. Die Bezeichnung >Truckenmühle< (mundartlich „drucka“ für trocken steht im Gegensatz zum Namen Nassmühle - Bäckermühle). Nicht behaupten konnte sich der Name Pratzmühle (zu mundartlich „brods“ für Frosch). Seit 1694 erscheint der Familienname Penzkofer als Bestandteil des Mühlennamens wobei „Penz/Benz“ dazu eine Kurzform darstellt.
Mühle mit drei Gängen
Ein Blick zurück: Im Jahr 1682 kauft Hans Lärnpecher, Müller in Eschlkam, von Wolf Tenzl, Marktschreiber, die „Truckhenmill“ im Wert von 1400 f (Gulden). Wenig später, 1687, am 30. September, erwirbt Barthlmä Solfrank, derzeit Stiftsmüller in Rügelsdorf, Graf Parzendorffische Herrschaft (Böhmen), die „Truckhenmüll“ von Hans Lährenbecher mit dem vorhanden gewesenen „Millwerchzeig“ um 900 f. Die Familie Lärnbecher wechselt dann auf die Bäckermühle. Die Mühle besitzt bereits „3 Gänge“ (Mahlwerke). Ein Jahr später, am 17. Dezember 1688, wird aber festgestellt, dass die Mühle „paufellig und abgeschlaift“ ist. Von der Marktführung wird eine Reparatur angemahnt.
Im Jahr 1692 tritt am 12. November erstmals der Name >Penzkofer“ auf, als Margarethe, viddua relicta (hinterlassene Witwe) des Bartholomee Sollfrangg, molitor (Müller) in Eschlkam und Johann Penzkover, molitor (Müller) von Thal bei Traitsching die Ehe eingehen. 1706 heiratet Penzkover Johann, Witwer ein zweites Mal Anna Maria Weber vom Schicherhof. Im gleichen Jahr wird Hans Penzkofer auf der „Truckenmühl“ in einer Steuerliste genannt.
1738 heiratet Johann Preu von der „Pflaumermühle“ die Witwe Anna Maria Penzkofer und erwirbt so die Mühle mit allem Zubehöhr im geschätzten Wert von 2000 f. Am 31. Juli 1743 heiraten Caspar Penzkofer und Anna Maria Maurer, Tochter des „Hoamaters“ Johann Maurer von Nr. 3. Beide übernehmen von Hans Preu, Stiefvater des Penzkofer, das Mühlenanwesen. Der Müller Caspar stirbt am 13. März 1759 und ein Jahr später, 1760, heiraten am 1. Juni Georg Wüntter (Winter), Sohn des Müllers Paulus Wüntter von Lehrau, Grafschaft Leuchtenberg, und die Witwe Anna Maria Penzkofer. Dieser Hans Georg Wüntter, „Burger und Miller“ hat die Hans Preu’sche, vormals Bärthlme Sollfrank’sche Mühle mit 3 Mahlgängen, einer Schneidsäge und einen „Getreid-Kasten“ sowie mit den Feld- und Wiesengründen im Gesamtwert von 2236 f „sich käufflichen eingethan“, so der Protokollinhalt.
Erfolgreich gewirtschaftet
Die Jahre gingen ins Land. Winter hat ordentlich und erfolgreich gewirtschaftet und im Jahr 1773, am 26. Mai übergeben Hans Georg Wüntter, Müller, u. Anna Maria die auf 2600 Gulden geschätzte „Truckmühl“ mit Gründen, die er bereits am 28. März 1759 infolge Inventur an sich gebracht hat, ihrem eheleiblichen und seinem (Winter) Stiefsohn Andrä Penzkofer. Dieser heiratet Anna Maria, Tochter von Johann Georg Hastreiter, Bürgermeister und Weißbäcker von Hsnr. 19/Further Straße 4 u. 6. Erwähnenswert ist, dass von 1781 bis 1885 die jeweiligen Müller den Vornamen >Andreas< tragen.
Im Jahr 1786 darf Andre Penzkofer einen „Lein-“ oder „Leißgang“ im Mühwerk errichten, wohl für die Produktion des damals gefragten Leinöls. 1811 wird das Mühlenanwesen als „gemauert“ aufgeführt. Im Jahr 1828 zählt der Viehbestand des Müllers 2 Pferde, 1 Fohlen, 2 Stiere, 4 Kühe, 4 Jungrinder, 1 Sau. Im Kataster von 1840 verfügt die Mühle über „3 Mahlgänge und Säge mit 1 Gang“.
1851, am 4. November übernimmt wiederum ein Andrä Penzkofer (geb. 29. Jänner 1817) das elterliche Anwesen von Mutter Anna Maria Penzkofer im Wert von 7000 f. Ihm folgen 1885 Georg Penzkofer, geb. 1865, und Maria, geb. Späth. 1908 wird eine neue Schneidsäge gebaut. Am 8. Oktober 1929 übernehmen Josef Penzkofer, geb. 1906, und Maria, geb. Weber von Hinterbuchberg die sog. „Penzenmühle“. 1967 folgen Ferdinand Penzkofer und Ehefrau Marianne. Derzeit ist die Anlage im Besitz von Josef und Bettina Penzkofer.
Werner Perlinger
Überprüfung der Maße und Gewichte im Markte Eschlkam
+Eschlkam. „Maß und Gewicht kommen vor Gottes Gericht“, dieser alte Spruch, eher ein Leitsatz, ist heutzutage fast nicht mehr bekannt. Doch hatte er früher eine hohe Bedeutung. Er spricht eine Warnung aus gegen diejenigen, welche ihre Gewichte und Maße beim täglichen Handelsverkehr zu ihren Gunsten abändern und somit fälschen, was aber für den Erwerber einer Ware einen erheblichen Nachteil darstellt, den er auf Anhieb nicht erkennen konnte. Daher wurden diese Gerätschaften immer wieder in regelmäßigen Abständen amtlich „geeicht“.
Der Begriff „Eichung“, sprachlich abstammend von dem mittelhochdeutschen Wort „ichen“ für „abmessen“, das auf lat. „aequus“ für „eben, gleich“ zurückgeht, ist die schon seit frühen Zeiten vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfung der Messgeräte auf Einhaltung der zugrundeliegenden eichrechtlichen Vorschriften. In deutschen Landen ist die Eichung nach dem Eichgesetz eine hoheitliche Aufgabe. Mit einem „Eichzeichen“ wird immerhin die voraussichtliche Einhaltung für die Gültigkeitsdauer der Eichung bestätigt.
Diese Eichzeichen wurden seit jeher und werden im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfung von Waagen, Gewichtsstücken und Maßeinheiten verwendet, um das erfolgreiche Bestehen der Eichung zu dokumentieren. Dazu wurden in der Vergangenheit sehr verschiedene Symbole, wie Buchstaben, Zahlen oder Graphiken benutzt, um auf dem zu überprüfenden Stück unmittelbar den Eichvorgang zu dokumentieren. Auf Gegenständen aus Metall (Gewichte, Waagen) erfolgte dies zumeist durch Schlagstempel, auf Holz (Maße) auch durch Brandstempel. Die Eichung erfolgte dabei teilweise direkt auf dem Gewichtsstück oder Maß selbst, oder auf einem zusätzlich angebrachten Pfropfen o. ä. aus Blei oder Kupfer. Diese Prüfungen übernahmen sog. Eichmeister. Bei diesem Titel fällt uns ein der Film „Das falsche Gewicht“ des gleichnamigen Romans von Joseph Roth aus dem Jahr 1971 mit dem Charakterdarsteller Helmut Qualtinger in der Hauptrolle.
Im Marktarchiv finden sich nicht wenige Unterlagen aus dem 19. Jahrhundert, die meist betitelt sind wie: „Die vorgenommeine Beschau der Lebensmittel und Maße und Gewichte Visitation betr. pro Quartal“ oder „die gepflogene Viktualien (Lebensmittel) Visitationen“.
Im Jahr 1845 – und das sei anfänglich erwähnt - wurde im Oktober der ansässige Seifensieder Georg Schreiner einer Prüfung unterzogen. Seine zum Verkauf angebotenen Kerzen und Seifen wurden als „untadelhaft“ gewertet. Bei den die täglichen Lebensmittel erzeugenden Handwerkern wie den Bäckern und Metzgern fanden diese Prüfungen meist sogar monatlich statt. So erfahren wir beispielsweise über die „Vornahme der Beschau“ vom 9. April 1846: „So wurden unter vorausstehendem Datum die Bäckerläden der alhiesigen 4 Bäcker abgegangen, um sich (des) tarifmäßigen Brotes zu überzeugen, nachdem dieser voraus bekannt gemacht und angeschlagen wurde. Mit Beiziehung nachbenannter Sachverständigen bei den allhiesigen 4 Bäckern Franz Rötzer, Nr. 19/Further Straße 4 und 6; Georg Hastreiter, Nr. 23/Marktstraße 2; Andrä Plötz, Nr. 58/ Blumengasse 2 und Josef Lemberger, Nr. 37/38/Marktstraße 11 war der Befund des Weiß- und Roggengebäcks tarifmäßig gut ausgebackenes Brod, Mehl keineswegs stinkend, geschmackhaft, rein und weiß“.
Bei den bräuenden Bürgern Anton Riederer, Josef Lemberger, Anton Baumann, Josef Schöppl, Josef Späth und Josef Neumeier wurde das auszuschenkende Bier als „gehaltvoll, gesund, rein und pfenningvergeltlich (sein Geld wert)“ beurteilt. Das jeweilige Trinkgeschirr war „maßhaltig“, war also geeicht. Es waren dies Mitglieder des Kommunebrauverbandes, die gerade in diesem Jahr öffentliche Wirtshäuser betrieben. Der „Brantwein“ wurde als „unfußlich“ (genießbar) eingeschätzt. Als rein galt auch der Essig.
Bei den zwei Krämern im Markte, Georg Schreiner, Nr. 60/Marktstraße 15 und Karl Müller, Nr. 25/Waldschmidtplatz 8 wurde die Elle (eine Maßeinheit beispielsweise zum Abmessen von Textilien) als „unfehlerhaft“ erkannt und der angebotene Käse als „unverdorben“. Bei den drei Metzgern wie Joseph Schöppel, Nr. 34/Marktstraße 5; Anton Riederer, Nr. 61Großaigner Straße 1 und Joseph Späth, Nr. 5/ Further Straße 3 fanden die Prüfer nur „frisches, gesundes und nahrhaftes Fleisch vor. Auch waren die zum Verkaufe benützten Gewichte „in richtigem Stande“. Sie waren also ordentlich geeicht.
Die Bilanz erwies sich demnach positiv und als Bestätigung der vorgefundenen Situation, die angebotenen Lebensmittel betreffend, unterschrieben das eigens jeweils angefertigte Protokoll die prüfenden Bürger Alois Schmirl, Schuhmacher, Nr. 41/Blumengasse 5 und Michael Meidinger, Schneider, Nr. 32/Waldschmidtplatz 1. Amtlich bekräftigt wurde die detaillierte Niederschrift noch durch die Unterschrift von Bürgermeister Sämmer, Nr. 44/Kleinaigner Straße 25 und den Magistratsräten Mathias Späth, Nr. 35/Marktstraße 7 und Anton Korherr, entweder von Nr. 11/Kleiaigner Straße 9 oder von Nr. 71/Großaigner Straße 2.
Bei Bewertung der ganzen Angelegenheit sei jedoch angemerkt, dass es sich bei den prüfenden Personen um Marktbürger und nicht um auswärtige Beamte handelte, wobei eigentlich Prüfer und Geprüfte sich bestens kannten. Die eine für solche Amtsausübung geforderte Unbefangenheit war somit nicht gegeben. Ob bei dieser Lage die von Amts wegen grundsätzlich geforderte absolute Objektivität jeweils gegeben war, sei dahin gestellt.
Werner Perlinger
Aus einer alten Feuerordnung des Marktes
+Eschlkam. Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Eschlkam wurde am 25. März 1870 im Gasthaus des Wenzl Späth (Hsnr. 5/Further Straße 3) gegründet. Seitdem hat sich diese Wehr im Laufe der Jahre in vielen Einsätzen bewährt und besitzt heute neben anderen Organisationen im Markt gesellschaftlich einen hohen Stellenwert. Auf die Geschichte dieser jüngeren Zeit, in verschiedenen Dokumentationen bereits genugsam erörtert, soll nicht eingegangen werden, sondern auf die Zeit vorher, als es die herkömmlichen FFWs noch nicht gab. Die Schadensfeuer, häufig bei Kriegsereignissen, aber auch aus purer Unachtsamkeit entstanden, waren gefürchtet. Zerstörten sie doch oft den ganzen Besitz unserer Vorfahren und manchmal auch deren Leben.
Aus dem Jahr 1847, also lange vor der Gründung der FFW, datiert ein Akt erhalten mit dem Titel „Feuerordnung“. In ihm werden Bestimmungen einer Feuerordnung vom 20. März 1791 erneuert und diese wurde im Auftrag der damaligen Regierung in allen Kommunen öffentlich bekannt gemacht:
So war es nicht erlaubt, für die Leinenherstellung Flachs und Hanf im eigenen Haus in den Öfen und Stuben zu dörren, zu brechen, zu schwingen und zu fächeln. Dafür waren in jeder Gemeinde wegen der Feuersgefahr abseits der Wohnsiedlung ein oder mehrere Brechhäuser eingerichtet. Zweimal pro Jahr seien in allen Häusern die Feuerstätten im Rahmen einer „Feuerschau“ von der Lokalpolizei zu besichtigen. Auch soll jedes Haus mit einer, „das Licht wohl verwahrenden Laterne versehen sein“. Es folgt in der Auflistung ein totales Rauchverbot in den Mühlen, Scheunen und Städeln. Eindringlich gewarnt wird von der Einbringung feuchten Getreides, Heu und „Grumet“ wegen deren möglicher Selbstentzündung.
Bei diesen Ausführungen nutzte die Regierung die Gelegenheit die strafrechtlich geltenden Bestimmungen hinsichtlich des Verbrechens der vorsätzlichen Brandlegung den Bürgern nochmals nahezubringen. Diese Gesetze mussten in Eschlkam an drei aufeinander folgenden Sonn- und Feiertagen zur Kenntnisnahme öffentlich ausgelegt werden.
Dazu sei vorweg erläutert: 1805 erteilte Max I. Joseph, seit 1806 der erste König in Bayern, dem in Landshut tätigen Rechtsprofessor Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach den Auftrag, das bestehende Strafrecht einer grundlegenden Revision zu unterziehen. Bis dahin galt in Bayern noch der Codex Iuris Criminalis Bavarici des Wirklichen Geheimen Kanzlers Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayr aus dem Jahr 1751, so dass die hier erwähnten Ausführungen von 1791 noch auf den juristischen Vorstellungen Kreittmayrs fußen.
Drakonische Strafen
Daraus ist im Akt eigens Artikel 248 angeführt. Er beinhaltet, dass bei vorsätzlicher Brandlegung „an Gebäuden, wo Menschen wohnen, wie in Städten, Flecken und Dörfern, oder nur an einsam stehenden, jedoch bewohnten menschlichen Aufenthaltsorten, der Missethäter die Strafe des Todes zu erleiden hatte (damals vollzogen durch Enthauptung), (nämlich) wenn ein Mensch durch das Feuer um das Leben kam, oder lebensgefährlich beschädigt worden ist“. Die gleiche Strafe galt, wenn ein Brand gelegt wurde, sofern „unter dessen Begünstigung Mord, Raub, Diebstahl oder andere schwere Verbrechen von dem Brandleger selbst oder von anderen begangen worden sind“.
Eine mindere Strafe, die damals übliche „Kettenstrafe“ wurde verhängt, wenn die Folgen der Brandlegung nicht wie vorher aufgeführt als erschwerend beurteilt werden konnten. Diese war eine im 17., 18. und noch im 19. Jahrhundert verbreitete Art der Freiheitsstrafe für besonders schwere Verbrechen. Sie bestand darin, dass der Verurteilte mit einer eisernen Kette an die Wand der Gefängniszelle angeschlossen, oder dass er durch eine an seine Füße gelegte schwere Kette in seiner Bewegungsfreiheit gehemmt wurde. So wurde beispielsweise der Räuber Michael Heigl im Jahr 1857 im Münchner Gefängnis Stadelheim mit der Kugel einer Fußkette von einem Mithäftling erschlagen (siehe dazu den Bericht Nummer 4). Erst am 19. November 1867 wurde die damals so bezeichnete „Eisenstrafe“ gesetzlich abgeschafft.
Zuchthaus oder Arbeitshaus
Bei weiterer „minderer Strafbarkeit“ erwartete den Täter das Zuchthaus. Setzte ein Täter Waldungen oder noch nicht abgeerntete Felder in Brand, ohne dass dabei eine Gefahr für Menschen bestand, hatte er dennoch mit acht oder gar 12 Jahren Zuchthaus zu rechnen. Hart bestraft wurde, wer sein „Eigentum mit Gefahr für die Bewohner desselben im rechtswidrigen Vorsatze anzündet. Er soll jedem anderen Brandstifter nach Unterschied der Fälle gleich bestraft werden“. Geregelt war damals auch schon die Ahndung von Brandlegungen in Betrugsabsicht, um so an das Geld in den „Brandkassen zu gelangen“. Heute würden wir es als Versicherungsbetrug werten. Wenn der Täter „durch Reue bewogen“ versuchte den von ihm gelegten Brand zu verhindern, drohten ihm als Strafe dennoch das Gefängnis oder das Arbeitshaus.
Bei der oben erwähnten zweimalig vorgenommenen „Feuerschau“ war in den Markthäusern bisher der Maurermeister von Furth beigezogen. Er erhielt dafür aus der „Communalkasse“ als „Ganggeld“ (Spesen) 1 Gulden. Um eben Unbefangenheit bzw. Neutralität gerade bei diesem Vorgehen gegenüber den Bürgern zu gewährleisten, hatte man diesen Weg gewählt und für diese Aufgabe den Further Stadtmaurermeister bestimmt. Gegen den Mann aus Furth protestierten jedoch die Bürger. Schließlich wurde am 25. Dezember 1847 der Frieden im Markte mit Einschaltung des Landgerichts wieder hergestellt mit dem Hinweis, „da kein besonderer Grund besteht einen auswärtigen Sachverständigen zu adhibieren (beizuziehen), erwartet man vom Magistrate, entweder den Zimmermeister Obermeier oder Maurermeister Wilhelm dahier künftig bei diesem Geschäfte zu verwenden“. Da Wilhelm sich um diese Aufgabe besonders bemühte, erhielt er den Auftrag der künftigen Feuerbeschau im Markte. Und dabei blieb es schließlich.
Werner Perlinger
Aus der Geschichte der Bäckermühle
+Eschlkam. Die „Bäckermühle“ liegt wie die nahe gelegene Penzenmühle am Freibach. Die Traditionen können genau so weit zurückverfolgt werden wie die der beiden anderen Mühlen. So wird in einer Steuerliste aus dem Jahr 1477 ein „Eschlkamer oder Jorg Mullner“ (beide Namen meinen ein und dieselbe Person) von der Mühle unter dem Markt am Freibach erwähnt. Die Bäckermühle hieß ursprünglich auch „Nassmühle“, wohl zur Unterscheidung der etwas höher und damit trocken gelegenen Penzenmühle, die im 17./18. Jahrhundert meist „Truckenmühle“ genannt wird. Bekannt ist auch, dass die „Nassmühle“ wegen ihrer niedrigen Lage am Freibach häufig von Hochwassern heimgesucht wurde. In der ersten Silbe, dem Bestimmungswort bei „Bäckermühle“ erscheint der Familienname „Beck“, der in Eschlkam im Jahr 1653 als „Pökh“ bezeugt ist. Von seiner sprachlichen Herkunft her weist er auf den Beruf des Bäckers.
1687 verkauft der Müller Hans Lährnbecher seine „Truckhenmühl“ an den Müller Barthlmä Solfrank und erwirbt im Jahr darauf, am 27. Januar 1688, das „Wolf Tenzl‘sche Guett im Markt allda“, das „Haimeter“-Anwesen Nr. 3/Waldschmidtstraße 8. 1695 ist als „Stiftmüller“ (Pächter) auf der „Peckhenmihl“ ein Wolf Cramer überliefert; ebenso 1698 ein Antoni Aumayr auf der „Peckhenmihl“. Für 1200 f (Gulden) Aufschlag tauscht im Jahr 1700 Wolf Sighardt Altmann, damals lange schon Inhaber des heutigen Gasthofes Penzkofer, seine in den Vorjahren „aigenthümlich inngehabte Mühle“, nämlich die Bäckermühle, mit Hansen Lährnbechers bürgerlicher Wirtsbehausung. Das ist der vorhin genannte „Haimeterhof“ (heute Anwesen Pfeffer).
Auf 2800 Gulden geschätzt
Im Besitz der Familie Lährnbecher verbleibt die Mühle dann längere Zeit und erst 1747 übergibt die Müllerswitwe Maria Lährnbecher das Anwesen mit den dazu gehörenden Gründen im Wert von 1745 Gulden unter der Beistandsleistung des benachbarten Müllers Caspar Penzkofer an ihren Schwiegersohn Wolfgang Schmaus. Dieser hatte die Tochter Catharina geheiratet. Jahrzehnte später, 1795, am 24. Februar übernimmt der Bäckersohn Anton Hastreiter von Hsnr. 58/ Blumengasse 2 als angehender Müller mit seiner Braut Walburga Schmauß, „Böckenmüllerstochter“ die Mühle. Der Gesamtwert der Anlage wurde nun auf 2800 f geschätzt. Aus dieser Übernahme seien einzelne Inhalte dem Leser unterbreitet:
Franz Schmauß, Müller auf der Bäckenmühle, und seine Frau Cäcilie wollen übergeben. Jedoch kann er wegen seiner „großen Unbesslichkeit“ (krankheitsbedingter Zustand) nicht erscheinen und so lässt er sich von seinem Schwager Franz Leitermann, „bürgerlicher Haimeter“ (Waldschmidtstraße 10) und von Jakob Späth, auch „bürgerlicher Haimeter“ (Waldschmidtstraße 6), notariell vertreten. Er übergibt demnach seine am 18. April 1769 „an sich gebrachte rechterhand der Landstraßen unweit entlegene Mühl“ mit allen vorhandenen Feld- und Wiesengründen und dem sonstigen Zubehör mit der „Dreingab 2-er Ochsen und 2 Kueh“ und den drei Waldanteilen im Karpfling, erworben am 2. Dezember 1788, an seine eheleibliche noch ledige Tochter Walburga und ihren künftigen Ehemann Antoni Hastreiter, bürgerlicher Bäckerssohn.
Eigens wurden Vorkehrungen getroffen für die noch vorhandenen vier unmündigen Geschwister der jungen Müllerin. Es waren dies Barbara 13, Theresia 10, Johannes 8 und Apollonia 6 Jahre alt. Auszahlungsmodalitäten sind im Vertrag genau geregelt wie ebenso der Umstand, sollte die Mutter Cäcilie „mit Tod abgegangen sein“, jedes der Kinder bis zum Alter von 15 Jahren „bei der Mühl mit Kost erhalten“ bleiben könne. Demnach wurde bis zu einem möglichen Berufseinstieg der Kinder Vorsorge getroffen, damit sie nicht vorher „ihr Elternhaus verlören“.
In einem gleichzeitig aufgesetzten „Ausnahmsbrief“ wurden für die Mutter Cäcilie die zum Lebensunterhalt künftigen Leistungen festgelegt, wie u.a. die „freie und unvertriebene (unbeeinträchtigte) Wohnung auf der ordinari Wohnstuben“. Sollte sie dort dennoch nicht verbleiben können (vielleicht wegen der Schwiegertochter), so müssten ihr für die Anmietung einer „anderen Hörberg, wohin sie auch die Kinder zu bringen hat, jährlich 6 Gulden verreicht werden“. Auch seien ihr „2 Pifang (ein Bifang ist der Ackerstreifen zwischen zwei Furchen) auf Erdäpfl und 2 Pifang auf Kraut“ zu gewähren. Selbstverständlich mussten die Übernehmer jährlich der Mutter zum Lebensunterhalt „an sauber gebutzt kastenmäßigen (reinen und trockenen) Gut liefern: 2 Ell Weitzen, 7 Ell Korn, 1 Ell Gerste und 1 Ell Haber“ und letztlich auch das nötige Brennholz für eine warme Stube in der kalten Jahreszeit. Das „Ell“ ist ein altes Getreidemaß und entsprach ½ Scheffel (= 111Liter, oder ca. 1,5 Zentner)
1828 werden in einer Viehstandsmeldung bei der Bäckermühle zwei Pferde, drei Kühe und zwei Kälber aufgelistet. 1862 wird als neuer Besitzer Wendelin Baumann genannt. Er stammte von Oberdörfl (geb. 1826) und war seit 1857 mit Anna Maria Gotz von Rimbach verheiratet. Im Jahr 1881 übernehmen der gelernte Müller Alois Utz aus Schwarzenberg und seine Frau Catharina, geb. Adam von Großaign, die Bäckermühle. Ca. 1965 wird der Mühlenbetrieb stillgelegt. Im Besitz der Familie Utz befindet sich das Anwesen noch heute.
Werner Perlinger
Als Eschlkam noch einen geräumigen „Marktplatz“ hatte
+Eschlkam. Die folgenden Ausführungen befassen sich mit den über längere Zeit hinweg baulichen Veränderungen des Marktplatzes, heute der Waldschmidtplatz, was seine einstige und seit neuerer Zeit nun jetzige Ausdehnung betrifft. Schließlich war dieser innerhalb der Bergsiedlung zentral gelegene Platz der bedeutende Ort, wo sich die wirtschaftlichen Abläufe entwickelten, die der Siedlung schon in hochmittelalterlicher Zeit den Status eines Marktes gaben. Dazu folgende Erläuterung:
Eschlkam war nach dem Absterben der Markgrafen von Cham im Jahre 1204 zunächst ein Amtssitz mit Gerichtshoheit der wittelsbachischen Herzöge geworden (erwähnt im 1. Steuerbuch, angelegt zwischen 1231-1234) und so der eigentliche administrative Zentralort im Hohenbogen-Winkel, ein Gebiet, das sich vom Bereich Dalking-Zelz-Weiding-Faustendorf-Ränkam über Furth bis nach Neukirchen erstreckte. Im frühen 13. Jahrhundert dürften in Eschlkam auch die Anfänge der Pfarrwerdung einsetzen.
Eschlkam, nun Sitz eines (Land)gerichts wird dann im 1. niederbayerischen Urbar (Steuerbuch) für das Vitztumamt Straubing (Amt des Herzogsstellvertreters), verfasst in den Jahren 1301-1309, erstmals als „Markt“ aufgeführt. Die ursprüngliche Marktrechtsurkunde, deren Ausstellung wir historischen Gegebenheiten gemäß getrost in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datieren dürfen, ist verschollen. Die Marktkommune durfte einst jede Woche einen Markttag abhalten und war frei von Zollabgaben. Dazu gehörte auch die Abhaltung von wahrscheinlich drei Jahrmärkten, deren Tage festgelegt waren.
Eine für Eschlkam ökonomisch negative Wirkung hatte sicherlich die herzogliche Regelung, wenn es 1332 in der Stadtrechtsurkunde von Furth heißt: „es soll auch ze Eschlkamb khain Markth sein dann alle Sontag sol man vor der Khirchen di weil man singt, (nur) hin gebn flaysch und prot, sunst sol man anders da niht hin geben oder verkhauffen“.Mit der bewussten Schmälerung der bereits gut 100 Jahre vorgegebenen Marktsituation in Eschlkam wollten die Herzöge die Stadt Furth wirtschaftlich fördern und damit eine Wachstumsgrundlage für die neue urbane Siedlung schaffen. Aber mit Förderung der Stadt Furth wurde im ersten Drittel des 14. Jh. die politisch-ökonomische Bedeutung des Marktes Eschlkam entscheidend geschwächt. Andererseits aber blieb Eschlkam noch bis 1429 Sitz des Landgerichts.
Nach den Hussitenkriegen und den sich unmittelbar anschließenden Fehden zwischen dem bayerischen und böhmischen Grenzadel, die schwerste Verwüstungen der Infrastruktur zur Folge hatten, begann erst in den Jahren nach 1452 der Wiederaufbau der Marktsiedlung von Eschlkam. Damit entstand zunächst auch wieder das Terrain von Kirchen- und Marktbereich wie in der Zeit vorher. In einem „Begnadungsschreiben“ vom 7. März 1572, in der Regierungszeit von Herzog Albrecht V. von Bayern-München, wurde dazu noch ein Jahrmarkt, der sog. Jakobimarkt gestattet, abzuhalten jeweils am Sonntag vor Jakobi.
Die Kirchenburg zerstört
Schwere Einbußen in baulicher Hinsicht brachte mit sich der Schwedenkrieg. Der Ort und seine Wehranlage, die Kirchenburg, wurden 1634 niedergebrannt und der Pflegersitz nach Neukirchen b. Hl. Blut verlegt. Die Anlage blieb lange Zeit ruinös stehen. Sie wurde nicht mehr aufgebaut, später aus dringenden Bedarfsgründen sogar gänzlich abgerissen und zum heutigen Friedhofsteil südlich des Gotteshauses umgestaltet. Innerhalb dieser Anlage aber, deren Ruine uns anschaulich der Kupferstich von Michael Wening noch im Jahr 1726 überliefert, wohnten bis zur baulichen Zerstörung allein schon aus Sicherheitsgründen seit jeher neben dem Pfleger auch die einzelnen Ortspfarrer. Nun konnte kein Pfarrer mehr dort wohnen, er brauchte eine neue Herberge.
Bis zum Wiederaufbau des Pfarrhofes so wie wir ihn heute kennen und er uns seitdem baulich überliefert ist, wohnten die einzelnen Pfarrer nachgewiesenermaßen etwa ab 1634 bis 1679 in Anwesen Nr. 36/Markstraße 9. In diesem Jahr kaufte der Bürger Hans Hauser, Weißbäcker, „des Gottshaus oder Pfarrers Behausung, so (in Wirklicheit) ein Burgersgut ist“ um 230 Gulden. Ab 1679 war der neue Pfarrhof bezugsfertig, so dass das seit 1634 dienende Ausweichquartier wieder in bürgerliche Hände kam.
Pfarrhof außerhalb der Kirchenburg
Der neue Pfarrhof mit seinen dazu gehörenden Ökonomiegebäuden musste nahe der Kirche situiert sein. Die Platzfrage stellte wohl ein Problem dar. Der nun neu entstandene Pfarrhof mit Ökonomiegebäuden konnte aus Platzgründen nicht mehr an alter Stelle innerhalb der ehemaligen Kirchenburganlage stehen, sondern er wurde wohl nach Einigung mit der Marktführung und der Bürgerschaft auf dem Gelände des für die einzelnen Märkte seit jeher ausgewiesenen „Marktplatzes“ angelegt wo er sich heute noch unverrückt befindet. Nachdem ein bedeutendes Marktgeschehen offenbar nicht mehr gegeben war, „opferten“ die Bürger ihren Platz für einen neuen Pfarrhof. Dazu kam noch eine Umfriedung für den Bereich der landwirtschaftlichen Gebäude. Mit diesem baulichen Einschnitt aber verlor der Markt im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts ortsbaulich einen wichtigen Bereich, nämlich die ehedem seit dem Mittelalter in teils rechteckiger Form bestehende breite Fläche eines Marktplatzes für die Abhaltung größerer Märkte wie er ähnlich heute noch in Cham erkennbar ist.
1967 ließ Pfarrer Johann Fischer, nachdem die pfarrliche Ökonomie schon einige Zeit eingestellt war, die landwirtschaftlichen Gebäude abreißen. Dabei wurde der Bereich des Pfarrhofgeländes nach Osten etwa um eine Hauslänge zurückgesetzt und später, 1999, im Zuge des Städtebauprogramms die heutige den Besucher einladende zentrale Platzsituation geschaffen. Das so abgezweigte Gelände gehört aber nach wie vor der Kirche. Die Marktgemeinde zahlt dafür einen Pachtzins. Immerhin war so wenigstens ein Teil des ehemaligen geräumigen Marktplatzes nun wieder hergestellt.

Bildtext: Im Plan der Erstvermessung von 1831 nimmt innerhalb des ehemaligen Marktplatzes aus mittelalterlicher Zeit der Pfarrhofkomplex einen breiten Raum ein.
Das Pfarrhaus trägt die Nr. 26/Flurn. 117.
Die Anwesen mit den Nr. 27, 30, 31 und 32 wurden im ehemaligen Bereich des breiten und für eine künftige Bebauung verfüllten Schlossgrabens gebaut. Die westliche Grenze des Pfarrhofbereichs bildete mit der Westkante des Hauses Nr. 30 (Rueschhaus) eine Linie. Nach dem Abbruch der Ökonomiegebäude wurde diese Linie um eine ganze Hauslänge zurückgesetzt und so das jetzige Ensemble „Waldschmidtplatz“ geschaffen.
Die Anwesen südlich des Rathauses (Nr. 33) mit den Nr. 22, 23 und 24 bildeten in Hanglage zusammen mit der Nr. 25, den heutigen „Bals’nbäck“, einst den „Paimblhof“, eine größere Hofanlage, die noch in der zweiten Hälfte des 17. Jh. in die genannten Nummern aufgeteilt wurde
(Bildnachweis: Markt Eschlkam, Ausschnitt aus dem Urplan - Bayernatlas)Werner Perlinger
Heiratsverträge dienten der gegenseitigen wirtschaftlichen Absicherung
+Eschlkam. Aus der Geschichte der Heuhofer Mühle:
Die sog. Heuhofer Mühle liegt im Gegensatz zur Penzen- oder Bäckermühle nicht am Freibach, sondern am Chamb. Dieser bildet zugleich die Gemarkungsgrenze zwischen dem Markt und dem Dorfe Großaign. Die Mühle selbst erscheint wie die beiden anderen bereits im Jahr 1477 in der bisher für unsere Region frühest bekannten Steuerliste für die einzelnen Anwesen. Demnach besaß damals ein „Andre Schreck einen Kasten (wohl ein größeres gezimmertes Gebäude), darinn er ein Mül aufgericht hat am Kamp unttern Perg“. Eine vorherige ähnliche Einrichtung dürfte infolge der Hussitenkriege (1420-1433) lange schon abgegangen sein. Über 100 Jahre später, 1585, übergibt Margarethe Hayhoferin ihre „Müll“ an ihren Sohn. Dessen Name ist nicht genannt. Dieser sog. Herkunftsname bezieht sich auf das ehemalige deutsche Dorf Heuhof, gelegen gegenüber Jägershof jenseits der Grenze, heute Sruby. Die Siedlung Heuhof wurde im Auftrag des bayerischen Herzogs von dem damaligen Grenzhauptmann der Stadt Furth, Jörg Pfeil, im Jahr 1535 wieder angelegt. Die Familie Heuhofer scheint längere Zeit im Besitz der Mühle gewesen sein, denn ihr Name hat sich bis heute fast an die 500 Jahre als sog. Hausname erhalten, was an und für sich selten ist; aber in ähnlicher Weise auch für die beiden anderen Mühlen des Marktes zutrifft.
In zeitlicher Folge wechseln die einzelnen Besitzer der Mühle am Chamb. Es erscheinen die Namen Hastreiter, Aumayr, Cramer (Müllerfamilie von Kleinaign) und Perr (Beer oder Bär). Am 8. Oktober 1728 erwirbt Joseph Müller (geschrieben als „Müllner“) aus Stein, Pfarrei Viechtach, durch Heirat der Tochter des Mathes Perr die Mühle. In zweiter Ehe nimmt er im Jahr 1747 als „Wittiber und burgerlicher Müller auf der Heuhofermühl“ Barbara, die Tochter des Andre Hastreiter, „Pauren zu Grossaigen“, zur Frau. Von dem im Januar gleichen Jahres geschlossenen Heiratsvertrag, sollen Inhalte auszugsweise veröffentlicht werden, da sie für die damalige Zeit beispielgebend waren.
der „gleichmessiger Eheconsorte“
Demnach verspricht die „nunmahlige Ehegattin ihrem gleichmessigen Eheconsorten Josephen Müllner 300 Gulden in paaren Gelt und nebst einer standesmessigen Ausferttigung (wohl die Mobilien im Kammerwagen) 2 Kue und 1 Kalmb zu einem Heuratsguett zuzubringen“. Den doch hohen Geldbetrag verspricht die Braut in die Ehe erst einzubringen, „so baldt ihr noch lediger Bruder Hans Georg seines Vatters guett übernommen hat“. Damals kosteten beispielsweise ein Scheffel (222 Liter) Weizen 24 Gulden und ein kleiner Laib Brot 5 Kreuzer (60 Kreuzer zählten 1 Gulden). Der Taglohn eines Zimmermanns betrug z. B. 20 Kreuzer oder 1/3 Gulden. Die Kaufkraft eines 1 Gulden darf man um 1750 etwa mit 15 bis 20 Euro von heute gleichsetzen.
Dagegen leistet zur „billichmessigen Vergleichung“ zu den 300 Gulden der Ehemann Müller 600 Gulden „nebst der vorhandenen freyaigenthumblichen…in alhiesigen Purgfriedt liegent sogenante Heuhoffermühl sambt all darbey vorhandtenen Todt, und lebendigen Haus- und Paumanns-Vahrnuss (sämtliche vorhandenen Gerätschaften)“ als Sicherheit bei. Denn würde er ohne „Leibes Erben“ sterben, so sollte ihr das in diesem Vertrag beschriebene Vermögen „pro Hypotheka verbleiben“ (hypothekarisch abgesichert), nämlich die von ihr beigebrachten 300 Gulden „und mit der Widerlag 600: in allem aber 900 Gulden sowie zwei Kühe und ein Kalb zur „völligen Contentiren“ (Befriedigung).
Würde aber seine Frau vor ihm sterben, wurde ausbedungen, dass „ein mehrers nit, dann an paaren Gelt 100 Gulden und von der „hineingebrachten standtesmessigen Ausfertigung (Aussteuer) die besten 3 Hals Stuck(kleider), (das sind Mieder mit dazugehörenden Rock, heute auch als Dirndl bezeichnet) zu bezahlen und herauszugeben schuldig sein“.
Der letzte Abt von Windberg 1803
Damit war der Heiratsvertrag nach dem damals geltenden kurfürstlichen Landrecht und dem „alhiesigen uhralten Herkommen: (nach) Sitt- und Gewohnheit“ beschlossen und niedergeschrieben. Als Zeugen fungierten für den Ehemann Joseph Müller zwei Further Bürger, nämlich der Bäcker Gregor Kellner (Bayplatz 1) und Paulus Prey, „Pflaumermihler“ (Lorenz-Zierl-Str. 12- bereits 1665 hatte der Vorfahre Peter Preu von der „Pflämlmühle“ bei Eschlkam dieses Mühleanwesen in der Stadt käuflich erworben), sowie der Stiefvater des Hochzeiters, Hans Drumb. Zu den Further Zeugen sei noch anzufügen, dass der Müller Paulus Preu der Vater von Ignatius Preu war. Dieser, geboren am 16. Mai 1755, trat in den Prämonstratenserorden ein, wurde Priester und war später Abt im Kloster Windberg (Landkreis Straubing-Bogen), wenn auch nur wenige Jahre von 1799 bis zur Säkularisation im Jahre 1803, als in Bayern landesweit die Klöster aufgehoben wurden, darunter auch Windberg.
„Anseiten des Weibs“ sind als Zeugen genannt: Andre Hastreiter, Bauer von Großaign und Georg Schuhmann von Kleinaign, dann Hans Georg Späth von Eschlkam (Nr. 4/Waldschmidtstraße 6) und Mathias Hastreiter, Bauer von Hinterbuchberg. Die Jahre gingen ins Land und 1764 übergeben die Witwe von Joseph Müller, Barbara und die Kinder die Mühle „cum omnibus pertinenties“ (mit allem Zubehör wie die dazu gehörenden Gründe und Gerätschaften) an den mittleren Sohn Joseph. Der Wert der ganzen Anlage mit den Grundstücken wurde auf 1600 Gulden geschätzt; davon die Mühle, die zwei „unterschlachtige Gänge“ besaß, allein auf 700 Gulden. „Unterschlächtig“ bedeutet, dass die Wasser aus dem Mühlkanal zum Antrieb nicht über, sondern unter dem Mühlrad durchgeleitet wurden.
Im Jahr 1828 wurde der Viehbestand des Mühlenanwesens mit1 Pferd, 2 Ochsen, 3 Kühe, 3 Kälber und einer Sau angegeben. 1860 wird im 1. Renovierten Kataster der Wert der „Heuhofer Mühle“ auf 5000 Gulden geschätzt. 39 Jahre später geht der Familienname >Müller< infolge Übergabe ab. Neue Besitzer sind Franz Breu, geb. 1874 in Neuaign und Ehefrau Maria. Derzeit ist die sog. Heuhofer Mühle im Besitz von Petra Fischer. Ihr Vater, der Bäckermeister Alois Fischer aus Furth im Wald aus dem Hause „Abrahambäck“ in der Herrenstraße, hatte 1958 Rosa Breu geehelicht und so in das ehemalige Mühlenanwesen eingeheiratet. Der Mühlenbetrieb wurde 1967 eingestellt.
Werner Perlinger
Der „Oelbrunn“ und das Federkiel-Marterl – deren ehemalige Lage
+Eschlkam. Unter den zahlreichen Flurnamen, erwähnt in Akten des 18./19. Jahrhunderts, findet sich mehrmals der Name >Oelbrunn<. Zur Erklärung des Namens sei vorweg ein sprachlicher Vergleich mit einem Blick in die regionale Nachbarschaft angebracht.
Der Name „Ölpach“, seit langem nur als „Grabitzer Bach“ im heutigen Gemeindebereich der Stadt Furth im Wald tituliert, hatte mit Ölmühlen nie zu tun. Er schied einst, so in der ersten Grenzbeschreibung zwischen Bayern und Böhmen im Jahre 1462, in seinem gesamten Verlauf damals das Königreich Böhmen, die Pfalz und das Herzogtum Bayern voneinander. Der Name bedeutet von seiner oft verschiedentlich überlieferten Schreibweise her, wie beispielsweise als „Oelbach, Ollebach, Ellebach und Ellenbach, elilentibach“, eigentlich „Grenzbach“, der Bach, der aus einem anderen Lande kommt, wobei die sprachliche Grundlage dafür zwei Worte sind, nämlich „alia lante“. Zusammengefasst ist dies ein altes lateinisch-deutsches Mischwort für „ein anderes, (oder) fremdes Land“. Die Quelle des Grabitzer Baches, gelegen in den Voithenbergischen Waldungen unterhalb dem Reiseck nahe der Panoramastraße, heißt in alten schriftlichen Überlieferungen der „Oelprunn“, ein Brunnen oder Quelle, der oder die zugleich als Grenzpunkt dient.
So bedeutet auch der manchmal auftauchende Orts- oder Flurname „Elend“ nicht das Elend oder die Not der dort wohnenden Menschen, sondern allein nur die geographische Wohnlage im Grenzbereich einer Region.
Der „Oelprunn“ in Eschlkam
Die Frage für uns ist nun, wo lag innerhalb der Eschlkamer Fluren dieser „Oelprunn“, der nicht mehr in den uns bekannten Karten erscheint, sondern eindeutig nur mehr im Plan der Erstvermessung bzw. Liquidation. Vom Namen her liegt es daher nahe, diesen Brunnen im Bereich der Gemeindegrenzen des Marktes zu suchen. So sind in einer Beschreibung der Kommunalgebäude vom Jahre 1809 neben den einzelnen Immobilien auch die sog. „Dienstwiesen“ (für den Unterhalt gegeben an die Marktbediensteten) aufgeführt; darunter ein „Wiesel, zweimähdig beim Oelbrunn; benutzt solches der Schullehrer (als sog. „Dienstwiese“) und ist ½ Tagwerk groß“, von seinem Wert her geschätzt auf 35 Gulden. Die bisher frühesten Nennungen für den Oelbrunn finden sich in den Kammerrechnungen von 1706 und 1713. So befindet sich beispielsweise ein Krautgarten des Bürgers und Weißbäckers Hans Vogl beim „Öelprunn“.
Gehen wir bei diesem Namen von einer Grenzlage aus, so dürfte dieser Naturbrunnen irgendwo nahe der Grenzlinie der Eschlkamer Gemeindeflur zu finden sein. Tatsächlich wird 1840 in der Auflistung der Grundstücke zur damaligen Hausnummer 58 auch das „Oelbrunnwiesel aufgeführt. Es trug damals die Plnr. 644, gehörend zu Anwesen Nr. 58/Blumengasse 2 (beim Voglbäck). Bekannt ist die Brunnenstelle noch als ehemals stets nasse Stelle im Gelände, mittlerweile jedoch beseitigt durch die Flurbereinigung.
Dieser Brunnen, bzw. sein Name führt in die frühe Zeit zurück, als eben der Siedlungsbereich der Bürger „am Berge“ unterhalb im Umfeld dieses Brunnens endete und er somit eine Randlage markierte, nicht weit entfernt vom Chambfluss, der Großaign vom Markte trennt.
Der Federkiel – sein Marterl
Dazu erzählt eine alte Geschichte aus dem Buch Grenzwaldsagen des Lehrers und Sagensammlers Xaver Siebzehnriebl (1891-1981) von Neukirchen b. Hl. Blut: „Der Federkiel war Verwalter im Schlosse zu Stachesried und gefürchtet. In der Franz-Xaveri-Nacht ging er eines Jahres von einer Hochzeit heimzu. Auf halbem Wege überrumpelten ihn etliche Roßschwärzer, die hatten ihm schon längst den Tod geschworen, der Federkiel hatte sie oft den Grenzwächtern verraten. Die lichtscheuen Leute rächten sich und erschlugen den Federkiel und schleiften ihn bis zum Jägerhof. Andernmorgens fanden Holzhauer den Federkiel mausdrecktot am Weg liegen. Auf dem Plätzel, wo der Federkiel so entsetzlich enden musste, stand lange Jahre ein Marterl. Dort beim Bildtäferl regierte und schreckte eine Zeit lang der Geist des Federkiels ...“ (siehe dazu auch das Heimatnuch Band I „Eschlkam in alter Zeit, von den Anfängen bis in die Moderne“, 2010, S. 331).
Das in der Sage erwähnte Marterl ist im Geländeplan von 1840 am Stachesrieder Weg als ein Kreuz eingezeichnet. Es befindet sich bereits hinter der Eschlkamer Gemarkungsgrenze auf Stachesrieder Gebiet (Plnr. 49).
In einer Besitzerliste der Stachesrieder Anwesen, niedergeschrieben im Häuser- und Rustikalkataster von 1811/12, findet sich tatsächlich ein Franz Federkiel. Da der Name ortsunüblich ist, kann angenommen werden, dass besagter Federkiel vielleicht aus berufsbedingten Gründen zugezogen ist. Wahrscheinlich diente er dem damaligen Schlossherrn Karl Albert von Herder und erlitt wohl einen gewaltsamen, jähen Tod. Um solche Vorkommnisse rangten sich bald unheimliche Geschichten. Zur Geschichte der Familie Federkiel und so zum tatsächlichen Hintergrund der Sage helfen uns tatsächlich die Pfarrmatrikel von Eschlkam weiter:
1801, 4. November: An diesem Tag heiratet ein Franz Federkiel, Sohn des Gerichtsdieners Franz Federkiel aus Sattelpeilnstein eine Barbara Ernest, Tochter des Georg Ernest, Jägers in der Hofmark Sattelpeilnstein.
1814, 11. März: Franz Xaver Federkiel, verh. Gerichtsdiener von Stachesried, 42 Jahre alt, wird nachts um 10 Uhr durch mehrere tödliche Hiebe und Stiche grausam ermordet auf dem Wege nach Stachesried „bey der sogenannten Marktschreiberswiese“ (eine weitere sog. „Dienstwiese“), so der Eintrag von Pfarrer Alois Wagner im Sterbebuch der Pfarrei.

Bildunterschrift: Im Liquidationsplan von 1840 markiert die Hausnr. 58 im Norden des Marktes (historische Karte oben links) die Lage der „Ölbrunnwiese“, die einst die jeweiligen vom Markt angestellten Schullehrer nutzen konnten. In ihr befand sich früher eine am steilen Hang zu Tage tretende Quelle, genannt der „Oelprunn“ (siehe roter Pfeil).
In dem Kartenausschnitt oben rechts finden wir am alten Stachesrieder Weg das Marterl (erkennbar gezeichnet als ein sog. „Tatzenkreuz“) für den ermordeten Hofmarksbediensteten Federkiel, dahinter dann die Kirche „zur Schmerzensmutter Schöneichen in der Klause“,
(Bildnachweis: Markt Eschlkam)
Werner Perlinger
Raufereien waren früher an der Tagesordnung Teil 2
+Eschlkam. Fortsetzung des Artikels "Niedere Gerichtsbarkeit"
Der Musikantenstreit
Es war Mitte November 1692, da spielten der Schneider Hans Fleischmann (Nr. 66/Großaigner Straße 15) und der „Schullmaister“ Hans Wolf Tenzl bei einer Hochzeit auf. Und es geschah wie es sogar heute oft noch vorkommen kann, beide Musikanten gerieten in Streit und dabei ging es allein ums Geld. Denn als sie das mit ihren Auftraggebern vereinbarte Honorar bei den Gästen „erhebt“ (eingesammelt), sagte Tenzl zu Fleischmann, „halt den Poß recht, daß khein Gelt hinunder fahlet“; sollte ein Kreuzer fallen, würde er ihn „niederschlagen“. „Nachvollendter“ Hochzeit begann Tenzl wieder mit Fleischmann zu streiten, titulierte ihn „ainen Spott Mann“ und warf ihm „gar ein Glässl mit sambt den Prandtwein ins Angesicht nechst bey dem linkhen Aug“. Das verursachte eine ziemlich blutende Wunde, auf die dann der „Pader“ (es war der Wundarzt Stephan Mauser von Hsnr. 7/Kleinaigner Straße 3) ein „Pflaster “ auf die Wunde „legen“ musste.
Tenzl widerspricht das beleidigende Wort „Spottmann“, gab aber den Wurf mit dem Glas zu. Der Streit sei nur beim Teilen des Geldes entstanden. Außerdem habe der Kläger Fleischmann vorher nach einen „Leichter (Kerzenleuchter) griffen“ und er sei dessen Vorhaben zuvorgekommen und habe ihm „das Glässl ins Gesicht geworffen“. Da die Auseinandersetzung mit einer blutenden Wunde endete, verwies das Marktgericht die ganze Angelegenheit an das Pfleggericht. Damit hatte sich der Pfleger in Neukirchen zu beschäftigen, da das Pfleggericht Eschlkam nach den massiven Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg seit 1640 am Ort nicht mehr existierte. Damit aber zwischen beiden künftig Friede sei wurden sie trotzdem „zu Poenfahl (als Strafe) 2 Pfund Pfennige gesetzt“, das entsprach damals circa 2 Gulden.
Wenn der Mesner mit dem Bader rauft
Es sollte eigentlich eine gemütliche Unterhaltung am Biertisch werden, an einem Sommertag im August des Jahres1693. Im Gasthause des Bürgermeisters (Wolf Sighardt) Altmann, heute der Gasthof Penzkofer, haben der Bader Stephan Mauser und Wolf Khinninger, „Mössner“ für die Kirche St. Jakob (Nr. 27/Kirchstraße 3), „ain Trunkh gethon“ und sie spielten Karten. Und sogleich begann der Mesner den Bader zu beleidigen mit den Worten: „Du Kerl, ich bin dir mein Tag nicht hold gewesen, ich will dir was anderst weißen, du bist mir nit gmässig, du Schüntter Hundt“ (Schinderhund = Hund des Wasenmeisters/Abdeckers)). Bei diesen Worten gab der Mesner dem Bader „ainen Straich mit der Handt“. Als Kläger bat der Bader dem Beklagten „obrigkheitlich aufzutragen, daß er solche grosse ehrenriehrige Reden auf ihn Kläger wahr mache oder genugsame Satisfaction geben solle“.
Der Mesner gab vor, der Kläger könne nicht in Abrede stellen, dass er in „rauschiger Weise“ ihn Khinninger mehrmals als „Sau tituliert“ habe, so dass es sein könne, dass er ihn hinwieder als einen „Schüntt Hunth“ (Schinderhund) bezeichnet habe. Auch könne sein, dass er, Khinninger, zugeschlagen hat. Zugleich sei ihm aber der Bader „in die Haar gefallen und auf der Nasen blutrunstig gemacht“, was auch etliche Tage zu sehen gewesen wäre. Es müsse daher der beklagte Khinninger Satisfaction (Genugtum) wegen der erwähnten viehischen Vergleichung (Schinderhund), Haar ausrauffung und anderes“ leisten. Da Aussage gegen Aussage steht, wurde die ganze Angelegenheit um 14 Tage vertagt. Am 12. September wurde in der Sache wegen der „gegen einander aus gestossenen schimpflichen und unzimblichen Reden, auch (wegen des) verübten trukhnen Gereiffs (Geraufe)“, auch „weil weder Inurien, blutrünstige noch Leibschäden underloffen, der beklagte Khinninger, seine in rauschiger Weise ausgestossenen üblen Worte, die er gewöhnlich auch gegen seine eigenen Kinder gebrauche,“ ihm dies allen Ernstes verwiesen, ebenso auch dem Kläger sein Verhalten, so dass eine direkte Strafe nicht ausgesprochen, sondern nur die Gerichtskosten auf beide Streithähne umgelegt wurden.
Widerstand gegen den Ratsdiener kommt teuer
Wir befinden uns in der winterlicher Zeit des Jahres 1694: Am 7. Februar schildert der Ratsdiener Gottfried Stainpacher, der Bauer Hansen Schreiner von Großaign sei unerlaubt über „die völlige Wismather, die Paint genannt“ mit seinem „beschlagenen Kharn“ gefahren, beladen mit 5 Ell Mell (1 Ell entsprach ½ Scheffel = 112 Liter), gezogen von 2 Ochsen und einem Pferd. Schreiner wollte mit seiner schweren Fuhre so den mühsamen Weg über den steilen Berg des Marktes abkürzen. Stainpacher wollte, da die eisenbereiften Räder und auch die Hufe der Tiere sich in die Wiese stark eingruben und schwere Schäden verursachten, das ganze Gespann mit Ladung kraft seines Amtes „pfenden“. Schreiner widersetzte sich diesem Vorhaben, schlug auf den Ratsdiener ein, verletzte ihn blutig an der linken Hand, drückte ihm „in die Gurgl mit vorgesetzten Daumen“ und stieß ihn schließlich nieder. Trotzdem konnte Stainpacher „gleichwollen ain Pfandt bekhommen“. Wegen seines „fräventlichen Wissen (über die Wiese) fahrens“ und vor allem wegen seines massiven Widerstands gegen die Pfändung wurde er „umb 1 Pfundt Pfennig“ (ca. 1 Gulden) gestraft. Auch musste er die Gerichtskosten begleichen.
Ergänzend sei erwähnt, dass die Wiesenflur „Paint“ sich am westlichen Abhang unterhalb des Marktes breitet, heute größtenteils überbaut. 1685 und 1753 wird das Anwesen Nr. 9/Kleinaigner Straße 7 (Schmirl/Kerscher) bezeichnet als „in der paindt gelegen“.
Der Flurbegriff >point, boint< oder auch >paint<, je nach dialektischer Ausdrucksweise, ist in unserer Region öfter anzutreffen. „Point“ bedeutet die meist mit einer Hecke, vielleicht auch mit einem einfachen Speltenzaun eingezäunte Wiese. Oft handelt es sich dabei um ein Wiesengrundstück, gelegen direkt nahe einem Haus, bzw. bäuerlichen Anwesen in der Einöde. Dem Wort „point“ liegt althochdeutsch „biunt“ zugrunde, was so viel wie >binden, umbunden< (eben mit einem Zaun, oder einer Hecke) bedeutet; in unserer Region eben eine umzäunte Flur, die sich meist im Besitz eines Bauern befindet. Dazu gibt es auch bei uns für einen Bauernhof den nicht seltenen Hausnamen: „beim Boiner“ wie in Unterrappendorf und Grub, was sprachlich nicht auf >Knochen<, sondern nur auf die Hofstelle auf oder nahe einer ehemaligen „Pointwiese“ zurückzuführen ist.
Werner Perlinger
Als der Markt vor über 150 Jahren für verarmte Kinder zu sorgen hatte
+Eschlkam. „Die Wernhard’schen Färbers Kinder von Eschlkam, hier: deren Unterbringung und Erziehung betrff.“ So tituliert ein Akt aus dem Jahr 1858. Der Landrichter Paur von Kötzting stellt (eingangs) am 31. Juli fest, „dem Vernehmen nach sollen die Kinder des abgehausten Färbers Wilhelm Wernhard einer körperlichen und geistigen Verwahrlosung Preis gegeben sein, die eine Abhilfe ding- und nothwendig macht“. Der Armenpflegschaftsrat wurde aufgefordert „nothwendige Schritte zur Abhilfe zu thun“.
Wilhelm Karl Wernhard, geb. am 23. Juli 1816 als Sohn des Landgerichtsassessors Johann Nepomuk Wernhard in Beilngries, heiratete am 1. Oktober 1844 Johanna Aman, eine Gastwirtstochter aus Cham. Dann kaufte er 1845/46 das Anwesen Nr. 7/Kleinaigner Straße 3 (das ehemalige Badhaus) von den Erben der Baderfamilie Schoeppel und betrieb dort für einige Zeit eine Färberei. Das Geschäft schien nicht den gewünschten Erfolg zu bringen, denn einige Jahre später war Wernhard „abgehaust“, d.h. er konnte das Anwesen nicht mehr halten. Auch war seine Frau mittlerweile gestorben, und um die fünf Kinder hätte sich nun der Vater kümmern müssen. Im Gegenteil: er gab sich dem Trunke hin und kümmerte sich um seine Kinder gar nicht. In einem solchen Falle schritt auch damals schon der Staat ein, denn man wollte nicht, dass gerade junge Menschen in die Armut abtrifteten und so der Allgemeinheit lange Zeit zur Last fielen.
Am 5. August bestätigte die Marktführung die Vermutung des Landrichters, da der leibliche Vater „nicht das mindeste für sie tut und ihnen nur mit bößem Beispiele vorangeht“. Als ein Vormund existierte bereits der Schwager, Gastwirt Caspar Amann von Cham, jedoch nur für die zwei ältesten Kinder, Wilhelmina und Carl, die sich bei ihm bereits befanden. Wir erfahren dabei, dass Carl als Hutmacherlehrling und die ältere Tochter als Dienstmädchen untergekommen seien.
Keiner Vormundschaft noch unterlägen die übrigen jüngeren drei Kinder Margaretha (9 Jahre), Walburga (6 Jahre) und Wilhelm (4 Jahre). Sie seien noch „bei ihrem beschäftigungs- und erwerbslosen Vater dahier“. Der Schriftverkehr zog sich hin. Man suchte geeignete Familien im Markte die von ihren Verhältnissen her bereit waren Kinder aufzunehmen. So erklärte am 14. Oktober die Bürgersfrau Sofie Fischer (Nr. 2/Waldschmidtstraße 10), dass sie das Mädchen Margarethe in „Kost und Pflege“ nehme, sie mit der nötigen Kleidung versehe und auch für den Schulbesuch sorge. Die Nachbarin, die Gastgebersgattin Franziska Neumaier (Nr. 1/Wald- schmidtstraße 14) nahm das Mädchen Walburga auf und der Säcklermeister (Hersteller von Lederhosen) Sebastian Lechermeier (Nr. 39/Blumengasse 1) den Knaben Wilhelm. Am gleichen Tag informierte der Magistrat mit Bürgermeister Alois Schmirl an der Spitze den Vater Wilhelm Wernhard, dass drei seiner Kinder „bei ordentlichen Bürgersfamilien untergebracht“ seien und „ermahnte ihn sich gegen diese ordentlich zu verhalten und die Kinder nicht zu (ver)hetzen“, was Wernhard mit seiner Unterschrift bestätigte.
Es ging einige Zeit alles gut. Jedoch vorher schon, am 4. Oktober 1859, erklärte der junge Carl Wernhard, der bei dem zu ihm verwandten Hutmachermeister Peter Ellersdorfer in Cham als Lehrling war, „dass er von seinem Meister davon gejagt worden sei“. Am 25. Oktober ließ der Säcklermeister Lechenmeier wissen, dass er den Knaben Wilhelm nicht mehr um die ausbedungene Entschädigung (festgelegt von der Gemeinde) haben könne“. Man kam überein, dass er dennoch den Knaben gegen eine jährliche Entschädigung von 23 Gulden aus der Armenkasse bis 14. Oktober 1860 behalte, was so auch geschah.
Ein Testament hilft
Am 1. Oktober 1859 stirbt der Rotgerbergeselle Joseph Wernhard in Beilngries. Er hinterließ ein Vermögen von 1000 Gulden, wovon die Hälfte, 500 Gulden, er den Kindern seines Bruders Wilhelm vermachte. Eine silberne Uhr erhielt der älteste Sohn, der oben genannte Carl; einen Schaukasten vom Typ „Poliorama“ erhielt der Vater der Kinder, Wilhelm Wernhard. Dieser informierte am 11. Oktober 1859 von Schorndorf aus darüber den Magistrat Eschlkam. Am 28. Oktober meldet der Bürgermeister von Cham, Seibold, dass „der abgehauste Färber Wernhard“ sich im Mai in Cham mehrere Tage aufgehalten und dem Trunke sich ergeben habe, herumschimpfe und „in den Wirtshäusern keinen Kredit mehr habe“. Ein Stadtverweis war die Folge.
Am 9. November schließlich erhielt der Sohn Carl einen neuen Lehrmeister, nämlich den Hutmachermeister Franz Lax von Eschlkam (Nr. 55/Blumengasse 10). Am 15. Dezember wurde die 10 Jahre alte Margarethe, „Tochter des grundliederlichen abgehausten Färbers Wernhard“ durch die Frau des Gastwirts Aman von der Familie Fischer nach Cham abgeholt um es dort in ein „Institut für verwahrloste Mädchen“ zu geben. Es entwickelte sich ein ständiges Hin und Her.
Schließlich wurde am 11. August 1861 festgelegt, dass aus dem für 1300 Gulden erfolgten Verkauf des Wernhard’schen Hauses 500 Gulden und aus dem Erbe des Onkels aus Beilngries, ebenfalls 500 Gulden, in der Sparkasse in Kötzting hinterlegt werden. Mit den Zinsen daraus möge die Armenpflege in Eschlkam unterstützt werden, da diese für die Kinder weiterhin sorge. Damit waren die Verhältnisse einigermaßen geklärt.
Wilhelm Karl Wernhard blieb die nächsten Jahre in Eschlkam. Er wohnte als Inwohner in Anwesen Nr. 16 (Bräuhausgasse 1) und starb als Witwer am 19. Juni 1887 mit 71 Jahren an „Säuferwahn“, so der Eintrag in der pfarrlichen Sterbematrikel. Nur sein ältester Sohn Karl blieb auch in Eschlkam, wohnte als Nachtwächter im Rathaus und verstarb am 20. August 1884 im Alter von 38 Jahren an Lungenlähmung. Das Schicksal der anderen Kinder ist nicht bekannt.
Werner Perlinger
Raufereien waren früher an der Tagesordnung
+Eschlkam. Die sog. „Niedere Gerichtsbarkeit“, ausgeübt von Richter und Rat seit der Marktwerdung im frühen 13. Jahrhundert, umfasste im Gegensatz zur Hohen- oder Blutgerichtsbarkeit nur Vergehen wie Beleidigungen, Raufereien ohne schlimmen Ausgang, kleine Eigentumsdelikte, Schuldenfragen, auch sog. „Leichtfertigkeiten“ (wegen ledig oder nach der Eheschließung zu früh geborener Kinder). Vor allem Raufereien und Schmähungen (Verbalinjurien, Beleidigungen) sind in den Protokollen sehr zahlreich niedergeschrieben, wobei in den meisten Fällen der Alkohol eine wesentliche Rolle spielte. Die umfangreichen Ausführungen in den Schriften allein würden schon Bände füllen. Nicht enthalten sind die Auseinandersetzungen bei denen Messer oder sonstige „Waffen“ eingesetzt waren. Denn schwere Verletzungen mit Todesfolge, Totschlag oder gar Mord wurden allein vom Landgericht in Kötzting abgehandelt, denn diese Institution verfügte über die oben genannte Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit. Daher finden solche Taten in den Ratsprotokollen keinerlei Erwähnung, obwohl auch sie vorgekommen sind.
Häufig wurden Streitigkeiten zwischen Frauen verhandelt, wobei es dabei oft nicht nur bei verbalen Beleidigungen blieb. Häufig wurden die „Weibsbilder“ gegeneinander sehr handgreiflich. Gegen diese Frauen wurde in der Regel fast immer die „Geigenstrafe“ als sog. „Schandstrafe“ ausgesprochen. Dazu wurden sie mit dem Hals und den beiden Armen in die Geige gespannt und öffentlich zur Schau gestellt. Das Instrument, ein sog. „Schandholz“, glich einer Geige, daher der Name .
Es seien nun einzelne Gerichtsfälle aus dem frühen Ratsprotokoll, niedergeschrieben zum Ende des 17. Jahrhunderts, exemplarisch angeführt, auch weil sie einen Blick auf die Sitte und Moral damaliger Zeiten erlauben: Am 8. Juni 1691ging „Geörg Kellner, Böhaimb(ischer), Freyherrlich(er) Gorzischer Underthon“ an der Wohnung des Bürgers Hans Georg Vischer (damals Mieter im Rathaus) vorbei. Als Vischer ihn sah, lief er aus dem Haus und schimpfte den Kellner mit den Worten „Du Schelmb, willst mich nicht bezahlen. Er geht vorüber wie ein anderer Schelm und Dieb“, worauf der Kläger den Vischer „auch so geschendt“. Daraufhin lief Vischer in das Haus zurück, nahm eine „Pixen“ (Gewehr), schlug ihn damit auf den „Pukhl“ (Rücken) und auf den Kopf, so dass Kellner „plutrunstig aufgestossen“ war. Als Kläger bat Kellner um „Abtrag und Satisfaktion (Genugtum) seiner Ehre“.
Der beklagte Vischer brachte vor, er habe den Kellner zunächst gefragt wann er ihm den Pferdetausch bezahle. Dieser sei aber weiter „den Markt hinab gangen als wie ein andrer Schelmb und Dieb“. Erst als ihn aber der Kläger „retorquiert“ (hier verbal mit Gleichem vergalt), sei er um die „Flinten gelaufen und habe ihm bei dem Hause des Hans Späth damit „einen Stoß zum Kopf“ gegeben. Erkannt wurde, dass der Fall aus Gründen der Zuständigkeit an das „churfürstliche Pflegamt alhier“ weiterzuleiten sei, da Kellner aus einer böhmischen Herrschaft stamme. Damit aber „sich keiner mit Wortten noch Werkhen gegen den andern vergreiffen solle“ wurden beiden Parteien „zum Poenfahl (zur Strafe mit) 3 Pfund Pfennige (etwa 3 Gulden) gesetzt“. Sollten sich beide „Partheyen vergleichen“, sollte dies dem Pfleggericht gemeldet werden.
Ein folgenschwerer Steinwurf
Wolf Zilckher, lediger Bürgersohn, erlaubt sich im Juni 1691 dem Hans Schissl, Dienstbub bei Simon Stephl (Waldschmidtstraße 10 oder Marktstraße 15), als dieser gerade „neben der Strassen im Markt am Schloßgraben die Pferd gehiett“ ohne Grund mit einem ¼ Pfund schweren Stein „aufs Maull doch ohne Wundten zu werffen“. Dennoch schwoll die Mundpartie mächtig an und verursachte große Schmerzen. Zilckher räumte seine Tat ein und gab vor, er habe „aus Vexation“ (Verärgerung, Zorn) auf ihn geworfen. Auch glaubte er, dass er ihn nicht treffen würde. Der Täter wurde daraufhin, da er auf dreimaliges Vorladen nicht erschienen war, „3 Stundten ins Narrenhheusl condemniert (gesperrt)“. Das „Narrenhäusel“ war ein Käfig, der in der Regel öffentlich beim Rathaus aufgestellt war. Dort konnten die Vorbeigehenden den sog. „Insassen“ verspotten.
Eine Rauferei beim Jakobimarkt
Er ist stets eine große Festivität, der „privilegierte Jahrmarkt“ in Eschlkam. Im Jahr 1691 wurde er am Sonntag vor Jakobi (Mittwoch, 25. Juli) begangen. Das Bier fließt an diesem Sommertag in Strömen. Voll besetzt sind die Wirtshäuser und auch der Marktbereich mit seinen Buden und dem Bierausschank in der Öffentlichkeit. An diesem Tag verübten der ledige Bürgersohn Wolf Späth, Wolf Hastreiter und Georg Schrimpf, dieser bei Bürger Altmann (heute Penzkofer) in Diensten, mit Hansen Vischer und Georg Hastreiter vom Kuchlhof, Hans Hacker und Georg Prunner von Schwarzenberg, Wolf Stauber von Leming und Jakob Reithmayr von Großaign und dann noch Andre Preu von Arnschwang ein „trukhenes Geräuff“ (eine Rauferei ohne blutige Verletzungen). Eigens wird bei der „ex officio (von Amts wegen erfolgten) abstraffung“ betont, dass dabei keine „blutrunstige Leib, oder Painbriche Schäden“ entstanden seien. Für alle wurde eine Strafe von insgesamt nur 2 Gulden 50 Kreuzer ausgesprochen, auch mussten die Gerichtskosten übernommen werden. Von ähnlichen Ereignissen an Feier- und Festtagen berichten die Ratsprotokolle immer wieder.
Werner Perlinger
Attestatenbücher geben Einblick in frühere bürgerliche Verhältnisse
+Eschlkam. Im Marktarchiv befindet sich eine nicht geringe Anzahl sog. „Attestatenbücher“. In zeitlicher Abfolge besteht ihr Inhalt aus sog. Bescheinigungen, wie der Name „Attest“ schon erklärt, die einzelne Bürger immer wieder benötigten, um z. B. als Bürger aufgenommen zu werden, eine Heiratserlaubnis zu erhalten, für übergeordnete Behörden den Besitzstand erklärend, um den Beruf oder eine gewisse Tätigkeit ausüben zu können oder auch als Beweis im Besitz eines guten Leumunds zu sein.
Wir wenden uns dem Jahreszyklus 1840/41 zu. So wird am 29. Oktober 1840 dem Bürgerssohn Xaver Grauvogl (geb. 1816), angehenden Bader und Chyrurgen (damals der Wundarzt) wegen „Besitzergreifung, dann Ansässigmachung auf das Grauvogl’sche Burger- und Baderanwesen, worauf die reale Badergerechtigkeit ruht, hiermit beurkundet, daß sein Conduite (Verhalten) trefflich gut, ein Mensch von bestem Laimunthe, und (er) auf sein aus Landshut erlangtes Approbationszeugnis bestens zu empfehlen sey“. Aber bereits 1838 hatte die Familie Grauvogel das Anwesen Hsnr. 7/Kleinaigner Straße 3 an den Bader Georg Schoeppel verkauft, einen Sohn des Metzgers Joseph Schoeppel und dessen Frau Theresia, geb. Grauvogel, von Nr. 34/Marktstraße 5. Der junge Schoeppel blieb nicht lange in seinem Geburtsort Eschlkam, denn bereits 1845, am 8. Oktober, ging die „Badergerechtigkeit“ für 800 Gulden an den zugezogenen Bader Jakob Herzog aus Deggendorf über. Damit endete die seit Jahrhunderten auf diesem Anwesen ruhende Badergerechtigkeit (siehe dazu auch den Artikel: „das ehemalige „Badhaus“ im Markte).
Am 13. April 1841will Anton Korherr, Kufner, in seinem „mit Legschindeldachung versehenen alten Burgershaus“ Nr. 71/Großaigner Straße 2 (beim Ulla) eine Werkstätte, eine Stallung und eine Dreschtenne bauen. Den Anliegern Ignatz Schmirl, Schuster (Nr. 72/Marktstraße 12), Anna Maria Hacker (Nr. 70/Großaigner Straße 4) und Georg Schreiner, Seifensieder (Nr. 60/Marktstraße 15 – er hatte neben Korherr nur einen Stadel) wurde der Plan des Korherr zur Einsicht vorgelegt, so dass „sie (das Vorhaben) samentlich gut geheißen und nichts dagegen kraft ihrer am Ende stehenden eigenhändigen Unterschriften wider zu erinnern haben“. Bereits damals gab es in Eschlkam auf dem Sektor >Bauwesen> feste Genehmigungsvorgaben, wie sie prinzipiell noch heute gebräuchlich sind.
Eine zu harte Konkurrenz beklagt
1853, am 22. November wird dem Schlossermeister Joseph Römisch (Hsnr. 68/Großaigner Straße 6-er hatte im Jahre 1826 eingeheiratet) amtlich attestiert, „dass seine Familie aus 7 Köpfen bestehe und er noch 4 Kinder zu ernähren habe“ und er so familiär „ein schlechtes Fortkommen hat, namentlich seitdem Eisenhändler M. Dachauer (Hsnr. 6/Kleinaigner Straße 6) Handel mit Fabrikschlössern u. anderen Schlosserartikeln treibt. Dachauer versorge als Eisenhändler die ganze Gegend mit zwar billigen aber leicht verfertigten Schlössern und er diesen Handel immer schwunghafter betreibt“. Römisch könne daher mit seinen selbst verfertigten Schlosserwaren preislich „nicht mehr concurrieren und muß folglich in kurzer Zeit mit seinem Gewerb zu Grund gehen“, so die Einlassung des Beschwerdeführers. Typisch für diese Zeit ist, dass mittlerweile die in den Fabriken hergestellten handwerklichen Produkte als Massenware auch in den entferntesten Regionen für die dortigen Handwerker zu einem Konkurrenzproblem wurden, da sie - meist billiger - die qualitätsvollen Erzeugnisse der heimischen Handwerker am Markte verdrängten – ähnlich die Situation auch heute wieder. Man kann sich auch vorstellen wie bei diesen Entwicklungen das menschlich-gesellschaftliche Klima im Markte litt. Der Magistrat hatte dem Römisch mangels gegebener Entscheidungsbefugnis sicher nicht helfen können. Wie es mit Römisch weiterging, verrät das Protokoll nicht. Auf dem Anwesen Großaigner Straße 6 blieb jedoch die Schlosserei Römisch noch Jahrzehnte erhalten.
„In drückender Armuth“ lebte im Jahr 1854 auch Seilermeister Joseph Koller (Nr. 12/Kleinaigner Straße 11), „da sein Sailergewerbe bei der großen Theuerung der Lebensmittel gänzlich darnieder liege“. Von Vorteil für die damalige Zeit war, dass in Eschlkam sämtliche Anwesen über eine wenn auch kleine Landwirtschaft verfügten, so dass trotz geschilderter wirtschaftlicher Nöte eine Grundversorgung der meist vielköpfigen Familien gewährleistet war – was heute im Ernstfall nicht mehr gegeben wäre.
Brot für die „besseren Leute“ ?
Mathias Schreiner (Nr. 18/Further Straße 8), „64 Jahre alt und sehr gut beleumundet, kann sich mit seinem Weibe wegen körperlicher Gebrechen durch Lohnarbeit nichts mehr verdienen“. Er begann einen „Brodhandel“ und brachte aus der Stadt Cham für einen gewissen Personenkreis im Markte Backwaren, „da die hiesigen Bäcker nicht im Stande sind, so gutes Gebäck zu liefern, und sohin ein Bedürfnis nicht für die hiesige Gemeinde, doch für einzelne dahier lebende Personen nach besserem Brode besteht“. Man kann sich vorstellen, wie verärgert und zornig die Bäcker des Marktes auf ihren Mitbürger Schreiner waren.
Der Bürgerstochter Franziska Späth wird am 18. August im gleichen Jahr „in einer Streitsache wegen Beschimpfung“ gegen Theresia Hausladen attestiert, „daß sie ihr Elterngut von 300 Gulden durchgebracht habe und überdies 3 außereheliche Kinder zu ernähren habe“. Demnach konnte sie ihre anstehenden Prozesskosten nicht bestreiten und musste von einer Klage gegen die Hausladen notgedrungen Abstand nehmen.
In der „Untersuchungssache gegen den ledigen Metzgerknecht Michel Lechermeier wegen Raubes“ meldete der Magistrat 1854 „wegen eines Vermögens Zeugnisses in Vorlage“ an das Landgericht Kötzting, dass Lechermeier kein Vermögen mehr besitze, „da er sein Elterngut bereits (in) liederlicher Weise durchgebracht hat“. Man konnte ihm somit nichts mehr „nehmen“. Bei einer Verurteilung verblieb nur mehr die Haftstrafe.
Werner Perlinger
Das hinterlassene Inventar der Anna Nürnberger
+Eschlkam. Wurde im letzten Beitrag der letzte Wille der Krämerin im Austrag, Anna Nürnberger, dem Leser nahegebracht, sei nun ihr mobiler Nachlass, als „Inventar“ aufgelistet, vorgestellt.
Zuvor für den Leser einige Erläuterungen zum Verständnis: Wenn nach Todesfällen Erbauseinandersetzungen drohten, mussten der Amtsbürgermeister mit den Räten des Markts als Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit von Amts wegen geordnete Verhältnisse schaffen. In der Praxis sah dies so aus, dass nach einem Todesfall in der Regel zwei Bürger, meist Ratsherren oder auch der gerade amtierende Bürgermeister, zusammen mit dem Marktschreiber in das Haus des Erblassers gingen und dort die hinterlassene, für die Erbaufteilung strittige Hinterlassenschaft (offiziell bezeichnet als „Inventar“) auflisteten, um sie dann auf gerichtlicher Basis unter den in Frage kommenden Erben zu verteilen.
Solche Inventaraufnahmen informieren ausführlich über den Lebensstandard unserer Vorfahren. Daher sind solche Niederschriften gerade in jetziger Zeit volkskundlich von großem historischem Wert. Es sei aber betont, dass trotz zahlreicher Brief- und Ratsprotokolle das Marktarchiv jedoch kein einziges Inventarbuch aus dem 18. Jahrhundert besitzt. Zufällig, bedingt durch Fragen zur Verteilung einer Erbschaft, ist uns in diesem Fall ausnahmsweise ein Inventar, nämlich das über das hinterlassene Vermögen der Anna Nürnberger vom Jahre 1803 überliefert.
So sei nun der mobile hinterlassene Besitz der Witwe Anna Nürnberger (von Haus Nr. 36/ Marktstraße 9) ausführlich dargelegt: Das „Inventarium“ wurde am 4. August 1803 niedergeschrieben. Als eigens dafür vereidigte Schätzleute waren der Hafner Joseph Hölzel (Nr. 51/Blumengasse 18) und der Leinenweber Johann Sporrer (Nr. 43/Blumengasse 11) bestimmt. Die Erblasserin lebte zuletzt bei ihrem Bruder Franz Späth, Handelsmann (Nr. 50/Blumengasse 20), fünf Jahre in der Herberge und bewohnte bis zu ihrem Ableben dort ein Zimmer. Darin befanden sich (der heutigen Schreibweise möglichst angeglichen):
1 kleines Crucifix, 2 auf Glas gemalene Bilder (Hinterglasbilder), 1 Aufhängtischl (um z. B. an der Wand im Herrgottswinkel Heiligenfiguren zu positionieren), 1 Eimer, 1 alter Sessel, 1 alter Stuhl, 1 Riebeisen, 1 kupfernes Saugpfännel, 1 blechernes und 1erdenes (aus Ton) Reinl, 2 eiserne Pfänneln, 3 erdene Schießeln, 2 hölzerne Däller, 6 erdene Häfen, 1 Nudelwalger, 2 Kochlöffel, 1 Schaf(f)el, 1 feichten (aus Fichtenholz) alte Bettstatt, darinnen 1 Ober- und 1 Unterbett, 3 Kopfbölster, weiters in einem Gemach 1 schlechtes Bett, 1 versperrte Truchen (Truhe) in welcher 1 schwarzer Flor mit einer kleinen silbernen Schnallen (versehen), 1 seiden berkans Karsät (Korsett aus Leinenstoff), 1 Katonns (aus Baumwolle) Karisät (Korsett), 1 schwarzer Balg (Pelz), 5 unterschiedliche Kittel aus Wolle, 3 Fürtücher, 2 köllische Bethzüge, 2 solche Kopfkissenbezüge, 1 bamasir (wahrscheinlich „Bombasin“ = seidener Stoff, meist aus Italien importiert) große und 2 kleine Zügeln (wohl Bänder zum schnüren), 5 Schnupftücher, 7 baumwollne Halstücher, 2 leinerne Tücheln, 4 Haupttücheln, 5 Leibtücher, 3 Tischtücher, 3 Handleuchter, 20 Hemden, 1 Paar schwarze Handschuhe, ein Paar Schuhe, 1 schwarze und eine Haube aus Seide sowie 8 ½ Ellen (1 Elle maß einiges über 50 cm) gebleichten Flachs a 18 Kreuzer.An Leinwand ferner: 26 ½ Ellen gebleichte Leinwand a 16 Kreuzer – etwas stärker vom Faden, 11 Ellen werchene (gewebte) Leinwand a 9 Kreuzer, 1 Paar baumwollene Strimpf, 2 Paar baumwollene und 2 Paar gärnere Strimpf, 3 Hühner und ein erdenes Weichbrunnkesterl. Insgesamt wurde für diese aufgezählten Gegenstände ein Wert von insgesamt 75 Gulden 18 Kreuzer ermittelt. An Bargeld fanden sich 13 Gulden 41 Kreuzer 2 Pfennige.
Die Anna Nürnberger war Gläubigerin verschiedener Bürger, so dass insgesamt 782 Gulden ausständig waren. Demnach ergab das „samentliche Vermögen“, mit eingerechnet die Ausstände, 871 Gulden. Davon ihre finanziellen Verpflichtungen abgezogen, wie Begräbnis- und Sargkosten, ergab sich ein Restvermögen von 615 Gulden. Diese und die genannten Sachgegenstände galt es an folgende Erben zu verteilen:
Es waren dies die Brüder Hans Jakob, des Rats und „burgerlicher Haimeter“ (Nr. 4/Waldschmidtstraße 6); Georg (Nr. 36/ Marktstraße 9), Bürger und Fuhrmann; Wolfgang, Handelsmann (Nr. 39/Blumengasse 1); Franz, auch Handelsmann (Nr. 50/Blumengasse 20); sowie Joseph Hastreiter, des Rats Bürgermeister (Nr. 59/Markstraße 13), uxoris nomine (im Namen seiner Frau) Theresia, sämtliche aus Eschlkam und letztlich Stefan Schreiner, Bürger und Metzger in Neukirchen b. Hl. Blut.Wir erkennen, dass die Witwe Anna Nürnberger, geb. Späth, von ihrer Geburt her der in Eschlkam ökonomisch gehobenen Schicht der „Hoamater“ oder „Haimeter“ angehörte. Damals kosteten beispielsweise ein Scheffel (222 Liter) Weizen 24 Gulden und ein kleiner Laib Brot 5 Kreuzer (60 Kreuzer zählten 1 Gulden). Der Taglohn eines Zimmermanns betrug z. B. 20 Kreuzer oder 1/3 Gulden. Die Kaufkraft eines 1 Gulden darf man um 1800 etwa mit 10 Euro von heute gleichsetzen.
Werner Perlinger
„Der Sarg möge aus Eichenholz gezimmert werden“ - das Testament von Anna Nürnberger im Jahr 1803
+Eschlkam. Anna Nürnberger, eine geb. Späth von Anwesen Nr. 4/Waldschmidtstraße 6 („Haimeter“), machte am 18. April 1794 ein Testament. Daraus seien einzelne Inhalte dem Leser vorgestellt, da sie uns auch einen Einblick in die Denkweise unserer Vorfahren vor mehr als 200 Jahren geben. Sie hatte in zweiter Ehe 1778 Simon, einen Sohn der Familie Nürnberger geheiratet, die damals in Ritzenried beheimatet war. Dazu sei ergänzend erwähnt, dass am 10. Oktober 1798 ein Mitglied dieser Familie, Simon Nürnberger, „Bauernssohn von Ritzenried“, um 2700 Gulden das erst kurz vorher errichtete erste Anwesen in der damals entstehenden Streusiedlung Daberg käuflich erwarb, der heutige „Simandlhof“ der Familie Nürnberger.
1798 übergab Anna Nürnberger als Witwe ihre bereits 1766 bei ihrer ersten Heirat mit Sebastian Hastreiter übernommene Behausung Nr. 36/Marktstraße 9 mit Inventar und zum Anwesen gehörenden Gründen im Schätzwert von 1000 Gulden an ihren Bruder Georg Späth und dessen Frau Katharina von Kleinaign. Das Haus allein war auf 435 Gulden eingeschätzt. Die reale Übergabe sollte aber erst nach ihrem Tod geschehen.
Auslöser für diesen Schritt der „Ausnahmsniesserin“ (sie lebt ausschließlich vom vereinbarten Austrag) ein Testament zu errichten, war eine „Unbößlichkeit (Krankheit), mit der sie befahlen worden“. Vor allem wollte sie spätere Erbschaftsstreitereien so vermeiden, denn die „Testatorin“ (Erblasserein) hatte vier Brüder: Georg, Wolfgang, Jakob und Franz Spätt und noch weitere Verwandte.
Alle damaligen Testamente beginnen mit der Präambel: „Im Namen der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, Gott des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes“.
- So soll ihr „entseelter Körper“ bei der hiesigen Pfarrkirche „zur Erde bestattet“ werden, auch die gewöhnlichen drei Gottesdienste jedes Mal mit zwei heiligen „Beymessen gehalten werden“. Das Grab sei mit einem eisernen Kreuz (damals geschmiedet und nicht gegossen) zu versehen. Der Sarg möge aus Eichenholz gezimmert werden. Aus beiden letzten Verfügungen lässt sich ein gegebener Wohlstand der Erblasserin erkennen.
- Für hl. Messen in Eschlkam und auch anderswo stiftete sie allein 100 Gulden.
- Dann wurde die Verteilung ihr noch verbliebener Grundstücke an nächste Verwandte niedergeschrieben.
- Als Universalerben setzte sie ihren Bruder Georg Spätt, „dermaligen Fuhrmann“ ein. Er durfte das gesamte von ihr hinterlassene Vermögen im Wert von 1000 Gulden an sich bringen. Davon musste er an seine Brüder und an Nichten einzelne Geldbeträge auszahlen. Bedacht wurde auch Wolfgang Nürnberger, „Söldner (Kleinbauer) zu Ritzenried mit 45 Gulden um seine Schuld gegenüber seinem Verwandten Jakob Spätt, „Haymether hierorts“ (Hsnr. 4) begleichen zu können.
- Aus der noch vorhandenen „Fahrnis“ (die Haushaltsgegenstände) wurden ein Paar Schuhe, „zwey Kittl, acht Hemetter, ein Fürtuch, zwei „Schnupftücher, Leinwa(n)d auf ein Hemd, das Beth worauf Testatorin lieget, ein kleines Beth“ verteilt. Weiter unterlagen der Verteilung noch vorhandenes „Gewandwerch“ (Gewänder), Häfen und Schüßeln. Das „schlechte Gewandwerch“ sei an die armen Leute zu geben.
Als „Executor Testamenti“ (Vollstrecker des letzten Willens) ernannte die Nürnberger den Marktmagistrat, „geschehen zu Eschelkam in einem Nebenzimmer: oder Schlafkammer“ am 18. April 1794.
Es unterschrieben Johann Georg Bärtl als „Vice Burgermeister“ (Nr. 63/Großaigner Straße 9) und Wolfgang Andräe Pach (Vater des Kunstmalers Alois Bach), Marktschreiber; dieser wohnte im Rathaus. Als Zeugen fungierten Georg Limböck (Nr. 56/Blumengasse 8), Wolfgang Leuttermann (Nr. 42/Blumengasse 7), Martin Fischer (Nr. 57/Blumengasse 4 und 6), Andre Lax (Nr. 52/Blumengasse 16), Andre Kilger (Nr. 58/Blumengasse 2), Andre Sauerer (Nr. 53/Blumengasse 14) und Michael Lax (Nr. 41/Blumengasse 5). Es wird noch eigens bemerkt, dass „diese (nach Limbök alle) weil sie des Schreibens unkündig, machen selbst zu ihren Namen die Zeichen“. Auffällig ist, dass bis auf einen Zeugen sämtliche aus der Blumengasse kamen, früher die „Hadergasse“.
Unerwartet lebte die Anna Nürnberger noch einige Jahre. Laut Inhalt der Sterbematrikel der Pfarrei verstarb die Witwe Anna Nürnberger, bezeichnet als „Ausnahmskramerin“, am 31. Juli 1803 im Alter von 78 Jahren an Entkräftung ohne dass ein Arzt beigezogen war. Der Hinweis „Ausnahmskramerin“ informiert uns, dass die Nürnberger früher im Markt auch eine Krämerei betrieben hatte. Es war dies das Anwesen Nr. 36, heute Marktstraße 9. Da die Abfassung ihres Testaments über neun Jahre zurücklag, sich demnach auch in familiärer Hinsicht bereits Veränderungen ergeben hatten, war nun, um eine gerechte Verteilung des Erbgutes zu ermöglichen, die schriftliche Aufnahme ihrer Hinterlassenschaft nötig. Diese wird in einem folgenden Beitrag dem Leser vorgestellt.
Werner Perlinger
Als Markt Eschlkam eine Choleraepidemie abwehrte
+Eschlkam. Seit längerer Zeit kämpft nicht nur Europa, sondern die ganze Welt, gegen die Covid-19-Pandemie und ihre Mutanten, eine in Europa im Februar 2020 erstmals aufgetretene Lungenerkrankung aus China. Verursacht wird sie durch das sog. Coronavirus und bezeichnet als Covid-19. Mit modernsten medizinischen Möglichkeiten kann diese „Seuche“ erfolgreich bekämpft werden. In früher Zeit musste sich der Mensch – und dies bei den damaligen medizinisch nahezu völlig unzulänglichen Mitteln – immer wieder gegen epidemisch auftretende Seuchen wehren, denken wir nur an die erste große Welle der verheerend sich auswirkenden Beulenpest um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Im Frühjahr 1634 grassierte im Hohenbogen-Winkel erneut die Pest. Etwa die Hälfte der Einwohner ging daran zugrunde. 1713 musste beispielsweise von der Marktgemeinde „wegen der im Königreich Böhaimb laidigen Contagion (Seuche) ein Wachtheusl vorm Markt gegen Stächesriedt (zu) gepauth werden“, um so den allgemeinen, vor allem von der Grenze her kommenden Verkehr überwachen zu können. Das gemauerte Häusl war Tag und Nacht besetzt. Seuchen traten immer wieder auf, darunter auch die gefürchteten Choleraepidemien.
Cholera („Gallenfluss“, Bezeichnung für ‚Durchfallserkrankung‘,von griechisch „Galle“, auch Cholera asiatica-asiatische Cholera) ist eine schwere bakterielle Infektionskrankheit vorwiegend des Dünndarms, die durch das Bakterium Vibrio cholerae verursacht wird. Die Infektion erfolgt zumeist über verunreinigtes Trinkwasser oder infizierte Nahrung. Die in Ostasien endemische Cholera („Cholera asiatica“, „Asiatische Cholera“, „Cholera Morbus“) trat auf dem indischen Subkontinent vermutlich (ausgehend vom Gangesdelta) über mehrere Jahrhunderte in Form lokal begrenzter Epidemien auf, war aber auf anderen Kontinenten unbekannt. Die erste Pandemie wütete im Zeitraum 1817 bis 1824 und betraf Teile Asiens sowie Ostafrika, Kleinasien und in Folge Russland und Europa. 1830 erschien sie in Ostgalizien und Ungarn, im Juni 1831 in Wien. Erste Erkrankungen in Deutschland erfolgten im gleichen Jahr. Der 1854 von dem englischen Arzt John Snow erbrachte Nachweis, dass eine Choleraepidemie im Londoner Stadtteil Soho in Zusammenhang mit verunreinigtem Trinkwasser stand, gilt als Geburtsstunde der modernen Epidemiologie. Man wusste nun wo diese Seuche ihren Ursprung hatte.
Ein Kordon verstärkt die Grenzwache
Mit der Cholera hatte sich im 1. Drittel des 19. Jahrhunderts erstmals der Markt Eschlkam zu beschäftigen, wenn zum Glück auch nur mittelbar auf der Ebene einer vorgezogenen entscheidenden und somit auch erfolgreichen Abwehr, denn Cholerafälle sind um das Jahr 1832 im Gemeindebereich selbst nicht aufgetreten. Erhalten hat sich im Archiv ein Akt aus dem Jahre 1831/32, betitelt mit „asiatische Cholera betrff“. Die gefürchtete Seuche war im Nachbarland Böhmen ausgebrochen, das damals zum Herrschaftsgebiet des Hauses Habsburg mit Sitz in Wien gehörte. Daher wurden gezielte Vorkehrungen getroffen um ein Übergreifen in den bayerischen Raum zu vermeiden. So wurden vom „königl. bay. 4. Regiment der 1. Füselier (=Infantrie) Kompagnie zur Verstärkung der Grenzschutzwache ein Leutnant und 10 Mann hier stationiert, die am 28. Oktober eingetroffen und den 29. Dezember 1831 hier wieder abgegangen sind“. Davon waren neun Mann in der „Joseph Lembergerischen Behausung kaserniert“. Eine weitere Gruppe war beim Metzger Joseph Scheppel untergebracht. Diese Mannschaft wird amtlich auch als „Kordon“ (Absperrung der Grenze durch eine eng gestaffelte Postenkette) bezeichnet und sie diente allein der Verstärkung der vorhandenen Grenzmannschaft.
Die Hausbesitzer mussten dafür sorgen, dass die Bediensteten ordentlich versorgt wurden und jeweils abends eine warme Stube genießen konnten. Die Kosten dafür wurden nach genauer Aufstellung vom Staat ordnungsgemäß erstattet, so die Aktenlage.
Im Jahr darauf, 1832, wiederholte sich das ganze Prozedere. Die meisten der „kasernierten Kordonsmannschaft“ waren wiederum bei dem Bäcker Joseph Lemberger (Nr. 37/38-Marktstraße 11, vulgo „Brücklbäck“) und dem Metzger Scheppel (Nr. 34-Marktstraße 5-heute Ludwig Weber-Haus) untergebracht. Die Anwesen lagen verkehrlich günstig, da die Straße, an der sie liegen als Vicinalstraße (Haupt- oder Handelsstraße) direkt nach Neuaign und zur Grenze führt. Zugleich aber informiert uns eine Liste, dass zum 30. Juli hin Mitglieder des sog. „Sanitäts-Kordons“ bei weiteren zwei Dutzend Bürgern untergebracht waren, wenn auch nur für einen Tag. Das lässt auf eine kurzzeitige, aber sehr umfangreiche Kontrolle des Grenzgebietes von Neuaign schließen.
Von dieser Epidemie blieb das Land glücklicherweise verschont, denn weitere Maßnahmen von Einquartierungen waren nicht mehr nötig. Choleraepidemien traten in Bayern in der Folgezeit immer wieder auf. Daher sei ein Vorgang erwähnt, der sich vier Jahrzehnte später wegen eines Choleraausbruchs in München ereignete, hier mit einem engen Bezug zu unserer Heimat.
Die bayerischen Prinzen bei uns
Dr. Karl von Reinhardstoettner (1847-1909), ein in seiner Zeit sehr anerkannter Altphilologe und Gutsbesitzer in Lixenried, hat sich als Gelehrter und Wissenschaftler, aber auch als kulturgeschichtlicher Schriftsteller einen bedeutenden Namen gemacht. Als Professor an der Hochschule in München war er auch Erzieher der bayerischen Prinzen Ludwig Ferdinand und Alfons. Deren Vater war Adalbert von Bayern aus dem Hause Wittelsbach, ein Sohn König Ludwig I. Die beiden jungen Prinzen haben das Bergdorf Lixenried, seit 1972 eingemeindet in die Stadt Furth im Wald, wegen einer in der damals schon großen Stadt München grassierenden Choleraepidemie zweimal besucht, zuletzt im Jahr 1873. So konnte der Erzieher Karl von Reinhardstoettner beiden jungen Prinzen aus dem bayerischen Königshause auf seinem Gutsbesitz, im sog. „alten Schloß“, ehemals Sitz der Hofmark, über einen gewissen Zeitraum sicheres Asyl vor der gefährlichen Epidemie anbieten.
Werner Perlinger
Der versuchte Verkauf des Marktschreiber-Stadels
+Eschlkam. Wir befinden uns in der schon beschriebenen zeitlichen Phase, als allein der Marktschreiber im Jahre 1810 Franz de Paula Pach als Kommunaladministrator die Geschicke des Marktes anstelle des Bürgermeisters lenkte (siehe dazu Artikel „Als der Marktschreiber und nicht der Bürgermeister den Markt regierte“). Geld sollte in die stets klamme Kasse der Kommune kommen, da wurde der Versuch unternommen den sog. Marktschreiber-Stadel an privat zu veräußern. Im Liquidationsplan von 1840 ist dieser Stadel noch existent und unmittelbar hinter dem Rathaus eingezeichnet. Mit einer Front lag er direkt am Waldschmidtplatz, mit der anderen Seite an der Rathausgasse. An seiner Stelle befindet sich heute das Tourismusbüro, integriert in das „Waldschmidt-Haus“.
„Akt der Kommunaladministration Eschelkamm - den in das Privateigenthum nicht geeigenschafteten sondern für den Dienst der Gemeinde nothwendigen Marktschreiber / Communalstadels / betreff.“, lautet das Thema eines Aktes aus dem Jahre 1810. Im Namen seiner Majestät des Königs (Max I. Joseph) gab am 14. Juli das Königliche General Commissariat des Regenkreises als Kommunal Curatel mit Sitz in Straubing an die K(öniglich). B(ayerische). provisorische Kommunal Administration Eschlkamm“ den Auftrag „den dortigen sogenannten Marktschreibers Stadel insofern selben zum Übergang in das Privateigenthum geeigenschaftet (als geeignet), und für den Dienst der Gemeinde nicht nothwendig ist, der öffentlichen Versteigerung“ zuzuführen.
Die Marktschreiber wohnten immer als geschäftsführende Beamte der Gemeinde im Rathause. Er durfte seit jeher als mögliche wirtschaftliche Grundlage in Notzeiten im angrenzenden Stadelgebäude für sich zumindest eine Kuh halten und dort auch das nötige Trockenfutter und Gerätschaften lagern. Zu Beginn der napoleonischen Ära aber hat der Marktschreiber aus wirtschaftlichen Gründen auf dieses Privileg wohl bereits verzichtet.
Aktiv wurde die übergeordnete Behörde, weil sich an sie der Bürger und Uhrmacher Wolfgang Stauber wegen der Absicht den Stadel zu kaufen „selbst bey der allerhöchsten Stelle allunterthänigst gemeldet“ hatte. Die Uhrmacherfamilie Stauber lebte seit 1761 im Anwesen Nr. 22, heute nicht mehr existent, vielmehr aufgegangen in Anwesen Nr. 23/Marktstraße 2. Die Fleischbank für die Metzger und das Brothaus lagen damals als gemauertes Haus, versehen mit einem Legschindeldach zwischen dem Rathaus und dem räumlich sehr engfängigen Anwesen Stauber. Aufgrund dieser Lage hatte der Uhrmacher Stauber ein Interesse daran den schräg hinter seinem Haus liegenden kleinen Stadel zu erwerben. Der Hinweis „was immer für einen Preis“ Stauber zahlen wolle, macht deutlich, dass es der übergeordneten Behörde ein Anliegen war, dass ein Kauf zustande kam und die Kommune sich von dieser mittlerweile offenbar nutzlosen Immobilie trenne. Dennoch: „sollten aber Umstände obwalten, die den Übergang dieser Realität in das Privateigenthum hinderten, so sind diese folglich berichtlich anzuzeigen“. Und so geschah es denn auch.
Die Bürger wurden gefragt
Gut eine Woche später, am 22. Juli, wurden auf das Rathaus „die Gemeindeglieder (die Bürger) berufen“ und fragte, ob sie „die erwähnte Realität (der Stadel) entbehrlich und zum Übergang in das Privateigenthum geeigenschaftet erkennen“. Die Bürger aber wandten wohl unerwartet dagegen ein,
1. dass der Stadel „ein schickliches Lokal für Unterbringung und Sicherheitsstellung der Feuerlöschgeräte“ abgebe, „da mit der Zeit so ein eigenes Remiß (Wagen- und Geräteschuppen) auferbaut werden müßte und in der Hauptsache (es) an einem Platz hierzu fehlt“.
2. Auch würde der Stadel in Kriegszeiten gute Dienste leisten, „indem selber zu einem Magazinstadel gebraucht werden kann, und auch gebraucht worden ist, um einen Bürgermann von den so vielen Anfällen (Vorkommen) einer Fourage (Abgabe von Pferdefutter bzw. Verpflegung für die Truppe) Begehung zu befreien und von Beraubung selbst seins wenigen zu schützen“.
Als drittes Argument wurde vorgebracht, dass „ nun die Wohlfahrt einer ganzen Gemeinde und nicht das Interesse eines einzelnen Gemeindeglieds zu berücksichtigen ist, so gründet sich dabei die Hoffnung, dieser Stadel werde bei seiner alten Eigenschaft bleiben, somit der Bürgerschaft zum Dienst überlaßen werden“.
Mit dieser letzten Stellungnahme wurde das „Protokoll beschloßen und zu mehrerer Bekräftigung dessen von des Schreibens kundigen (Bürgern) unterzeichnet“.Die Zeit verstrich und an das Königliche General Commissariat berichtete der Marktschreiber erst am 17. Juli 1811 – ungefähr ein Jahr vor Beginn Kaiser Napoleon‘s katastrophalen Rußlandfeldzug - dass der Beschluss der Bürger akzeptiert werde, nachdem sie „das Communal Vermögen keineswegs schmälern, sondern zu vermeliorieren (verbessern) die Absicht hätten, so dürfte dieser Stadel , nachdem sie solchen zu ihrem Gebrauch vonnöthen hat, in allen höchsten Gnaden überlaßen werden“. Mit den abschließenden Worten „der ich in tiefster Ehrfurcht bin aller gehorsamster“ endet der Brief des Marktschreibers an das General Kommissariat.
Am 29. Juli antwortete abschließend Regensburg, aufgrund der „einberichteten Umstände kann der Verkauf des sog. Marktschreibers Stadl einstweil unterbleiben und soll zu dem angezeigten Zwecke noch ferners verwendet werden“. Noch längere Zeit musste sich die Familie Stauber mit ihrer sehr engen Wohnlage zufriedengeben. Erst 1854 erwarb der Uhrmacher Joseph Stauber durch einen Tausch mit Anton Pfeffer das Anwesen N. 59/Marktstraße 13. Der Hausname „beim Uhrmacher“ wanderte damals von Nr. 22 zu Anwesen Markstraße 13. Die Stauber sind noch in Besitz dieses Hauses.
Werner Perlinger
Dem Marktschreiber Veith Adam Wurzer wird der Dienst aufgekündigt
+Eschlkam. Unter dem Titel „höchsbenötigtes Anbringen“ erklärt am 4. Juni 1698 der gerade amtierende Bürgermeister Wolf Sighardt Altmann vor dem Marktrat, dass er „wider alles Verhoffen von frembten Leuthen vernemmen missen“, dass der Marktschreiber Veith Adam Wurzer zuhause und auch andernorts „im Beisein ehrlicher Leith“ nicht nur höchst ehrenrühriges, sondern auch für „sein Leibs und Lebens bethrohliche Wortt öffentlich ausgestossen haben solle.“ Er gedenke dies alles nicht auf sich sitzen zu lassen. Er bat um eidliche Einvernahme der Bürger und „Rhats Freundt“ (Ratsmitglieder), die Wurzers sprachliche Verfehlungen ihm gegenüber gehört hätten.
Vier Wochen später, am 3. Juli, lautet der Titel der Niederschrift über eine Ratssitzung: „Dienstaufkhündtung.“ Demnach „wollen Bürgermeister und Räte aus erheblichen Ursachen ihren bisher gewesten Marckhtschreiber Veith Adam Wurzer den Marckhtschreiber Dienst dergestalten aufgekhündt haben, daß er auf nechsten Michaeli (29. September) abtretten, und alle zur Marktschreiberey gehörige Sachen zur Registratur übergeben solle“ - ein amtlich sehr heikler, aber auch höchst seltener Vorgang, der bei den Bewohnern im Markte sicher für einige Unruhe gesorgt hatte.
Was waren nun die „erheblichen Ursachen“, wird sich der Leser fragen, wenn neben dem gerade amtierenden Bürgermeister Wolf Sighardt Altmann, Inhaber eines „Hoamaterhofes“ (Nr. 1/ Waldschmidtstraße 14) und dem Pfarrer der eigentlich bedeutendste Mann im Markte aufgefordert wird, seinen Dienst baldmöglichst zu quittieren. Den Grund für die abrupte Entlassung aus dem Dienst vermittelt uns die detaillierte Niederschrift über die in dieser Sache abgehaltene „Zeugensag, so zwischen Wolf Sighardt Altmann, Burgermeister alhir, dann Veith Adam Wurzer Marckhtschreibern alda von oberrigkheitswegen eingeholt worden, dem 3. Juli“. Es ging um „underschidtliche Bedrohungen und anderes“, so die marginale Erläuterung im Protokoll. Der 1. Zeuge war Wolf Korherr, Bürger und Mitglied des „Äußeren Rates“ (Kufner auf Nr. 10/ Kleinaigner Straße 5). Er gab an, er sei bei dieser Angelegenheit nicht mehr dabei gewesen und habe „weder Gutes noch Böses gehört“. Der 2. Zeuge, Hans Späth, auch Mitglied des „Äußeren Rats (Nr. 5/Further Straße 3)“ sagte aus, er habe vom Marktschreiber in seiner Wohnstuben vernommen, es gebe einen, der den Markt allein regieren und „über ain Hauffen werffen wolte“. Wurzer habe dann „2 Khigl aus dem Peitl“ genommen mit dem Hinweis, ehe dies geschehe, so der Zeuge Späth, „wolts er solchen (Wurzer) in sein Leib schießen“. Der 3. Zeuge, der Bürger Simon Stephan berichtete, der Herr Marktschreiber habe in seinem Haus gesagt, Herr Altmann habe „in des Herrn Lährnpöchers Burgermeisters Stubn geredt, er wolle sein(en) Kopf nit mehr aufflegen, bis daß alhier ainer allein den Marckht regiert“. Darauf antwortete Wurzer, „Herr Vetter, da hab ich ain Paar Khigl in meinem Peitl“, und er sagte hierauf „er wolle solchem (dem Altmann) vor den Khopf schiessen und (dann) dem Ungerlandt (Ungarn) zuereiden, er waiß den Weg gahr wohl“. (Sein) „Weib und Kind“ wolle er „siezen (zurück) lassen“. Als 4. und letzter Zeuge gab der Bäcker Hans Vogl (Nr. 58/Blumengasse 2) an, Wurzer habe gesagt, „wann er von der Markhtschreiberey khommen sollte, mechte er khainen Rhatsfreundt (Gemeinderat) nit abgeben oder sich (dafür) prauchen lassen weill ainer allainig den Marckht regieren wolte, (er) wolle auch ain solchem 2 Khigl in sein Leib schiessen“. Damit enden im Ratsprotokoll dazu die Aussagen. Wie zu erkennen, hatte sich der heftige Streit zwischen dem Bürgermeister und Wurzer entzündet als ein Gerangel wohl um Kompetenzen bei Entscheidungen.
Den Fall weitergeleitet
Erst Monate später erfahren wir aus der Ratssitzung vom 17. Oktober, dass Altmann dem Marktschreiber einst Akten, betreffend Hans Christoph Tenzl und den Mesner Wolf Khinninger, „zum Verbrennen gegeben habe“, was aber dann nicht geschah, denn sie haben sich an diesem Tag wieder gefunden. Vielmehr sei der Vorgang, den Tenzl betreffend, diesem von Wurzer gegeben, der andere hinsichtlich des Mesners aber dem „Canzlisten“ Häberl in München „eingehendigt“ worden, was aber dem Bürgermeister Altmann äußerst missfiel. Der Marktrat bestand darauf, dass die ehrenrührige Bezichtigung Wurzers gegenüber Altmann, geschehen aus „hitzigen Erzürnen, ex officio aufgehebt“ (von Amts wegen) und Wurzer den Auftrag erhielt gegenüber Altmann „Abbitt zu thun“.
Insgesamt hätte sich der Marktrat schon von Anfang an aus der unliebsamen Affäre zurückgezogen mit dem Hinweis: „Weilen die Abwandlung (wegen der Androhung der Tötung) dem churfürstlichen Pfleggericht (damals in Neukirchen b. Hl. Blut) gehöret, also würdt diese hiermit cassieret und durchstrichen.“ Das höhere Gericht aber gab den Fall an die Gemeinde wieder zurück und schließlich wurden beide Parteien, Wurzer und Altmann, nach längerem Hin und Her wegen gegenseitigen „muthwilligen Anbringens, so aus lautter Passion (Leidenschaft) und Hizigkheit“ geschehen verwiesen, zu einer Geldstrafe in Höhe von 6 Reichstalern verurteilt.
Die Entlassung aus dem Dienst, das für Wurzer weit höhere Übel aber blieb bestehen, da das persönliche Verhältnis zu Bürgermeister Altmann so zerrüttet war, dass ein amtlich-kollegiales Miteinander nicht mehr möglich war.
Aus Straubing zugezogen
Abschließend einiges zur Person Marktschreibers: Als Sohn eines Brauers in Straubing geboren kam Vitus Adam Wurzer als gelernter Gerichtsschreiber nach Eschlkam und ehelichte am 29. Mai 1686 Anna Klara Tenzl. Deren Vater war Wolfgang Tenzl, damaliger „archigrammaticus emmeritus“ (Marktschreiber im Ruhestand) und Besitzer des „Hoamaterhofes“ (Nr. 3/Wald- schmidtstraße 8). Vielleicht kam Wurzer auf Bestreben des alten Tenzl, eben weil durch ihn die Stelle freigeworden war, nach Eschlkam und wurde so dessen Nachfolger. Der Ehe mit Klara Tenzl entsprossen bis 1697 sechs Kinder, so die Taufmatrikel. 1687, am 7. Juli, wird Veith Adam Wurzer erstmals als Marktschreiber genannt. Er wohnte von seiner Funktion her mit seiner Familie herkömmlicherweise vorerst im Rathaus. Das Bürgerrecht erhält Wurzer am 11. Juni 1691 nachdem er die Behausung des (+) Kufners Valentin Harlfinger (Nr. 17/Kleinaigner Straße 4) käuflich erworben hatte und so hausansässig wurde. 1694, am 29. März, wird Wurzer als „Gandtmann“ bezeichnet. Wie und wieso er in den wirtschaftlichen Ruin geriet, ist nicht überliefert. Am 27. August 1694 kauft Georg Tenzl, Bäcker und Bürgersohn (der Schwager Wurzers), die Behausung von Veith Adam Wurzer, Marktschreiber „allhie zu Eschlcamb“ für 475 Gulden. In der Folgezeit wohnt Wurzer bis zu seiner Dienstentpflichtung 1698 wieder im Rathaus. Über das weitere Schicksal schweigen die Akten. Er tritt nicht mehr in Erscheinung. 1706 wird in der Kammerrechnung vom „gewesten Burger und Gastgeber Wurzer“ berichtet, was nicht bedeutet, dass er bereits verstorben ist, denn zum 10. März 1732 lautet ein Sterbeeintrag: Dominus (Herr) Vitus Adamus Wurzer, churbayerischer Leutant. Demnach verließ Wurzer noch vor 1706 den Markt, trat in militärische Dienste ein, kehrte aber vor seinem Tod nach Eschlkam zurück.
Werner Perlinger
Als der Markt Eschlkam eine „Leichenordnung“ bekam
+Eschlkam. Wir schreiben das Jahr 1875. Am 26. Mai erließ der Markgemeinderat eine für alle Gemeindebewohner verbindliche in 13 Paragraphen verfasste Ordnung für den Umgang mit den Verstorbenen vom Eintritt des Todes bis zur Beerdigung. Verordnungen dieser Art waren nötig geworden, nachdem es damals auf dem Lande noch keine Leichenhäuser gab und die Toten bei jeder Witterung zu Hause bis zur Beerdigung aufgebahrt werden mussten. Dazu hatte die Marktgemeinde bereits am 26. September 1871 eine in 13 Paragraphen gefasste ortspolizeiliche Vorschrift erlassen, die dann am 26. Mai 1875 als „Leichenordnung“ offiziell vorgestellt wurde.
Demnach musste bei einem Todesfall in einem Hause in längstens zwei Stunden die „Seelnonne (heute die Leichenfrau) zu den an der Leiche notwendigen Verrichtungen gerufen werden, sofern dieselben nicht von den Angehörigen des Verstorbenen besorgt werden wollen“. Gemeint ist die Waschung und das Ankleiden sowie die Aufbahrung des Toten in einem Zimmer des Hauses, aber auch die Bekanntmachung des Todesfalles durch das „Umgehen“ (bekanntmachen eines Todesfalls) in einer Zeit als es vor allem auf dem Lande noch keine Tageszeitungen gab. Wurde die Leiche aus dem Zimmer gebracht, musste der Raum mehrere Stunden lang gelüftet werden. Auch waren die Betten und Kleidungsstücke, „mit denen die Leiche in Berührung war“ vor deren Wiederverwendung „durch Auswaschen gehörig zu reinigen“. Der Verfasser selbst hat mehrmals bemerkt, dass es auch üblich war, diese textilen Überreste im Umfeld des Hofes oder Hauses auf sonstiger freier Fläche zu verbrennen.
Das „Aufbleibn“ bei einem Toten
1894, am 8. Dezember, erließ der Gemeindeausschuss folgende ortspolizeiliche Vorschrift: Das oft mehrere Stunden andauernde Totengebet bei einem Verstorbenen – man nannte es das „Aufbleibn“ - darf nicht in dem Lokale, wo die Leiche liegt abgehalten werden. Schulkinder durften daran nicht teilnehmen. Verboten war auch „alles Zechen vor, während oder nach dem Totengebete“. Auch war das Zimmer, in dem die Leiche lag, stark zu lüften, ebenso der Fußboden gründlich zu reinigen. Gerade in der warmen Jahreszeit kam es vor, dass die Leichen „übergingen“, in dem ihre Körpersäfte bis zur Einsargung zu Boden abtropften. Auch mussten Leichen welche nicht zu Hause sondern in einem Krankenhaus oder Spital an einer ansteckender Krankheit verstarben, unmittelbar in das Leichenhaus, oder – sofern ein solches nicht vorhanden - in ein hierzu geeignetes „Seelhaus“ am Friedhofsgelände verbracht werden. Keinesfalls durfte der Tote zurück in das eigene Haus gebracht werden.
Im Friedhof von Eschlkam war festgelegt, die Gräber mit nummerierten Holzpflöcken zu versehen. Die „Umtriebszeit“ – die Zeit bis der Verwesungsprozess endete und ein Grab für eine neue Beerdigung geöffnet werden durfte – betrug damals für Erwachsene und Kinder über zehn Jahren zehn Jahre; für jüngere Kinder nur sechs Jahre. Auch war bestimmt, dass Kinder nur in einem dafür bestimmten Teil des Friedhofs, im sog. „Kinderfriedhof“ beerdigt werden. Wegen Platzmangel begrenzt war die „Errichtung von Familiengrabstätten“. Die Fläche von zwei Gräbern durfte nicht überschritten werden.
Gestattet wurde die Aufstellung von Denkmälern, räumlich begrenzt aber auf die betreffende Grabfläche. Gemeint sind hier die heute üblichen Grabsteine. Früher waren sie aus Kostengründen noch selten anzutreffen. Vielmehr zierten meist nur hölzerne oder auch schmiedeeiserne Kreuze die Gräber. Erlaubt war den Angehörigen der Verstorbenen für diese Gedenktafeln an der „Umfassungsmauer des Friedhofes sowie an der äußeren Kirchenmauer“ anzubringen. Andererseits mussten Grabdenkmäler von den „Turnusgräbern“ nach Ablauf der Umstriebszeit entfernt werden. Ausgenommen davon waren die Familiengräber.
Genau regelte die Marktführung wer in einer Familiengrabstätte seine letzte Ruhe finden durfte. Es waren dies: der Erwerber der Grabstätte, die Ehefrau sowie die Kinder, Enkel, Eltern und Geschwister. Demnach durften auch die im Kindsalter verstorbenen Familienangehörigen im Kreise ihrer Angehörigen die letzte Ruhe finden. Das Privileg „Familiengrab“ endete nach 30 Jahren, wenn für eine Verlängerung die Grabgebühren dafür nicht mehr entrichtet worden sind. „Ein Familiengrab verliert diese Eigenschaft und kehrt in die Reihe der Turnusgräber zurück“, so die Bestimmung in §10. Gestattet war es auch, die Grabstätten mit Blumen und Sträuchern zu bepflanzen.
Das Grabregister
Allein der Totengräber war beauftragt, ein Grabregister zu führen und „evident“ zu halten, in welches unmittelbar nach der Beerdigung die Nr. des neu eröffneten Grabes, Name, Stand, Alter und Wohnort der beerdigten Person sowie der Tag und die Stunde der Beerdigung einzutragen waren. Dies hatte die Gemeindebehörde zu kontrollieren, bei der auch „der über die Kirchhofanlagen gefertigte Kartenplan zu Jedermanns Einsicht hinterlegt ist“. Übertretungen dieser „Leichenordnung“ wurden „mit Geld bis zu 30 Thalern, oder mit Haft bis zu 30 Tagen geahndet“. Ein solches Register wurde bereits 1866 dem Totengräber aufgetragen (siehe dazu den Bericht „Vergabe des Totengräberdienstes im 19. Jahrhundert“).
Die Königliche Regierung von Niederbayern bestätigte den geplanten Vollzug der neuen Friedhofsordnung am 16. Juli 1875, was den damaligen Bürgermeister Pfeffer am 8. April 1876 veranlasste dies nochmals zu bestätigen. Die Verordnung vom Jahr 1875 erscheint für ihre Zeit als sehr modern. Probleme gab es trotzdem, vor allem wenn in der warmen Jahreszeit die Toten mangels eines Leichenhauses mindestens zwei Tage zu Hause aufgebahrt werden mussten. Streng geregelt, aber nicht in den aufgeführten Statuten, war die Leichenschau. 1877 war in Eschlkam der Bader Jakob Herzog verstorben. Nachfolger wurde sein gleichnamiger Sohn, der als „approbierter Badergehilfe“ das Geschäft seines Vaters übernommen hatte. Der approbierte Bader war im Gegensatz zum heutigen Friseur für seine Zeit als „Arzt des kleinen Mannes“ medizinisch gebildet und so für die Feststellung des Todeszeitpunktes bzw. die Untersuchung der Toten in Ermangelung eines Arztes am Ort prädestiniert.
Werner Perlinger
Österreichische Truppen mussten gut verpflegt werden
+Eschlkam. Die Napoleonischen Kriege (1799-1815) verändern das Gesicht Europas: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, eine seit Jahrhunderten sakral legitimierte Staatsform, löst sich 1806 unter dem Druck Napoleons auf. Europa wird politisch und territorial neu geordnet. Mehrmals gerät Bayern in Gefahr im Konflikt zwischen Frankreich und Österreich als eigenständiger Staat aufgelöst zu werden. So stand im Jahr 1805 die Zukunft des bayerischen Kurfürstentums unter Max Joseph IV. auf der Kippe. Deshalb unterzeichnete der Kurfürst einen Vertrag mit Napoleon. Man begab sich in die schützenden Arme Frankreichs - und setzte so aufs richtige Pferd. Die Franzosen jagten die Österreicher noch im Herbst 1805 aus Bayern hinaus. Bayern stieg am 1. Januar 1806 zum Königreich auf. So viel zur damaligen politischen Situation nach 1800, die auch unsere Grenzregion betraf.
Haben wir im Artikel „Napoleons Kriege“ über die Quartierlasten während der Napoleonischen Kriege zwischen 1813 und 1815 berichtet, die Jahre später 1822 abgegolten wurden, so seien aufgrund eines weiteren Fundes im Marktarchiv einzelne Belastungen der Eschlkamer Bürger zum Teil dargelegt, die Napoleons Kriegshandlungen gegen die damalige Großmacht Österreich bereits in den Jahren 1805/06 verursachten. Diese Belastungen bei all diesen großimperialen Bestrebungen hatten die Untertanen zu tragen - und oft geschah es, dass die bei Aushebungen von Materialien für die Kriegsführung entstandenen Verluste später, wenn, nur wenig oder oft auch gar nicht ersetzt wurden.
Gut verpflegt
Am 29. und 30. November 1805 wurden die 64 hausbesitzenden Bürger auf das Rathaus geladen. Sie mussten zunächst detailliert „wegen der von den französischen Truppen getragenen Quartieren am 13., 14., 15. und 16. November und dadurch entstandenen Kösten“ entsprechend einem Fragenkatalog (bezeichnet als Patent), übermittelt vom Landgericht Kötzting, genau berichten. Die feste Verpflegung für jeden einzelnen Soldaten, so erfahren wir, bestand täglich aus Suppe, reichlich Rindfleisch, Kartoffeln und Gemüse „und nebenbei mussten auch Bier, Wein, Caffee, Rosoglio (feiner Rosenlikör) und Branntwein credenzt werden“, aufgeteilt als Frühstück, Mittag- und Abendessen. Ein Offizier kostete dem „Hausvater“ (Quartiergeber) täglich 3 Gulden; nur 1 Gulden 30 Kreuzer der „gemeine Mann“. Zugleich lebte der beherbergende Hausherr gewiss weit genügsamer. Insgesamt kostete diese Maßnahme der Bürgerschaft insgesamt 2244 Gulden. Eine Begleichung dieser Ausgaben nennt der Akt nicht.
Am 2. Dezember 1805 werden wiederum die von österreichischen Truppen verursachten Kriegsschäden aufgelistet. So schildern an Eidesstatt Joseph Schreiner, „burgerlicher Haimeter“ (damals in Nr. 37/Marktstraße 11) und Joseph Schöppel, „Gastgeb“ (Nr.34/Marktstraße 5), dass am 6. November der österreichische Dragoner Oberleutnant von Heimer mit 22 Mann in den Markt gekommen sei. Es wurden ihm 1¾ Zentner Heu (für Pferde) ausgehändigt. Am 8. November kam er erneut mit 7 Mann nachts um halb zwölf Uhr. Gegeben wurden 15 Laib Brot a 4 Pfund, 30 Maß Bier, ferner Hafer und wiederum Heu für die Pferde. Das alles wurde von den Österreichern nach „Böhmisch Neumarkt abgefahren“.
Die Pferdebesitzer des Marktes
Über „die im Krieg zu Verlust gegangenen Pferde, und die Beschreibung des dermaligen (jetzigen) Pferdestandes betrff.“, niedergeschrieben im Auftrag und Anweisung des königl. Landgerichts Kötzting vom 13. April 1806, lautet der Titel eines Schriftstücks. Insgesamt werden von den Marktbürgern als nicht verlorener sondern derzeitiger „Pferdebestand“ 18 Tiere angegeben. Jeweils zwei Pferde besaßen in diesem Jahr die Ökonomiebürger Joseph Weber (Nr. 1/Waldschmidtplatz 14), Joseph Pfeffer, Fuhrmann (Nr. 50/Blumengasse 20) und Franz Fischer, Fuhrmann (Nr. 57/Blumengasse 4 u.6.). Während Weber (heute Penzkofer) damals der begütertste Landwirt und zugleich Gastgeber war, verdienten Pfeffer und Fischer als Fuhrleute ihr Brot. Nur ein Pferd dagegen besaßen Jakob Späth (Nr. 4/Waldschmidtplatz 6), Franz Späth, Metzger (Nr. 5/Further Straße 3), Franz Retzer, Bäcker (Nr. 19/Further Straße 4 und 6), Michael Schamberger, Hufschmied (Nr. 6/Kleinaigner Straße 1), Andre Penzkofer, Müller (Nr. 45/Penzenmühle 1-3), Anton Hastreiter, Müller (Nr. 46/Bäckermühle 1-2), Joseph Schreiner („Hoamater“ Nr. 37/Marktstraße 11), Johann Georg Schreiner, Seifensieder (Nr. 35/Marktstraße 7), Joseph Scheppel, Metzger (Nr. 34/Marktstraße 5), Anton Prückl, Gastgeber und Krämer (Nr. 60/Marktstraße 15), Mathias Bärtl, Krämer (Nr. 25/Waldschmidtplatz 8) und Anton Kolbeck, Landwirt („Hoamater“ Nr. 3/Waldschmidtstraße 8).
Entschädigung erbeten
Erbetene Entschädigungszahlungen aus Kriegshandlungen ließen stets auf sich warten. In einem letzten, sehr höflich formulierten Bittbrief vom 15. April 1806 an den Reichsfreiherrn Joseph von Pechmann (Landrichter in Kötzting von 1803-1820 – der Name ist im Brief nicht genannt) baten die Eschlkamer, er möge sich doch an ihr Schreiben vom 30. März erinnern und „hochgnädig geruhen zu wollen“ die wegen der österreichischen Truppen ausgegebenen 204 Gulden 46 Kreuzer „umso mehr flüssig machen zu lassen, als der Magistrat nur allein durch diesen Ersatz sich den Grobheiten der Bürgerschaft erübrigen kann“. Zugleich lieferten sie mit diesem Schreiben „sechs Stück Kärpfen“ (Karpfen), gefischt aus dem großen Weiher in Schachten, um „den hohen Herrn zu bewegen“, ihnen den genannten Betrag zukommen zu lassen. Damit endet der Akt. Es darf angenommen werden, dass die Bürger keine Entschädigung erhielten, da ein Dankesschreiben bzw. eine Bestätigung darüber fehlt. Man kann sich vorstellen, betrachten wir nur die Situationsschilderung im letzten Schreiben, wie im Markt und auch anderswo infolge der Kriege der Mächtigen gegeneinander die Volksseele wegen der dabei schuldlos erlittenen materiellen Verluste hochkochte. Es waren dies für die Untertanen Verluste die fast nie ersetzt wurden.
Werner Perlinger
Die Landwehrmänner des Marktes Eschlkam
+Eschlkam. Obwohl sich im Archiv des Marktes zum Thema >Landwehr< nur wenige Unterlagen befinden, seien dazu doch einige Informationen dem Leser nahegebracht, da diese Einrichtung nach den napoleonischen Kriegen in Bayen und gerade auch im Hohenbogen-Winkel eine nicht unerhebliche Bedeutung hatte. Das Wort >Landwehr< ist ein Begriff aus dem Militärwesen, der je nach Staat oder Gebiet unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann. Häufig geht es um einem stehenden Heer beigeordnete milizartige Verbände oder Einheiten aus Reservisten älterer Jahrgänge. Die Landwehr war neben dem „Stehenden Heer“ ein Teil des Heeres insgesamt. In Staaten wie Bayern blieb damals die Aufstellung der Landwehr noch gleichbedeutend mit der Einziehung von Freiwilligen (Landsturm und Freikorps, freiwillige Jäger). 1809 wurde nach französischem Vorbild eine Nationalgarde mit drei Klassen aufgebaut (1. Klasse: Reservebataillone der Linienregimenter, 2. Klasse: Landwehr, 3. Klasse: Bürgermilitär). Die Nationalgarde wurde von 1814 bis 1816 in die Landwehr des Königreichs Bayern umgewandelt. Diese neue Einrichtung sollte dem aktiven, stehenden Heer als Reserve dienen. Die Dienstpflicht erstreckte sich bis zum 55. Lebensjahr. In ihren Grundzügen hielt sich die Heeresverfassung bis zum Jahre 1868. Die Mitglieder der Landwehr glänzten besonders bei ihrer Teilnahme an den Fronleichnamsprozessionen.
Die Eidesformel
Die Landwehrmänner mussten vor ihrer Aufnahme in das Korps einen heiligen Eid leisten. Die Eidesformel, überliefert vom 31. Oktober 1825, lautet: „Wir schwören zu Gott dem Allmächtigen einen körperlichen Eid, daß wir wollen Treu und Hold sein, dem allerdurchläuchtigsten und großmächtigsten König und Herrn Ludwig Karl August (König Ludwig I. von Bayern, Regent 1825-1848) als ihren allergnädigsten Monarchen, daß sie allerhöchst desselben erhabendste Person und Königl. Haus und ihr Vaterland rühmlich und tapfer vertheidigen, und sich stetts so betragen wollen, wie es braven Bürgern und guten Unterthanen obliegt, und ihm Pflicht gebührt. Alles dieses, so ich wohl verstanden habe, will ich getreu befolgen, so wahr mir Gott helfe, und sein heiliges Wort.“ Demnach wurde bei der Aufnahme den zu verpflichteten Männern, die wegen der notwendigen Dienstfähigkeit nicht über 40 Jahre alt sein durften, der Text öffentlich vorgelesen und dann der Eid abgenommen.
Eine Dienstbefreiung war möglich
1835, am 13. April hat der Markt an die „Königlich bayerische Oeconomie Komißion des Königlichen Landwehr Bataillons Kötzting“ 18 Gulden 54 Kreuzer einbezahlt, und zwar von den Reluitions-Pflichtigen der III. Companie Eschlkam. „Reluition“ bedeutet die Ablösung einer Verpflichtung, hier der Dienst als Landwehrmann, durch Zahlung eines bestimmten Geldbetrages je nach der persönlichen wirtschaftlichen Lage. In der Liste der einzelnen Reluitionsbeiträge werden aufgeführt die Bürger Franz Späth (Nr. 45 ½/Moosbauerweg 9), Georg Waitzer (Nr. 9/Kleinaigner Straßé 7), Andre Würz (Nr. 8/Salergasse 1), Georg Schreiner (Nr. 60/Markstraße 15), Franz Schmaus (Nr. 40/Blumengasse 3), Johann Uringer (Nr. 39/Blumengasse 1) und Andreas Müller (Nr. 47/ Heuhofer Mühle 1). Die „Oeconomie Comission des K(öniglichen) Landwehr Batalion Koetzting“ stellte an den Markt jeweils die Aufforderung zur Einzahlung. In den folgenden Jahren ließen sich von der sog. Landwehrpflicht auch der Marktschreiber Bach und die Lehrer Beer und Dobler befreien. Lieber zahlten sie jeweils 1 Gulden als Ablösung.
Im Jahr 1837 wird am 20. März über „die Uniformierung der Landwehrmänner in dem aktiven Landwehrbataillon“ berichtet. So hat sich „Endunterthenig unterzeichnete Magistrat nach Einlauf des Rundschreibens vom Königlichen Landgericht Kötzting“ sogleich mit dem allhiesigen Landwehr Companie-Kommando ins Benehmen gesetzt. Demnach sind alle früher eingetretenen Landwehrmänner in den aktiven Dienst „monturt (gekleidet) und armirt (bewaffnet)“. Eine Ausnahme scheint Anton Korherr (Nr. 11/Kleinaigner Straße 9) zu sein. Er gibt vor, er besitze alles bis auf den Uniformrock. Das „dafür nötige Tuch habe er bereits bei einem Schneider hinterlegt. Allein diesem Korherr ist nicht viel Glauben beizumessen, daher beantragt man unterthenig, daß sich dieser Landwehrmann mit Uniformierung dem Kommando des Landwehrbataillons vorstelle“, so die zweifelnde Marktführung.
Als Landwehrmänner „unbemittelten Standes“ werden genannt: Sebastian Lehrnbecher, Sebastian Lamecker (Nr. 49 ½/Steinweg 2) und Mathias Schreiner (Nr. 18/ Further Straße 8). Auch haben die zwei Tambourbesitzer noch keine Federbüsche, diese notwendig von der Oeconomiekasse beizuschaffen seien. Die Regierung mit Sitz damals in Passau befahl am 6. Juni 1837, dass der Landwehrmann Korherr und die zwei „Tambours“ sowie die „drei armen Landwehrmänner der Kompagnie Eschlkam und zwar letztere aus den Reluitionsgeldern sowie die armen Landwehrmänner der Compagnie Neukirchen auf diese Weise alsbald uniformiert und armirt werden“. Unterschrieben hat diese Aufforderung die Kgl. Regierung und Kreis Comando des Unter Donau Kreises.
Werner Perlinger

Bild: Die Zeichnung zeigt Uniformen der um 1792 neu eingekleideten und bewaffneten Straubinger Bürgergrenadierkompagnie. Nahezu gleich gekleidet traten die Mitglieder der Eschlkamer Landwehr in Erscheinung. Bei der Fronleichnamsprozesion haben die Landwehrmänner in ihren Uniformen gewiss ein prächtiges Bild abgegeben.
(Bildnachweis: Zeichnungen im Heeresarchiv, München)
Gemeindewahl auf der Grundlage der Bayerischen Verfassung von 1818
+Eschlkam. Im Artikel "Als der Marktschreiber und nicht der Bürgermeister den Markt regierte" berichteten wir über die Folgen der ersten bayerischen Verfassung vom Jahr 1808, als dem damaligen Marktschreiber, staatlicherseits ernannt zum Komunaladministrator, eine verhältnismäßig hohe politische Kompetenz eingeräumt wurde, basierend auf der ersten bayerischen Konstitution (Verfassung) von 1808. Diese war unter dem bayerischen Innenminister Maximilian Graf von Montgelas für die Neuorganisation der staatlichen Verwaltung ausgearbeitet worden. Bereits nach zehn Jahren wurde sie durch die wesentlich umfangreichere Verfassung von 1818 abgelöst. Die damit eingeleiteten Verwaltungsreformen bildeten aber auch die Grundlage für eine landesweite Kommunalorganisation, die den mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Gemeinden schon mit diesem zweiten Gemeindeedikt vom 17. Mai 1818 mehr Selbstverwaltungsrechte als bisher einräumte. Damit war vor allem die Funktion des Komunaladministrators beendet und ehemalige ortspolitische Verhältnisse konnten im Rahmen der Selbstverwaltung wieder greifen.
So wandte sich die Königliche Regierung des Unter-Donau-Kreises, Kammer des Innern, am 10. September 1818 „im Namen seiner Majestät des Königs“ (Maximilian Joseph I.) an die jeweiligen Landgerichte, hier an Kötzting, mit der Forderung, die nun entstehenden Wahlberichte „insbesondere rücksichtlich der künftigen Gehälter des Magistrats, speziell in Conspecten (zusammenfassend), das Vermögen, die Renten und Lasten, dann den Passivstand jeder Gemeinde summarisch darzustellen“. Eine erste, nach diesen neuen Gesichtspunkten orientierte Wahl fand nun in Eschlkam statt. Ein Schreiben der Regierung in Passau – bestätigend – das Ergebnis, nennt „die Resultate“: Als Bürgermeister wurde demnach gewählt (in Klammern die Adresse) Johann Georg Schreiner, Seifensieder und Handelsmann (Nr. 35/Marktstraße 7); als Magistratsräte (früher der Innere Rat): Josef Bartl, Krämer (Nr. 25/ Waldschmidtplatz 8); Jgnatz Schmirl, Schuhmacher (Nr. 72/Marktstraße 12), Josef Korherr, der Jüngere, Kufner (Nr. 11/Kleinaigner Straße 9) und Johann Baptist Vetter, Lederer (Nr. 42/Blu- mengasse 7). Als Ersatzmänner wurden erkoren: Joseph Weber, bräuender Bürger (Nr. 1/ Waldschmidtstraße 14) und Andrä Lachs, Schuhmacher (Nr. 52/Blumengasse 16). Die 13 gewählten Gemeindebevollmächtigen (Gemeindeausschuss, Vorgänger der heutigen Gemeinderäte, früher der Äußere Rat) waren: Joseph Späth, Wirt (Nr. 5/Further Straße 1); Anton Riederer, Metzger (Nr. 24/Waldschmidtstraße 1); Jakob Fischer, Schmied (Nr. 6/Kleinaigner Straße 1); Jakob Fischer, „Hutherer“ (Hutmacher- Nr. 55/Blumengasse 10); Joseph Hölzl, Hafner (Nr. 51/Blumengasse 18); Joseph Gruber, Schlosser (Nr. 68 /Großaigner Straße 6); Anton Kollböck, bräuender Bürger (Nr.3/Waldschmidtstraße 8); Andreas Kilger, Bäcker (Nr. 58/ Blumengasse 2); Kaspar Schifferl, bräuender Bürger (Nr. 63/Großaigner Straße 9); Joseph Schreiner, Oekonom (Nr. 37/Marktstraße 11); Joseph Schöppel, Metzger (Nr. 34/Markstraße 5) und letztlich Michl Lax, Schuhmacher (Nr. 41/Blumengasse 5).
Die Wahl wurde genehmigt
Im Anschluss erklärt die Regierung des Unterdonau-Kreises , dass die Wahl unter der ausdrücklichen Voraussetzung genehmigt werde, „daß der Markt Eschlkam wirklich eine Magistratische Verfassung behaupten kann, wozu aber die Vernehmung und Einstimmung aller wirklichen Gemeindeglieder (die Bürger) oder wenigstens mit einer Stimm-Mehrheit von 2/3 Theilen und zwar ganz in der Art wie bey dem Markt Neukirchen anbefohlen worden, erforderlich ist“. Das gleiche gelte bei den Ersatzmännern wie auch bei den Gemeindebevollmächtigten.
Erwähnt sind auch die Gehälter der Gemeindebediensteten sowie die Aufwandsentschädigungen. Demnach erhält der Bürgermeister für seine Tätigkeit eine jährliche Aufwandsentschädigung von 50 Gulden (f); von den vier Magistratsräten jeder 20 f. Das Jahresgehalt des Marktschreibers beträgt 500 f; das des Marktdieners 120 f. Interessant ist dazu die amtliche Feststellung, dass „wenn die Bürgergemeinde mit dem entworfenen Gehältern-Etat, nach welchem dem Marktschreiber neben 450 f Besoldung noch die freie Wohnung gebühren soll, einverstanden und die Kosten aufbringen will so mag es gerne dabey sein Bewenden behalten.“ Höheren Orts wurden die Einlassungen akzeptiert, jedoch manche Bereiche aus formalen Gründen kritisiert und angemahnt, „die anbefohlenen Mängel unverzüglich zu ersetzen. Die Resultate sind binnen 8 Tagen bey Vermeidung eines eigenen Bothen umständlich (hier: unverzüglich) anzuzeigen und damit wiederholt ein Verzeichnis des effektierenden (des auszuführenden) verbleibenden Magistrats Personals der Ersatzmänner dann den Gemeindebevollmächtigten vorzulegen“, so die Regierungsstelle in Passau. Die Marktführung wird Folge geleistet haben.
Einteilung in Kreise
Abschließend einiges über die damalige Einteilung des Landes Bayern in Kreise: Erst die Konstitution von 1808 schuf dafür ein klares System: Die Generalkreiskommissariate sollten als Mittelstellen über den Landgerichten (älterer Ordnung) das unübersichtliche Gefüge an Zuständigkeiten überwinden, die ministeriellen Anordnungen weitergeben und den Vollzug bei den Außenbehörden kontrollieren. Der Finanzbereich wurde von der Verwaltung abgetrennt und auf der mittleren Ebene in Kreisfinanzbehörden, auf der unteren Ebene in Rentämtern organisiert. Ohne Rücksicht auf die bisherigen, historisch geprägten Provinzen wurde das inzwischen bis nach Südtirol reichende Königreich Bayern nach verwaltungstopografischen und geografischen Gesichtspunkten in 15 etwa gleich große Kreise eingeteilt, die nach dem Vorbild der französischen Departements nach Flüssen benannt wurden: Man sprach damals von Altmühl-, Eisack-, Etsch-, Iller-, Inn-, Isar-, Lech-, Main-, Naab-, Oberdonau-, Pegnitz-, Regen-, Rezat-, Salzach- und Unterdonaukreis, so viel abschließend zu diesem Thema.
Werner Perlinger
Die „Villa“ an der Kirchhofmauer
+Eschlkam. Zu den bauhistorisch interessanten Gebäuden des Marktes zählt auch das Haus Burgweg 2, im Volksmund bezeichnet als >Ranklvilla<. Es ist ein stattliches Anwesen, das sich an die westliche Kirchhofmauer fast anlehnt. Seine Geschichte und somit die Entstehung seien in Folge dem Leser unterbreitet:
Rund um die gesamte ehemalige Kirchenburganlage zog sich bis zum Einfall der Schweden im Frühjahr 1634 mit der nahezu völligen Zerstörung des Marktes und noch über Jahrzehnte danach ein den unerwünschten Zugang hindernder tiefer, teils breiter Graben. Als in der Folgezeit die Pflege Eschlkam mit der in Neukirchen b. Hl. Blut vereinigt und somit der Pflegesitz Eschlkam aufgelöst wurde, waren auch aufgrund militärisch neuer Entwicklungen die einen Feind abhaltenden Anlagen wie der Graben überflüssig geworden. Und so wurde über die nächsten Jahrzehnte bis weit in das 18. Jahrhundert hinein der Graben etappenweise verfüllt und der so gewonnene Baugrund an bauwillige Bürger veräußert. Im Jahr 1737, am 8. Mai, gut 100 Jahre nach der Katastrophe im Dreißigjährigen Krieg, erwarb der Bürger Wolfgang Brückl vom Staat den noch zum Pflegamt gehörenden Teil des Grundes an der Kirchhofmauer, auf dem das besprochene Anwesen steht, um den Preis von 4 Gulden.
Bald war ein erstes Haus gebaut und zur selben Zeit noch ging es den Eintragungen nach durch Heirat der Brückl'schen Witwe an den Schuhmacher Stephan Hastreiter über. 1749, am 22. Januar verkaufte Hastreiter, Mitglied auch des „Äußeren Rates“, für 220 Gulden sein Anwesen an Georg Preysinger, (dieser war) bei seiner hochgräflichen Excellenz, H. Grafen von Staidach (Steinach), Herzog Ansbachischer Gesandten in Regensburg „Tafldecker“ (beim Kauf wegen Abwesenheit vertreten durch den Vater Jakob Preisinger, Söldner/Kleinbauer in der Hofmark Stachesried). Der „Leykauf“ betrug ½ Carolin. 1 Carolin entsprach 10 Gulden; 1 Gulden entspräche heute etwa dem Wert von 10 Euro. Zuweilen wird in den Akten das „Angeld“, welches der Käufer dem Verkäufer zur Sicherheit des geschlossenen Kaufes oder Handels im Voraus entrichtet, der Leihkauf genannt. Auch darf der neue Besitzer zunächst den an diesem seinen Haus gelegenen „zum alt Churfürstlichen Schloß gehörigen alten Keller auf seine aigene Costen raumen, das Gewölbe wieder bauen und eine Schupfe darauf setzen“. Diese ganze Aktion wurde wahrscheinlich zunächst zurückgestellt, denn „die (neue) Behausung am Pflegschlossgraben“ ging erst an die Witwe Anna Prickhl über, die sie 1753 an ihren zweiten Mann Stephan Hastreiter weitergab. Ein Jahr später erst, 1754, veräußerte Hastreiter das Haus an den obigen Georg Preysinger, Schneider. Dieser verkaufte „die einige Jahre besessene Behausung“ 1757 an den Schreiner Hans Kaufmann, der aus Kleinaign in den Markt zuzog. Im Besitz dieser Schreinerfamilie blieb das Haus Nr. 31 mit dem damaligen Hausnamen „Schreinerhaus“ mehrere Generationen lang bis zum Jahr 1876. Es folgen dann als zeitweilige Inhaber Breu, Lenk und Neumayer bis dann 1918, im letzten Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges, Franz Stöberl von Großaign und seine Frau Katharina das Anwesen kauften. Stöberl stammte aus dem Ranklhof in Großaign und übertrug durch Kauf den Hausnamen >Rankl< so auf dieses Anwesen.
Ein repräsentativer Neubau
Im Jahr 1896 bereits erfolgte ein völliger Neubau des Hauses, jedoch nicht durch die Familie Stöberl woher der Hausname kommt, sondern durch den Privatier Josef Lenk, geb. am 27. Januar 1836 in Seugenhof. Die Fenster wurden nicht mit den damals üblichen Läden sondern mit Jalousien (Rolladen) ausgestattet. Den hinteren Dachbereich zierte ein Turm mit einem pyramidalen Dach, der erst bei der letzten großen Renovierung in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts entfernt wurde. Heute nicht mehr vorhanden ist am Giebel mittig eine reliefierte, aber aus der Karte nicht erkennbare bildliche Darstellung; flankiert von zwei Nischen, gedacht wohl für die Aufnahme von Plastiken. Darüber kündet eine Uhr die Zeit. Den Giebel und die Balustrade (Geländer, gebildet aus kleinen Säulen) zieren pokalähnliche Ständer, tragend voluminöse Kugeln. Den Eingang des Hauses schirmt ein Balkon.
Nach seiner Fertigstellung glich der ganze Bau einer Villa aus der Gründerzeit, wie wir sie noch heute in größeren Städten vielfach bewundern können; deshalb auch der Name „Ranklvilla“, benannt aber nach den späteren Besitzern. Gegenüber den ländlich geprägten Häusern des Marktes nahm um 1900 dieses Haus von seinem Stil und der Bauausführung her eine Sonderstellung ein. Nach der Familie Stöberl sind seit ca. 1966 als neue Besitzer zunächst Konrad Schreiner und Hedwig, geb. Stöberl und seit 2013 schließlich Anton Leonhard und Gabriele, geb. Schreiner im Grundbuch eingetragen. Die jetzige Adresse lautet: Burgweg 2. Erwähnenswert sei noch, dass in diesem Haus der Historiker an der LMU-München, Prof. Dr. Hans Michael Körner am 10. Juni 1947 geboren wurde. Er ist Waldschmidt-Preisträger von 2012.
Werner Perlinger

Bildunterschrift: Die im Volksmund genannte „Ranklvilla“ trug, als diese Aufnahme als Postkarte mit dem Titel >Gruß aus Eschlkam< etwa um 1900 entstand, den Namen des Erbauers: „Villa Lenk“. Am Eingang in den von einem kunstvoll geschaffenen schmiedeeisernen Gitter umzäunten kleinen Hof posiert ein älteres Ehepaar, wohl der Bauherr Josef Lenk und seine Frau Margarethe, geb. Heller.
(Bildnachweis: Marktarchiv Eschlkam)
Das „gezünftete“ ehrbare Handwerk im Markt Eschlkam
+Eschlkam. Anlehnend an den letzten Artikel über die Freisprechung von Lehrlingen dazu abschließend einige allgemeine Ausführungen zur früheren Organisation des Handwerks im Markt in sog. „Zünften“. Das Wort „Zunft“ geht zurück auf das althochdeutsche Wort „zumft“ für das Verb „geziemen“. Nach der ursprünglichen Bedeutung für „Schicklichkeit“ und später für „Genossenschaftsregel“ nahm im 13. Jahrhundert das Wort >Zunft< die Bedeutung für den „Handwerkerverband“ an. Eine Zunft entstand, wenn sich die Handwerker einer Gruppe zusammenschlossen, um in einer Kommune die Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen zu sichern. Jeder Handwerker in einer mittelalterlichen Stadt oder Markt musste Mitglied seiner Zunft sein, um am Ort seinen Beruf ausüben zu können. In den Städten hatte das Zunftwesen allein schon wegen der höheren Zahl an Handwerkern stets eine hohe Bedeutung, weniger in den Märkten oder gar Dörfern.
Gemeinsames Interesse der Zunftmitglieder war es in erster Linie, dass die Ware eine gute Qualität haben sollte, daher wurde diese von der jeweiligen Zunft auch geprüft. Die Zünfte setzten auch die Löhne fest, versorgten Notleidende und Hinterbliebene der Zunftmitglieder, schränkten die Konkurrenz ein, indem sie die Zahl der Lehrlinge, Gesellen und Meister begrenzten, und sicherten so jedem Mitglied bei entsprechendem Fleiß und Engagement ein gutes Einkommen. Die Zünfte behinderten zwar die freie Entfaltung des Gewerbes so wie wir es heute verstehen, gaben andererseits aber jedem Mitglied das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.
Die Pfuscher oder Störer auf dem Land
Neben dem Zunftwesen, das sei auch erwähnt, gab es die „Pfuscher“ oder „Störer“. Das waren Handwerker, die der Zunft am Ort nicht angehörten und hauptsächlich auf dem Lande tätig waren. Der Begriff „auf der Stör arbeiten“ kommt von „stören“ aus der Sicht des in einer Zunft vereinigten Handwerks. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es vielerorts die „Natherin auf der Stör“. Das waren Frauen, die als Schneiderinnen auf einem Bauernhof tagelang, sogar Wochen damit beschäftigt waren, die Heiratsausstattung der Tochter vom Brautkleid bis zu den Bettbezügen zu erstellen. Diese Situation ergab sich zwangsläufig daraus, dass der Weg in die Stadt oft weit und beschwerlich war und man es gerne vermied, wegen der Ausstattung sich mehrmals zum Schneider in die nächste Stadt oder Markt begeben zu müssen.
Handwerker und Zünfte in Eschlkam
Auch die Handwerker im Markt waren früher zum Teil in Zünften zusammengeschlossen. Im Gemeindearchiv finden sich Unterlagen dazu. So sind für das Jahr 1823 als Handwerker aufgelistet, jedoch ohne Namen:
4 Bäcker, 1 Glaser, 1 Hafner, 1 Hutmacher, 3 Kufner (Fassmacher, Binder), 1 Lederer, 3 Müller, 3 Metzger, 1 Riemer, 1 Seifensieder, 1 Seiler, 1 Schlosser, 2 Schmiede, 8 Schneider, 3 Schreiner, 6 Schuhmacher,1 Wagner und 4 Weber.Ein knappes Jahr später, am 7. April 1826, musste auf der Grundlage des neuen Gesetzes die Führung des „königlichen Gränzmarkts Eschelkam“ über die bestehenden Zünfte und deren Vorsteher im Ort berichten: „hierorts bestehen 3 Zünfte, nämlich Weber (Vorsteher Joseph Weß) – Schuster (Andrä Lax) – und Schneider (Andre Meidinger). Die vier Weber waren Joseph Weß (Blumengasse 24), Johann Sporrer (Blumengasse 11), Georg Waitzer (Kleinaigner Straße 7) und Georg Weß (Großaigner Straße 14); die sechs Schuster: Ignatz Schmirl (Marktstraße 12), Andrä Lax (Blumengasse 16), Joseph Bartl (Waldschmidtplatz 8), Michael Hastreiter (Blumengasse 22), Andre Bohmann (Blumengasse 12) und Franz Lax (Blumengasse 10). die neun Schneider: Anton Meidinger (ohne Hausbesitz), Michael Meidinger (ohne Hausbesitz), Franz Denzl (Bräuhausgasse 1), Joseph Fleischmann (Großaigner Straße 15), Georg Hacker (Großaigner Straße 4), Georg Weiß (ohne Hausbesitz), Sebastian Würz (ohne Hausbesitz), Sebastian Lernbecher (ohne Hausbesitz) und die Joseph Denzlsche Witwe (ohne Hausbesitz). Als „gezünftet“ werden nur diese drei Handwerksbereiche genannt, weil sie im Markte zahlenmäßig stark vertreten waren. Die anderen Gewerbe, vor allem bei nur einem Vertreter, waren den Zunftorganisationen in benachbarten Orten zugeordnet.
Die Auflösung der Zünfte stand bevor. Um aber diese Maßnahme erst später wie geplant geordnet durchführen zu können, kam am 2. April 1826 von der Regierung der Befehl, es habe die Auflösung der Zünfte „bis zur Bildung der neuen Gewerbsvereine zu unterbleiben, welches den Magistraten Neukirchen und Eschlkam hirmit vernachrichtet wird.“ Das Ende des alten Zunftwesens war somit eingeleitet und den modernen Entwicklungen geopfert worden.
Durch die königliche Verordnung vom 24. Juni 1835 wurden in Bayern die Zünfte endgültig aufgelöst. Sie hatten sich einfach überlebt und waren so nicht mehr zeitgemäß. An ihre Stelle traten nun die Gewerbevereine, die nützliche Gewerbekenntnisse vermitteln, die Angliederung in den einzelnen Gewerben zueinander erleichtern, die Lehrlinge, Gesellen und Gehilfen beaufsichtigen und ähnliche Vorteile wie die Zünfte bringen sollten.
Keine Nachrichten hinsichtlich Zunftwesen überliefert uns das Metzger- und Bäckerhandwerk. Lediglich von der „Vleyschpankh“ ist in den Protokollen immer wieder die Rede. Fleischbänke waren Einrichtungen, in denen die Metzger oder Fleischhauer das bereits geschlachtete Vieh zerlegten und dann das Fleisch oder die daraus handwerklich erzeugten Produkte an die Bürger verkaufen konnten. Die meist vier im Markt vorhandenen Bäcker hatten dafür ihre „Brotbank“, in der ein eigens eingesetzter „Brothüter“, meist ein nicht selbstständiger oder bereits im Austrag lebender Bäcker die angebotenen Waren verkaufte. Beide Einrichtungen waren früher am Waldschmidtplatz unmittelbar hinter dem Rathaus nebeneinander situiert.
Werner Perlinger
Die „Ledigzählung“ (Freisprechung) eines Lehrjungen vom „Preu Handtwerch“
+Eschlkam. In frühen Zeiten hat man für eine Lehrstelle, also die Aufnahme als Lehrling in einem Handwerksbetrieb, ein sog. Handgeld bezahlen müssen. Bis zu seiner Gesellenprüfung lebte und arbeitete der Lehrling zusammen mit der Familie des Meisters. Geld bekam er für seine Arbeit nicht, nur eben Kost, Logis und Kleidung. Die Lehrlinge kamen meist im Alter von etwa 13-14 Jahren in den Meisterbetrieb und blieben dort bis sie die Gesellenprüfung ablegten und sich auf Wanderschaft begeben mussten. Und so folgten auch schon vor drei- oder vierhundert Jahren für junge Leute die Lehrverhältnisse im Handwerk festen Gesetzmäßigkeiten. War nach der Schulzeit ein Knabe bei einem Meister in die Lehre gegeben, so erfolgte nach ordentlich abgeleisteter Lehrzeit die „Ledigzählung“ (Freisprechung) dieses Lehrjungen. Einen solchen Vorgang beinhaltet beispielsweise das Ratsprotokoll vom Jahr 1693. Aus dem folgenden Inhalt erkennen wir, dass solche Akte auf Handwerksebene schon immer strengen Regeln unterworfen waren.
Am 2. Mai erschien vor dem Bürgermeister und den Ratsherren Balthasar Seellmayer, Bürger und „Gemainer Markts Preumaister“ (damals wohnhaft in Hsnr. 56/Blumengasse 8) mit einem Anliegen: „Wolf Preu, Pauren zu Lembing eheleiblicher Sohn Georg Preu, vermög aufgedingt“ (als Lehrjunge übernommen) am 8. Juni 1692…nun „frei: ledig und los gezelt“ (freigesprochen). „Aufgedingt“ (die Lehre begann) am 8. Januar 1692 – niedergeschrieben im Briefprotokoll dieses Jahres – und dauerte bis Michaeli (29. September) des Jahres 1693; also demnach etwa nur 20 Monate. In dieser Zeit wurde dem jungen Preu das „Preu Handtwerck“ wie es einem ehrlichen „Preumaister gebiehrt und anstehet, redlich gelehret“. Hingegen hatte der Lehrjunge alles „das was er zethun schuldig gewesen“, erfüllt und auch das „Lehrgelt redlich und ehrlich bezahlt und entricht“. Auch hatte sich der Lehrjunge in dieser Zeit „gehorsam und ehrlich verschwiegen verhalten“. Da der Lehrling seine Lehrzeit, was „Handtwerchs gebrauch und Gewohnheit ist bis auf heut dato erstrekhet“, habe ihn sein Lehrherr, der Bräumeister „dergestalten frey: ledig und los gezelt“, so dass er künftig sein Handwerk, wo immer er auch will, ausüben könne. Als Zeugen dieses Akts fungierten die Braumeister Michael Aumüller von der „Churfürstlichen Stat Furtt“ und Georg Feichtner vom „Churfürstlichen Markht Neukhürchen“, geschehen am 18. Mai 1693. Beide hatten wohl auch die Prüfung abgenommen.
Der Braumeister
Für das Brauen von Bier stellte der Brauverband, bestehend aus den brauberechtigten Bürgern des Marktes, stets für eine feste Zeitspanne einen eigenen Braumeister ein. Er musste zuvor eine Kaution hinterlegen, sollten die brauenden Bürger durch einen schlechten Sud Schaden nehmen. Auch durfte er von dem gesottenen Bier keines für sich beanspruchen, es sei denn, der eine oder andere Bürger „verreiche“ ihm freiwillig eigenes Bier. Eigentlich war der Beruf des Braumeisters ein „Schleudersitz“, um im heutigen Sinne zu sprechen; denn er wurde regelmäßig jedes Jahr von der Marktführung entweder in seinem Amte bestätigt, oder abgewiesen und ein neuer Braumeister eingestellt, was laut Inhalt der einzelnen Ratsprotokolle immer wieder geschah. Daher bat nach der Freisprechung des jungen Preu aus dem Lehrverhältnis gleichzeitig sein Lehrherr Balthasar Seellmayr den Marktrat „ihm hinfürters widerumben den Preudienst gnediglich zu verleihen“. Die Ratsherrn, zufrieden mit seiner bisherigen Tätigkeit im Kommunebrauhaus (Hsnr. 14 - abgebrochen 1923), entsprachen umgehend seiner Bitte.
Wiederaufnahme eines „Preumaisters“
„Hainrich Spätt, Burger und Prauner Preumaister“, bat bereits einige Jahre zuvor, 1687, den Marktrat ihm künftig den „Preudienst widerumben zu überlassen“. Er wohnte damals in Hsnr. 69 – heute das Anwesen Großaigner Straße 7. Die Bürgerschaft selbst hatte aber vorbringen lassen, dass sie aufgrund zahlreich eingegangener Beschwerden mit ihm „gar übel zufriden seint“. Nach längerer, teils kontroverser Aussprache dazu wurde er (wohl mangels eines geeigneten Ersatzes) doch wieder mit der Bierherstellung im Kommunbrauhaus beauftragt. Diese Zeremonien wiederholten sich so oder ähnlich jedes Jahr.
Aufdüngung des Wolfen Milpauer zum Preuhandtwerck
Geschuldet der zeitlichen Abfolge sei erneut eine weitere Aufnahme eines Lehrjungen für das Brauerhandwerk angeführt, niedergeschrieben im Ratsprotokoll am 26. Oktober 1695: „Heinrich Spätt, Burger und Preumaister alhier (er hat wohl Seellmayr im Jahr zuvor abgelöst), hat ainen Lehrjungen an: und aufgenommen, (nämlich) Wolf Millpauer als Veith Millpaur zu Hünderpuchberg eheleiblichen Sohn“. Die Lehrzeit wurde von Michaeli 1695 bis zum gleichen Tag 1697 festgesetzt, also auf 2 Jahre terminiert. Der angehende Lehrling selbst: „erbitt sich Lehrjung…wie es ainem Lehrjung gebührt und wolanstehet (sich) vleissig, gehorsamb zu verhalten, darob Lehrmaister ain Contento (Zufrieden sein) haben solle“. Der Lehrjunge gibt dann seinem Lehrmeister 7 f (Gulden), „wie auch 1 f „Waschgelt“, aufgeteilt für das erste Jahr 4 und im zweiten Jahr 3 f. Bürgschaft für den Lehrling leistete der „eheleibliche Vatter Veith Millpauer“. Die zu diesem Aufnahmeakt gebetenen Zeugen waren der oben schon genannte Bräumeister Michael Neumiller (müsste Aumüller heißen) von Furth und Franz Altmann von Neukirchen, dazu auch Herr Johann Rosenthorn, „churfürstlicher Gräniz Veldtwaibl“ (Feldwebel der Grenzfahne).
Die oben genannte erste „Aufdingung“ wurde nach Inhalt der Niederschrift sogar in das Briefprotokoll vom Jahre 1692 eingetragen. Die angeführte „Ledig Zellung“ fand Eingang in das Ratsprotokoll. Die Bedeutung dieser Maßnahmen ist darin zu sehen, dass der junge Braulehrling nicht bei einem bürgerlichen Meister im Markte sein Handwerk erlernte, sondern im Kommunebrauhaus das Brauen von Bier. Das Brauhaus hatte als eine Einrichtung für die gesamte brauende Bürgerschaft demnach einen öffentlich- rechtlichen Charakter.
Werner Perlinger
Obstalleen säumten früher die wichtigen Straßen
+Eschlkam. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden an den Ausfallstraßen von Städten und Märkten – sofern noch nicht vorhanden - Alleen angelegt. Gerade für den damaligen Fuhr- und Fahrverkehr boten in der heißen Jahreszeit das Laubdach der Bäume Tier und Mensch Schutz vor stark strahlender Sonne, auch vor heftigem Regen. Landesweit wollten die Kommunen im 19. Jahrhundert die einzelnen Straßenläufe, die aus den Ortszentren hinaus zu den nächsten Orten führten, nützen, indem sie nach und nach Obstbaumalleen pflanzten. Ähnlich war es auch im räumlichen Umgriff von Eschlkam. Obstbäume säumten im Jahr 1858 die vom Markte wegführenden wichtigen Straßen nach Großaign, Stachesried und Furth im Wald, bepflanzt jeweils bis zur Gemeindegrenze. Ein uns überlieferter Akt mit dem Thema „Die Aufsicht auf die Straßen-Alleebäume und die Versteigerung des Obstes an den Alleebäumen betrff.“ gewährt Einblicke in die damalige Situation. So wird beklagt, dass schon seit Jahren die „inner des Grenzbezirks des Marktes Eschlkam an den Straßen befindlichen Allee- und Obstbäume dadurch verstümmelt (werden), daß viele Leute und insbesondere die Kinder das Obst selbst wenn es noch nicht völlig reif ist, herabreißen und die Aeste meistens theils abbrechen. Dadurch entstünden der Kommune, aber auch den an den Straßen angrenzenden Grundbesitzern Kosten, da vereinzelt Bäume sogar nachgepflanzt werden müssten“. Um für die Alleen einen einigermaßen effektiven Schutz zu gewähren, wurden am 10. Juli 1858 der Polizeidiener Pinzinger und der Flurwächter Andre Kolbeck „zur strengsten Aufsicht auf die Straßenalleebäume inner der Grenze des hiesigen Marktes und zur unnachsichtlichen gewißenhaften Anzeige allenfalls vorkommender Frevel“ verpflichtet. Am 27. Juli, einige Tage nach einer bereits erfolgten Versteigerung des Obstes auf den Bäumen, monierte das Landgericht Kötzting, dass „der Schutz der Obstbäume gegen lüsterne Angriffe den Flurwächtern obliegt, nicht aber der k(öniglichen). Gendarmerie“, was eine Befreiung Pinzingers von dieser zugedachten Aufgabe bedeutete.
Der Marktrat beschloss außerdem, bei künftigen weiteren Zuwiderhandlungen:
1) die Verursacher mit einer Geldstrafe in Höhe von 3 Gulden zu belegen;
2) das Obst auf den Bäumen – wenn die Reife eingetreten ist – öffentlich zu versteigern.
Der Erlös aus den Strafgeldern und der Versteigerung floss dann der Marktkammer zu. Dieser Beschluss des Marktrates musste von allen hausansässigen Bürgern unterschrieben werden, was auch geschah.Am 15. Juli informierte Pfarrer Karl Pittinger die Gemeindeführung, dass von den Verboten die „hiesigen Werktags- und Feiertagsschüler (heute die Berufsschüler)“ in Kenntnis gesetzt worden seien. „Bei diesem Anlaße“, so der Ortspfarrer, „erlaubt man sich, den Magistrat als Schulfondsverwalter in Erinnerung zu bringen, daß bei günstiger Zeit der schon lang schadhafte Mörtelanwurf an der Westseite der Schule nachhaltig ausgebessert werden muß“. Die Schule war 1824 gebaut worden und stand an gleicher Stelle des heutigen alten Schulhauses von 1897.
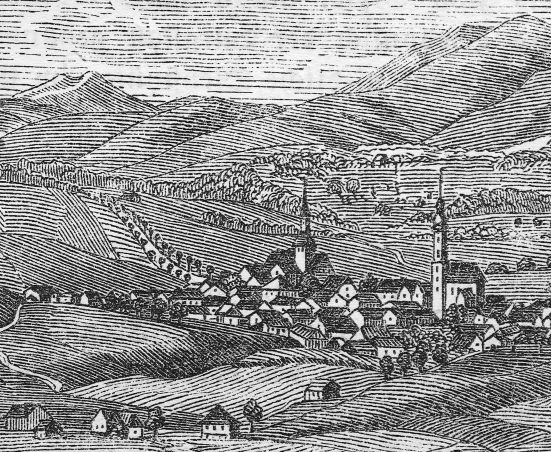 Bild: Im Sulzbacher Kalender vom Jahr 1859 zeigt ein Holzschnitt die damalige Stadt Furth. Die Straße von Furth nach Eschlkam schmückt eine Allee; angelegt bereits 1827/28. Sie verlief bis zur niederbayerischen Grenze beim Anwesen „Steinbach“. Dort begann die Allee des Marktes Eschlkam.
Bild: Im Sulzbacher Kalender vom Jahr 1859 zeigt ein Holzschnitt die damalige Stadt Furth. Die Straße von Furth nach Eschlkam schmückt eine Allee; angelegt bereits 1827/28. Sie verlief bis zur niederbayerischen Grenze beim Anwesen „Steinbach“. Dort begann die Allee des Marktes Eschlkam.
90 Obstbäume
Am 20. Juli begann man im Rahmen einer Versteigerung – ausgeführt von Bürgermeister Schmirl und dem Marktschreiber Joseph Reitinger - die „Verpachtung des Obstes auf den Bäumen“. Eingeladen bzw. zugelassen wurden nur „ansässige und zahlungsfähige“ Bürger. Tags darauf, am 21. Juli war es um die Mittagszeit soweit. Das „Pachtobjekt“ bestand aus ungefähr 90 Obstbäumen, stehend an den oben genannten Straßen. Voraussetzung für die Zulassung war auch, „das Obst vorsichtig herabzunehmen und (es) darf den Bäumen nicht im Mindesten ein Schaden zugefügt werden“. Als „steigerungslustig“ fanden sich ein: Anton Pfeffer, bürgerlicher Fragner (Kleinhändler in Marktstraße 2), Michl Dachauer, Schmied (Kleinaigner Straße 1); Jakob Pinzinger, Maurer und Franz Pinzinger selbst, der Polizeidiener (Großaigner Straße 5). Das „Pachtobjekt“ wurde mit 1 Gulden 30 Kreuzer aufgerufen. Den Zuschlag erhielt schließlich Jakob Pinzinger für 1 Gulden 54 Kreuzer. 1 Gulden würde heutzutage dem Kaufwert von etwa knapp 15 Euro entsprechen. Der Betrag erscheint zunächst sehr gering. Es sei aber zu bedenken, dass die Ernte des Obstes für den Ersteigerer einen nicht geringen Arbeitsaufwand bedeutete. Auch musste er darauf achten, dass das Obst in den nächsten Tagen nachts nicht rasch noch von Obstdieben gestohlen wurde. Es ging der Marktführung wohl auch darum, die Verantwortung für diese Angelegenheit wenigstens für kurze Zeit los zu sein. Die Versteigerung bzw. Verpachtung wurde alljährlich wiederholt und die Pachtzeit erstreckte sich jeweils nur auf das gerade laufende Obstjahr. Nach dem Abernten fiel die Verantwortung für die etwa 90 zu pflegenden Obstbäume an den Markt zurück.
Es dauerte noch Jahrzehnte, da wurden die Obstbäume durch Laubbäume ersetzt. Nachdem der Autoverkehr in den vergangenen Sechziger und Siebziger Jahren stetig anwuchs, wurden aufgrund vieler Unfälle mit teils tragischen Folgen die Alleebäume Zug um Zug beseitigt. Die Straßen wurden entsprechend den heutigen Anforderungen vermehrt „autogerecht“ ausgebaut.
Werner Perlinger
Die Erledigung des Kantor- und Mesnerdienstes
+Eschlkam. Es ist noch nicht so lange her, dass die Volksschullehrer in kleineren Gemeinden das ganze Jahr über auch von kirchlicher Seite her sehr gefordert waren. Nachdem früher jeder Lehrer zwingend musikalische Kenntnisse für seinen Beruf mitbringen musste, lag es sehr nahe, dass er diese auch der Ortskirche zur Verfügung stellte. Demnach war der „Schulmeister“, wie er in alten Niederschriften gerne genannt wird, sonntags stets meist an der Orgel zu finden, und gestaltete die einzelnen Gottesdienste musikalisch mit.
Im Jahr 1860, am 3. Februar, beauftragte über das Landgericht Kötzting die damalige Regierung den Markt Eschlkam zu prüfen und ein Gutachten zu erstellen, ob es gemäß rechtlicher Vorgaben, obwohl diese bereits aus dem Jahr 1810 stammten, „nicht thunlich sei, den erledigten Kantor- und Mesnerdienst einem Schullehrer Individuum zu übertragen und auf eine solche Weise anstatt der dermaligen Schulgehilfenstelle in Eschlkam eine zweite wirkliche Schullehrerstelle alldort zu errichten“. Der Magistrat sollte auf Anweisung des gerade amtierenden königlichen Landrichters von Paur sich dazu innerhalb von acht Tagen erklärend äußern.
Der Magistrat fasste am 9. Februar unter Bürgermeister Anton Sämmer dazu einen förmlichen Beschluss dahingehend, „daß es durchaus nicht richtig und auch nicht zweckdienlich sei, daß der hiesige Meßnerdienst mit einem Schullehrerdienste vereinigt und so die Schulgehilfenstelle aufgehoben werde, weil sowohl der Meßner, als auch der Schuldienst so viel gesondert eintragen, daß jeder Inhaber dieser Posten recht gut eine Familie ernähren kann, und weil insbesondere durch Vereinigung dieser beiden Stellen entweder der Meßner- oder der Schuldienst Schaden leiden muß, zumal die Pfarrei Eschlkam eine sehr große ist“.
Einen Kandidaten vorgeschlagen
Vielmehr sprach sich der Marktrat dafür aus, dass „bei dieser Gelegenheit der Insaße (ein solcher wohnt nur zu Miete, kein Hausbesitzer) Sebastian Würz von hier bei der königlichen Regierung befürwortet und eventuell die Bitte gestellt werden soll, falls Würz nicht als Meßner aufgenommen werden sollte, ein sonst in jeder Beziehung und insbesondere in Bezug auf Musik sehr qualifiziertes Individuum aufgestellt werden wolle“. Nur einen Tag später, am 10. Februar, wandte sich der Markt erneut an das Landgericht, enthaltend die Einwände in weit ausführlicherer Form wie tags zuvor. Daraus erfahren wir, dass damals die Pfarrei „vom Pfarrer und zwei Hilfsgeistlichen gesteuert“ werde (bei dem heutigen Priestermangel nicht mehr vorstellbar) und eine große Pfarrei darstelle; jedoch mit nur einer Sepultur (Friedhof, Begräbnisstätte), so dass dadurch das jährliche Einkommen für den Kantor- und Mesnerdienst festgesetzte stattliche 446 Gulden 13 ½ Kreuzer betrage. Auch sei es den Gegebenheiten entsprechend „unmöglich, daß ein- und dieselbe Person den Meßner- und Kantorendienst und dann auch den Dienst eines Schullehrers ohne Nachtheil für den einen oder anderen dieser Dienste versieht“. Der Marktrat sah darin eine vorprogrammierte Vernachlässigung der einzelnen Dienste an sich, denn er führte beispielhaft an, dass kaum eine Woche vergehe, in der „nicht nach verschiedenen Richtungen des Pfarrsprengels wenigstens zwei Provisdren (Versehgänge mit den Hilfsgeistlichen) vorkommen, ingleich aber auch daß täglich solche stattfinden, wobei der Meßner den Priester begleiten müsse. Wer soll nun für den Meßner die Schule halten; oder soll er sich als Meßner oder als Schullehrer einen Gehilfen halten? Beides würde ihm schwer fallen, denn er würde dadurch an seinem Einkommen verkürzt“. Auch würde der Gemeinde mit einer zweiten offiziellen Lehrkraft „eine Last aufgebürdet werden“. Nochmals wurde die Einstellung des Sebastian Würz befürwortet und dabei betont, dass seine Familie „aus Frau und zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren bestehe“ und er „keinen ständigen Erwerbszweig“ habe und sich so „mit seiner Familie nur kümmerlich fortbringe“. Da sich wegen eines weiteren Mitbewerbers um diese Stelle, des Schulprovisors (Hilfslehrers) Meidinger von Schwarzenberg, in Eschlkam bereits „Parteien gebildet haben und somit hierorts der Weg zu ähnlichen Verhältnissen wie es sie zu Zeiten des k(öniglichen) Pfarrers Pittinger (er amtete von 1843-1859) bestanden, nahezu gebahnt ist“, wurde der Vorschlag unterbreitet, „die hohe kgl. Regierung wolle die fragliche Stelle, den Kantoren- und Mesnerdienst, einem anderwärtigen (von auswärts) künftigen und in jedweder Beziehung vorzüglich gut qualifizierten Individuum gnädigst übertragen“. Und so geschah es auch:
Abschlägig beschieden
Nur wenige Tage später, am 16. Februar, befahl der Landrichter kurz und bündig, ohne auf das Vorbringen des Marktrates gesondert einzugehen, „den landgerichtlichen Auftrag vom 3. Februar unverzüglich zu erledigen“. Damit endet der Akt. Der damalige Marktschreiber Reitinger jedoch informierte auf der Rückseite des landgerichtlichen Schreibens unter dem Begriff „Nota“ (Anmerkungen) aber erst am 30. Juli: „Glöckler Joseph, vormals Schullehrer in Langquaid (Niederbayern/Landkreis Kehlheim), Landgericht Rottenburg, hat den fraglichen Dienst erhalten, trotz der unsinnigen Remonstrationen (unverständlichen, nicht nachvollziehbaren Einwendungen) des Pfarrers Kaspar Lutz“. Lutz war Nachfolger Pittingers und stand der Pfarrei von 1859 bis 1871 vor.
In Wirklichkeit ging es bei dem ganzen amtlichen Hin und Her schlicht ums Geld. Den Mesner musste die Kirche finanzieren, den Lehrer der Markt. Der Markt wollte die Schulgehilfenstelle behalten, zugleich aber dem jungen Mitbürger Sebastian Würz zu einem festen Einkommen verhelfen. Mit der „Anhebung“ der Gehilfenstelle zu einer realen für Eschlkam zweiten Lehrerstelle – so der Wunsch der Regierung allein schon wegen des doch großen Einzugsbereiches des Marktes - kamen so auf die Gemeinde für den Schulbereich höhere Unterhaltskosten zu. Im Hinblick auf geordnete Unterrichtsverhältnisse und der Vermeidung der genannten drohenden Spaltung der Bürgerschaft wegen des Anwärters Meidinger entschied sich die Regierung jedoch gegen den Markt und wertete mit der Berufung des Lehrers Glöckler aus Langquaid gleichzeitig den Schulstandort Eschlkam pädagogisch auf.
Werner Perlinger
Wahl der Kirchenverwaltung in Eschlkam im Jahr 1845
+Eschlkam. Wir schreiben das Jahr 1845. Da wurde im frühen Herbst eine für die Eschlkamer Bürgerschaft wie auch für die Ortskirche wichtige Wahl anberaumt. Die Bürger waren aufgerufen aus ihren Reihen Mitglieder für die Kirchenverwaltung neu zu bestimmen. Eine solche Wahl war für das Verhältnis zwischen den katholischen Bewohnern und der Kirche insoweit von Bedeutung als das Gremium „Kirchenverwaltung“ zuständig ist für das bestehende kirchliche Vermögen, die Gebäude, Grundstücke und das Personal der jeweiligen Kirchengemeinde. Sie ist das höchste Gremium oder in Vermögensangelegenheiten sogar der Rechtsträger einer Pfarrei. Früher, so in den Niederschriften des 17. und 18. Jahrhunderts, wurden deren Mitglieder als „Zechpröbste“ bezeichnet. Die Zechpröbste (lat.: vitricus für Stiefvater, gedanklich übertragen auch für Kirchenpfleger) waren schon damals gemeinsam mit dem Pfarrer die Vermögensverwalter einer Pfarrei. Sie hüteten den „Zechschrein“, die Geldtruhe, in der die aktuellen Kirchengelder aufbewahrt wurden. Mit der späteren Gründung eines Pfarrkirchenrates ging diese Verwaltungsaufgabe an diesen über. Allein für den Bereich der Seelsorge ist dagegen das zweite Gremium, der Pfarrgemeinderat zuständig – gebildet ebenfalls aus Mitgliedern der Bürgerschaft und aufgeteilt in einzelne Sachgebiete.
Eine hohe Verantwortung
Zu den Aufgaben der Kirchenverwaltung (in Folge abgekürzt als KV) zählen im Detail z. B. die Genehmigung des jährlichen Haushaltsplanes einer Pfarrgemeinde sowie anfallende Miet- und Pachtangelegenheiten. Zuständig ist sie ebenso für den Erhalt der Gebäude und für das Personal in den der Pfarrei gehörenden Kindergärten. Das Gremium befasst sich auch mit der Auswahl der Bediensteten in der Pfarrei. Vorsitzender des Gremiums ist kraft Amtes stets der Ortspfarrer. Ihn unterstützt der Kirchenpfleger.
Am 10. September 1845 fand in Eschlkam die Wahl statt. Ein Protokoll über die Verpflichtung der gewählten Verwaltungsmitglieder für die Cultus-Stiftung Eschlkam wurde am 29. September verfasst. Zweck dieser Stiftung war und ist die dauernde bestimmungsgemäße Verwendung der für kirchliche Zwecke aufgebrachten und in Zukunft aufzubringenden Mittel, verwaltet durch die KV. Bestätigt wurden die gewählten Vertreter der Kirche am 24. September von der königlichen Regierung von Niederbayern, vertreten durch das Landgericht Kötzting als deren untergeordnete Behörde. Somit lud man wenige Tage später, am 29. September, die neugewählten und so bestätigten Mitglieder der Kirchenstiftung Eschlkam (KV) vor, „damit im Rathaus-Lokale ihre Verpflichtung und Einweisung in die Funktionen gemäß des revidierten Gemeinde Edikts vorgenommen werde.“
Es waren dies: Josef Neumaier, bräuender Bürger als Kirchenpfleger (Nr. 1/heute Waldschmidtstr. 14); dann Josef Späth, Metzger (Nr. 5/Further Straße 1) und Anton Baumann, Ökonom (Nr. 21-dieses Anwesen steht nicht mehr) als Mitglieder. Als „Ersatzmänner“ waren bestimmt: Simon Moreth, Lederer (Nr. 42/Blumengasse 7) und Michael Dachauer, Schmied (Nr. 6/Kleinaigner Straße 1). Zum neuen Gremium gehörte auf Weisung des Landgerichts auch ein Abgeordneter des Magistrats, in diesem Fall der Ratsherr Mathias Späth (Nr. 35/Marktstraße 7). Er war das Bindeglied zwischen der KV und dem Marktrat. Als „Kirchenverwaltungs-Vorstand“ fungierte Pfarrer Karl Pittinger. Er leitete die Pfarrei von 1843-1859.
Ein hochoffizieller Akt
Pittinger war die Aufgabe zugewiesen, nun die Vorschriften des Gesetzes vom 1. Juli 1834 über den Wirkungskreis und die vorgeschriebene Geschäftsführung der KV vorzutragen. Demnach durfte kein Mitglied „je einmal oder auf irgend eine Art Antheil nehmen an einer vom Staate nicht gebilligten Gesellschaft, auch amtliches Stillschweigen nach Vorschrift beobachten, keine Geschenke etc. annehmen“. Daraufhin legten die neuen KV-Mitglieder folgenden Eid ab:
1. „Wir schwören Treue dem Könige, Gehorsam dem Gesetze u. Beobachtung der Staatsverfassung, so wahr uns Gott helfe und sein hl. Evangelium.
2. Wir geloben auch die Vorschriften des Gesetzes vom 1. Juli 1834 für die neue Kirchenverwaltung, sowie die vorgeschriebene Dienstordnung nach den Regeln des Geschäftsganges genau zu befolgen.
3. Wir schwören, daß wir zu keiner geheimen Gesellschaft (z. B. die Freimaurer) oder irgend einer Verbindung gehören, deren Zweck dem Staate unbekannt und von demselben nicht gebilligt, oder den Interessen des Staates fremd ist; auch in Zukunft wollen wir einer solchen Gesellschaft oder Verbindung niemals angehören, so wahr uns Gott helfe und sein Hl. Evangelium.“
Das so gefertigte Protokoll wurde von allen Beteiligten unterzeichnet. Gerade das in der Eidesformel deutlich genannte Verbot, Mitglied irgendeiner „geheimen Gesellschaft“ zu sein, verdeutlicht die Sorge des Staates vor den gerade damals in der Bevölkerung aufkeimenden revolutionären Bewegungen, gerichtet gegen die Monarchie. Die Französische Revolution, ausgegangen in Paris im Jahr 1789, und ihre fatalen Folgen waren den Herrschenden in noch allzu guter Erinnerung. Man wollte Sicherheit im Lande und schuf so Möglichkeiten den Anfängen zu wehren. Dazu noch folgende Feststellung: Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 gehört zu den folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution – das betrifft insbesondere die Menschenrechte – waren in der Folgezeit mitursächlich für tiefgreifende macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa und sie haben das moderne Demokratieverständnis entscheidend beeinflusst.
Werner Perlinger
Das ehemalige „Badhaus“ im Markte – eine wichtige der Gesundheit dienende Einrichtung in alter Zeit
+Eschlkam. Fährt man auf der Further Straße kommend am Ortsanfang von Eschlkam links abbiegend nach Kleinaign, so fällt dem
 aufmerksamen Betrachter das Anwesen mit der Hausnummer Kleinaigner Straße Nr. 3 ins Auge, früher trug es die Nummer 7. Wohl kein Bürger weiß mehr welche Bedeutung einst der Vorgängerbau dieses Hauses vor 200 und mehr Jahren für die Infrastruktur des Marktes hatte. Der ältere Hausname lautet zunächst „beim Farber“, da die Familie Wernhard 1845/46 das Anwesen von den Erben der Baderfamilie Schoeppel kaufte und dort für einige Zeit eine Färberei betrieb. Der jüngere und mehr geläufige Name „beim Bruifarber“, eigentlich ein zweiteiliger Name, bezieht sich einmal auf die genannte Familie Wernhard, hauptsächlich aber auf die später das Haus besitzende Familie Stauber, die von etwa 1860 an bis zur Stilllegung noch vor 1923 teils die Bräumeister im gegenüber liegenden Komunebrauhaus stellten. Der wirklich alte Hausname aber, „beim Boda“, ist nicht mehr bekannt.
aufmerksamen Betrachter das Anwesen mit der Hausnummer Kleinaigner Straße Nr. 3 ins Auge, früher trug es die Nummer 7. Wohl kein Bürger weiß mehr welche Bedeutung einst der Vorgängerbau dieses Hauses vor 200 und mehr Jahren für die Infrastruktur des Marktes hatte. Der ältere Hausname lautet zunächst „beim Farber“, da die Familie Wernhard 1845/46 das Anwesen von den Erben der Baderfamilie Schoeppel kaufte und dort für einige Zeit eine Färberei betrieb. Der jüngere und mehr geläufige Name „beim Bruifarber“, eigentlich ein zweiteiliger Name, bezieht sich einmal auf die genannte Familie Wernhard, hauptsächlich aber auf die später das Haus besitzende Familie Stauber, die von etwa 1860 an bis zur Stilllegung noch vor 1923 teils die Bräumeister im gegenüber liegenden Komunebrauhaus stellten. Der wirklich alte Hausname aber, „beim Boda“, ist nicht mehr bekannt.
Aber zunächst einiges über die Bedeutung der sog. „Boda“ oder „Bader“ in früheren Zeiten: Das wesentliche Element der Krankenversorgung waren in größeren Dörfern, Märkten und in den kleineren Städten früher die Bader und Wundärzte. Sie führten in der Regel im Auftrag der Kommune ein sog. Badehaus, eine Einrichtung ausschließlich für die Möglichkeit ein der Gesundheit dienliches Bad zu nehmen, hauptsächlich aber auch für die Krankenpflege im Allgemeinen. In der beginnenden Neuzeit kann beispielsweise das Dorf Arnschwang im Jahre 1577 ein „Badhaus“ oder eine sogenannte „Badestube“ vorweisen. Dies ist ein Beweis dafür, dass damals nicht nur in den gehobenen Ständen sondern auch auf dem Lande ein hygienisches Bedürfnis nach Warm- und Dampfbädern bestand. Der namentlich früheste Bader in unserem Raum kann für Furth in einer Chamer Urkunde vom 14. April 1505 als „Matheus, Pader zue Furtt“ nachgewiesen werden.
Vielfältige Tätigkeiten
Die Bader übernahmen an ihren Kunden in der Regel auch das Reinigen und Befreien von Ungeziefer, das Scheren (Haareschneiden), Massieren und Rasieren. Sie behandelten Wunden und verstanden das Schröpfen (um Schadstoffe aus dem Körper zu entfernen, werden gläserne Saugglocken auf die zuvor eingeritzte Haut gesetzt. Der Unterdruck zieht Blut aus den kleinen Schnittwunden). Auch Aderlassen und Zahnbrechen gehörte dazu; gemeint ist die meist sehr schmerzhafte Entfernung von schlechten Zähnen. Ratsprotokolle und Kammerrechnungen erwähnen im Zusammenhang mit der Aburteilung von Raufereien immer wieder die dann nötigen Wundbehandlungen, die vom Bader am Ort vorgenommen wurden. Vom Patienten heißt es in der Regel: er ist mehrere Tage oder gar Wochen „unter dem Padter gelegen...“, was schließlich dem Verursacher meist teuer zu stehen kam. In der Stadt Furth betrieben im 16. Jahrhundert und später die Bader ihr Gewerbe im Anwesen Lorenz-Zierl-Straße 8, heute der Gasthof Mühlberger. Und so erinnert an das ehemalige städtische Bad noch der alte Name „Padtor“ für das Burgtor gegenüber. Vorerst sei anzumerken, dass das erste Eschlkamer Bad wohl bereits in der Zeit der Hussitenkriege (1420-1433) sich nicht in dem hier besprochenen Anwesen befand, sondern im Tal am Chambfluß. Dazu informiert eine Steuerliste für das Jahr 1477, als zwei dem Herzog gehörende „Vischwasser auf dem Kamp“ erwähnt werden: Das eine „hebt sich an (beginnt) bei der alten Padstubn zu Eschelkamb (wahrscheinlich gelegen nahe der Heuhofer Mühle) und geet bißs in Rieder Furrtt (seichter Flussübergang bei Stachesried)“.
1685 erstmals erwähnt
Das spätere, nun besprochene Badhaus dürfte vielleicht noch im ausgehenden 15. Jahrhundert im Schutze des Marktes an der Kleinaignerstraße eingerichtet worden sein. Wegen des hohen Wasserbedarfs war bei Inbetriebnahme dazu eine reichlich fließende Brunnenquelle nötig, die in dieser Hanglage sicher auch vorgegeben war. In den die steuerpflichtigen Hausinhaber nennenden Listen von 1534 und 1560 werden ein Bad oder das Badhaus nur deshalb nicht aufgeführt, da der Markt Eigentümer dieser Einrichtung war und nicht ein Privatmann. Das änderte sich jedoch nach dem Dreißigjährigen Krieg. So wird auf dem Anwesen Kleinaigner Straße 3 im Jahr 1685 erstmals ein Stephan Mauser als „Baderjung“ (Lehrling) seines Vaters Wolfen Mauser erwähnt. Wie die folgende Auflistung der Besitzer unseres Anwesens an der Kleinaignerstraße zeigt, hatten die einzelnen Baderfamilien wie die Mauser und später die Grauvogel in der Marktgemeinde gesellschaftlich einen beachtlichen Stellenwert. So heiratete beispielsweise im Jahr 1752 der Gastgeber Franz Antoni Schmirl (heute Gasthof Penzkofer) Anna Maria Mauser, Tochter des Baders und Mitglied des Innern Rats, Paul Mauser. Die Mauser, damals eine einflussreiche und wohlhabende Familie in Eschlkam, lebten und wirkten im Badhaus bis zum Jahr 1774. Dann heiratete mangels männlichen Nachwuchses der Bader Michael Grauvogel als „burgerlicher Chyrurgus“ ein (damalige Bezeichnung für den Wundarzt). 1838 erwarb von Xaver Grauvogel das Anwesen der Bader Georg Schoeppel, der aber als Ökonomiebürger die „Baderei“ kaum mehr ausübte. Wenig später, 1845, kaufte der approbierte Bader Jakob Herzog, zugezogen aus Deggendorf, nur die auf dem Haus ruhende „Badergerechtigkeit“ und ließ sich zunächst im Markt im Haus Nr. 34/Marktstraße 5 nieder. Damit erlosch auf dem Anwesen Kleinaigner Straße 3 die lange Tradition einer frühärztlichen Einrichtung, was heute nicht mehr bekannt ist. 2020 ist Luise Baumgartner, geb. Stauber, die Inhaberin des Hauses.
Werner Perlinger
Flurschützen – Flurwächter und Waldaufseher im 19. Jahrhundert
+Eschlkam. „Flurschützen“ oder Feldhüter ist die Bezeichnung für Personen im Dienste von Gemeinden zum Schutz der Felder und Fluren. Sie sind Flurwärter, denen die Sicherheit auf den landwirtschaftlich genutzten Feldern und Wiesen obliegt. So sollten sie potenzielle Diebe davon abhalten, Kartoffeln, Feldfrüchte allgemein sowie Gemüse und Obst zu entwenden oder tatsächliche Diebe auf frischer Tat stellen. Ertappten sie einen Dieb, durften bzw. mussten sie das gestohlene Gut an Ort und Stelle „pfänden“ (einziehen). Daher wurden sie in unserer Sprache meist als „Pfenter“ bezeichnet. Zumindest früher waren die Feldschützen mit einem Gewehr, später mit einer Pistole, bewaffnet. In manchen Regionen waren diese Feldhüter bis in die 1970er Jahre im Einsatz. Aus den Unterlagen des Marktarchivs geht nicht hervor, ob im 19. Jahrhundert die Flurschützen eine Waffe mit sich führten.
Im Jahr 1848, am 1. Mai, wurde der Marktdiener Franz Pinzinger (Nr. 62/Großaigner Straße 5) zusätzlich als Flurschütze bestimmt. Ursache dafür war, dass die „hiesigen Oekonomiebesitzer“ sich beklagten, es würden „in ihren Gründen durch Einhütung (des Viehs)“ stets größere Schäden verursacht und vor allem auch im „Karpflingholz häufige Holzfrevel“ vorkommen. Um hier Abhilfe zu schaffen wurde der Marktdiener Pinzinger herangezogen und ihm als zusätzlichen Lohn 30 Gulden (jährlich) zugesagt. Ein Jahr später, am 16. Mai 1849, gab der Magistrat bekannt, dass im „Karpflingerholz“ trotz ausdrücklichen Verbotes der Regierung vom Jahr 1841, nach wie vor Vieh eingehütet werde, und der Magistrat drohte, dass „alle dieser Verordnung Zuwiderhandelnden unnachsichtlich“ bestraft würden; aber auch die, welche „in Straßengräben und Feldrainen Vieh weiden oder grasen lassen“.
Nachteile erkannt
Über Jahrhunderte war es Brauch – bevor langsam und immer mehr die uns für das Vieh wohl bekannte Stallhaltung sich durchsetzte und diese üblich wurde – die Haustiere, ob Rindvieh, Schweine oder Ziegen, in den Wäldern Sommer wie Winter das Futter suchen zu lassen. Dagegen schritten nun in Bayern noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Forstverwaltungen ein, nachdem sie die für den Holzwuchs schädlichen Wirkungen erkannt hatten. Als Ersatz gab es, wie lange zuvor auch schon, einzelne hochgelegene, eigens ausgewiesene Weideplätze wie z. B. am Hohenbogen die „kleine Ebene“ für die Bauern, die am Fuße des Berges ihre Höfe hatten. Im Bayerischen Wald sind es die Schachten, oder im Gebirge entstanden weiter entwickelt so die Almen.
Am 16. April 1858 beschwerte sich Karl Pittinger als „Pfarrer und Ökonom“ (er führte von 1843-1859 als wirtschaftliche Grundbasis einen sog. Ökonomiepfarrhof), dass kurz nach der Aussaat des Sommergetreides „viele Hühner und Tauben sich auf meinem Schlosserhäng- und Gartenhängfelde (die Pfarrwiden östlich unterhalb der Kirchhofmauer) sehr oft einfinden und den eben ausgestreuten Getreidesamen aufklauben“. Er bat um Abhilfe und drei Tage später, am 19. April, versprach der Magistrat, dass seit dem 15. des Monats ein Flurwächter verpflichtet wurde „und man es nicht ermangeln laßen wird, gegen Flurfrevler (gemeint sind in diesem Fall die Besitzer der Hühner und Tauben) mit der zu Gebote stehenden Strafe fürzuschreiten“.
Die Waldaufseher
Neben den Flurschützen gab es noch die Waldaufseher. Ihnen sei eine eigene Betrachtung gewidmet. Es war im Jahr 1851, als am 13. April die Aufnahme eines >Waldaufsehers< für die Waldung „Hohenbogen“ anstand. Dazu versammelte sich am 13. April die Eschlkamer Bürgerschaft im Rathaus. Zwei Kandidaten standen zur Wahl: Es waren dies der bisherige Aufseher Joseph Bachmaier und der Privatier Anton Maurer (Nr. 1 ½ /Waldschmidtstraße 12). Es kam zur Abstimmung und Bachmaier erhielt - für ihn wohl unerwartet - keine einzige Stimme; dagegen Maurer sämtliche der 15 in der Hohenbogen-Waldung besitzenden Bürger. Beurteilt als ein „sehr gut beleumundeter und rüstiger Mann“ wurde Maurer am 16. April „auf das Rathaus citiert“, dort über seinen neuen Aufgabenbereich belehrt und mit dem Befehl, dass „er seine Verpflichtungen genau, gewissenhaft und unparteiisch erfülle“, nahm ihm der Magistrat das „Handgelübde“ ab.
Eine andere Aufgabe
Die Tatsache, dass Bachmaier als Waldaufseher keine Stimme mehr erhielt, lag wohl daran, dass die Bürger wie auch der Magistrat für ihn einen anderen Aufgabenbereich vorsahen. Am 1. Mai, nur zwei Wochen nach der Wahl des Waldaufsehers, kamen 13 stimmberechtigte Bürger – es waren die Landwirte im Markt – überein, Joseph Bachmaier für das Jahr 1851 als Flurwächter aufzunehmen. Dabei verpflichteten sich die genannten Bürger, an Bachmaier für jedes Tagwerk eines Grundstücks 1 Kreuzer zu zahlen. Vom Magistrat wurde er im Rathaus als Flurwächter bestätigt und man „ermahnte ihn schließlich noch zur genauen Vollziehung seines Flurwächterdienstes“.
Diese Dienste waren in der Regel auf ein Jahr befristet, denn am 6. Mai 1852 wurde der Häusler Anton Ruhland als „Holzaufseher“ für die seit 1788 der Bürgerschaft gehörende Waldung „Karpfling“ und zugleich auch als Flurwächter in der Gemeinde bestimmt. Als Jahresgehalt für beide Dienste wurden ihm auf Grund der Doppelfunktion 33 Gulden zugesprochen. Auch er wurde „schließlich noch zur genauen Vollziehung seines Flurwächter- und Holzaufseherdienstes verpflichtet“.
Werner Perlinger
Die Tätigkeit der Feldgeschworenen in Eschlkam
+Eschlkam. Feldgeschworene wirken in Bayern bei der Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen und Flurstücken mit. Sie setzen Grenzsteine höher oder tiefer, entfernen Vermessungspunkte oder ersetzen beschädigte Vermessungspunkte. Als Hüter der Grenzen und Abmarkungen in einem Gemeindegebiet arbeiten sie eng mit Vermessungsbeamten zusammen. Für die Feldgeschworenen gibt es landauf, landab eine Vielzahl alternativer Bezeichnungen mit teilweise nur regionaler Verwendung. Der bekannteste Name bei uns lautet für sie die „Siebener“, denn es mussten stets sieben Personen aus dem Gemeindebereich sein, die um die Lage der Grenzen und der sie markierenden Steine Auskunft geben konnten. Die „Sieben“ ist eine sog. „heilige Zahl“, überliefert in der Bibel, als Gott die Welt in 6 Tagen erschuf und nach Vollendung seines Werkes den 7. Tag als Sabbat bestimmte.
Die Feldgeschworenen gibt es seit dem 12./13. Jahrhundert. Sie dürfen einmal gesetzte Grenzzeichen suchen und aufdecken, wenn ein Grundstückseigentümer dies beantragt. Ferner dürfen Feldgeschworene innerhalb eines engen gesetzlichen Rahmens Abmarkungshandlungen in eigener Zuständigkeit und Verantwortlichkeit vornehmen. Über die Abmarkung, die einen Verwaltungsakt darstellt, fertigen die Feldgeschworenen ein Protokoll.
Setzen von „Siebenerzeichen“
Die Feldgeschworenen kennzeichnen die Lage der Grenzpunkte mit geheimen Zeichen. Diese werden auch Unterlagen, Beleg, Zeugen oder „Geheimnis“ genannt. Die „Siebenerzeichen“ sind meist besonders geformte und beschriftete Zeichen aus dauerhaftem Material, wie z. B. aus gebranntem Ton, Glas, Porzellan oder Metall. Sie werden im Bereich des Grenzsteins in einer bestimmten nur den Feldgeschworenen bekannten Anordnung ausgelegt. Die Art dieser Anordnung bezeichnet man als „Siebenergeheimnis“. An Form und Lage der Zeichen erkennen die Feldgeschworenen bei einer Nachschau, ob der Stein in seiner Lage unrechtmäßig verändert wurde.
Auch in Eschlkam waren seit jeher und sind noch heute die Feldgeschworenen tätig. Im Marktarchiv findet sich aus dem 19. Jahrhundert ein Protokoll über die Bestellung eines Obmannes für die Feldgeschworenen sowie auch ein Tagebuch über deren Tätigkeit. Am 24. Juli 1876 wurden vom Bürgermeister die Feldgeschworenen auf das Rathaus gebeten um einen neuen Obmann aus ihrer Reihe zu wählen nachdem der bisherige, der Kaufmann Wolfgang Riederer (Nr. 61/Großaigner Straße 1) verstorben war. Als Feldgeschworene werden aufgezählt: Georg Seidl, Bürger und Hausbesitzer (Nr. 56/Blumengasse 8); Mathias Späth, Wirt und Metzger (Nr. 35/Marktstraße 7); Anton Regner, Bürger und Hausbesitzer (Nr. 18/Further Straße 8); Josef Stauber, Handelsmann (Nr. 59/Marktstraße 13); Georg Hastreiter, Bäcker (Nr. 23/Marktstraße 2) und Franz Rötzer, Wirt und Bäcker (Nr. 19/Further Straße 4 u. 6). Als neuer Obmann wurde einstimmig von der Gemeindeverwaltung Georg Seidl als ältestes Mitglied der Gruppe bestimmt. Seidl wurden dann die „Dienst-Instruktionen eingehändigt“, die Mitglieder nochmals auf ihre Pflichten hingewiesen und „ihnen ferner bedeutet, daß das nunmehr anzufertigende Dienstbuch, welches vom Obmann Georg Seidl zu führen sein wird, zum Gebrauche beim hiesigen Bürgermeisteramte aufbewahret bleibe“.
Wahl des Obmanns annulliert
Das Landgericht Kötzting bemängelt als übergeordnete Behörde am 31. Juli, dass nur sechs Feldgeschworene in der Gemeinde vorhanden seien. Ein weiterer, der siebente, sei neu zu wählen. Auch sei die Wahl Seidl’s zum Obmann „von Staatsaufsichts wegen anulliert“ da diese Wahl allein nur die Feldgeschworenen „auf dem vorgegebenen gesetzlichen Wege“ vornehmen könnten. Und so wird es dann auch geschehen sein, denn am 30. Oktober schritten Bürgermeister Pfeffer (wohl von Nr. 3/Waldschmidtstraße 8 - „Hoamader“); der Obmann der Feldgeschworenen, Georg Seidl; der Polizeidiener Pinzinger (Nr. 62/Großaigner Straße 5) und der Marktschreiber im Rahmen einer „Grenzbesichtigung“ die Gemeindegrenzen Eschlkams ab. Die Gruppe ging vom Markt aus zum Chamb hinunter, weiter „stromabwärts“ zum Moosbauern, dann über den „Karpflinger Hügel“ und Rappendorf über Ritzenried zur Jakobsmühle und von da auf die Leminger Höhe entlang der Stachesrieder Grenze zurück „zur Brücke über den Chambflusse und retour“ in den Markt. „breve manu“ (kurzerhand) wurde dieses Protokoll als „Ausweis der geschehenen Grenzbesichtigung an das kgl. Bez(irksamt- heute Landratsamt Kötzting)“ geschickt. Es unterschrieben Bürgermeister Pfeffer, Obmann Georg Seidl und der Polizeidiener Pinzinger.
Erhalten hat sich im Archiv auch ein Tagebuch der Feldgeschworenen von 1897/98. So wurde u.a. „am 16. April 1898 die Vermarkung des Hausplatzes des Egid Hunger (Nr. 11/Kleinaigner Straße 9) durch die Feldgeschworenen richtig vollzogen“. Es unterschrieben Obmann Georg Seidl, Franz Waitzer (Nr. 9/Kleinaigner Straße 7) und Heinrich Stauber. Am Rande wurde bemerkt: „mit Geheimnis-Unterlage“, d.h. mit der in das Loch für den Grenzstein abgelegten Siebenerzeichen, den geheim gehaltenen Gegenständen wovon nur die Feldgeschworenen wussten, als Schutz vor dem bei Nacht und Nebel rechtswidrig handelnden „Moar- oder Grenzstoarucka“, den damals jeder Grundbesitzer fürchtete.
Werner Perlinger
Verbotener „Umgang“ kam vor Gericht – dennoch war keine Entscheidung nötig
+Eschlkam. Mit der Erhebung Eschlkams in den Status eines Marktes im frühen 13. Jahrhundert, hatten der jeweilige Bürgermeister und sein „Innerer Rat“ neben der Verwaltung auch die >Niedere Gerichtsbarkeit< inne, während die „Malefizfälle“ (schwere Verbrechen wie Raub, Mord, Vergewaltigung etc.) vom Landgericht in Eschlkam selbst bis 1429 und dann in Kötzting bis zur Aufhebung im frühen 19. Jahrhundert abgehandelt wurden. Der justizielle Bereich >Niedere Gerichtsbarkeit< umfasste meist kleine Diebstähle, Beleidigungen, Raufereien, Leichtfertigkeiten (z. B. vorehelicher oder unerlaubter Geschlechtsverkehr), Verstöße gegen das Weiderecht und den Feuerschutz sowie die Entheiligung der Sonn- und Feiertage.
Wir wollen uns mit einem Fall beschäftigen, den die Marktbehörde zu bearbeiten hatte und drehen das Rad der Zeit dieses Mal einige Jahrhunderte zurück. 1687, am 7. Juli, so der Inhalt des Ratsprotokolls aus diesem Jahr, musste sich der Marktrat rechtlich mit einer sehr pikanten Angelegenheit befassen: „Jörg Oxenmayr, Burgersohn und seines Handtwerkchs ein Schuhmacher“, erhob Klage gegen Wilhelm Hager, Organist. Dieser habe in der Öffentlichkeit „ausgegeben, er (Ochsenmeier) wehre bei alhiesigers H. Pfarrers Köching gelegen, und (habe) mit selbiger S.V. (salva venia…mit Erlaubnis) Unzucht gethriben, daß ihme reverendo (mit Verlaub) die Fiss gezittert haben, und darf auch (der) Cleger nur in den Pfarrhof gehen, die Köchin gebe ihme Essen und trinkhen, und sodann nur gleich das Maull wischen, widerumben darvon gehen“. Damit ist gemeint, Ochsenmeier werde im Pfarrhof stets bewirtet wann immer er komme. Der junge Oxenmayr dürfte der Sohn des Mesners Andre Oxenmayr gewesen sein, welcher damals das Anwesen Nr. 61/ Großaigner Straße 1 innehatte. Dies würde auch erklären, dass der junge Ochsenmeier wegen der Tätigkeit seines Vaters im Gegensatz zu den Mitbürgern einen leichteren Zugang zum Pfarrhofe hatte. – Ein sittlich schwerer Vorwurf, daher fordert Ochsenmeier, der von ihm beklagte Hager solle dies erst beweisen oder „ainen Abtrag thuen“, d.h., sich für eine solche Behauptung entschuldigen.
Den Beweis gefordert
Der Organist Hager wirkte zugleich auch als Schullehrer im Markte. Das erfahren wir aus dem Ratsprotokoll vom Jahr zuvor. Darin wird dem Schulmeister Wilhelm Hager vorgeworfen: Die Kinder könnten schlecht Lesen und Schreiben; im Rechnen seien sie „gar nit underwissen worden“. Mehr Fleiß im Dienst wurde von der Marktführung angemahnt. Hager hatte, so gesehen, gerade in dieser Zeit offenbar keinen leichten Stand in der damaligen Bürgerschaft.
Hager aber blieb bei nochmaliger Befragung bei seiner Behauptung insoweit, als er vortrug, er könne dem „vom Cläger eingeclagtes nit widersprechen, allein er habe solches von dem alhhiesigen Mezger Knecht in beisein des aldasigen Adstanten (Hilfslehrers) Georgen Pelsterl gehört“. Dafür wollte Ochsenmeier als „Cleger die prob haben“, d. h. diese beiden Personen sollten zur Aussage beigezogen werden.
Hager jedoch „verharrt bei seiner Antwortt (Aussage), und wills mit sambt seinem leiblichen Jurament (Eid), neben des (im Beisein von) Pelsterls rechtsbemüegrig (rechtskräftig) erweisen, da der Mezger Khnecht desgleichen red, von ihme Cleger ausgeben habe“ (über den Kläger dasselbe sagte).
Verfahren zunächst vertagt
Irgendwie waren die Ratsherren und der Bürgermeister ratlos. Sie konnten vorerst keine Entscheidung treffen. „Weil man aber“, so der Marktrat, „dis Orths nit sechen (erkennen) khann, daß diese Sach von ainer Wichtigkheit (wirklich wichtig, oder bedeutend wäre), also würdet denen Partheyen der güettliche Vergleich vorgeschlagen“. Dieser sollte innerhalb von 8 Tagen erfolgen. Sollte es aber dazu nicht kommen, möge in dieser Angelegenheit zunächst eine weitere „Erfahrung eingeholt“ werden. Das Verfahren wurde deshalb vertagt. Bei weiterer Nachschau im Ratsprotokoll findet sich zu dieser Angelegenheit kein weiterer Eintrag mehr. Offenbar hatten sich der junge Ochsenmeier und der Organist und Lehrer Wilhelm Hager außergerichtlich verglichen, d.h., Hager hatte sich für seine Behauptungen entschuldigt, so dass Ochsenmeier sein Klagebegehren zurückzog. Damit waren sicher auch der Bürgermeister und seine Ratsherren über die Wendung des Falles glücklich, da sie von einer weiteren Untersuchung dieser für den Markt und seinen Bewohnern unangenehmen Sache entlastet waren - gerade auch was den alltäglichen Ratsch betraf.
So wird es auch gewesen sein, denn knapp zwei Jahre später, am 16. Juni 1688, bat Georg Oxenmayr, noch ledig, den Marktrat, „ihn in ansehung aines alten Burgersohnes (aus alteingesessener Familie stammend) vor ainen Undersessen an- und aufzunehmen“, da „er sich zuverheurathen willens“. Die Ratsherren akzeptierten den Wunsch und nahmen den jungen Schuhmacher für einen „Inwohner“ auf. Bei diesem Rechtsakt versprach er, dass er sich „gehorsamblich verhalte“ und darauf leistete er das „gewohnliche Handtglib“ (Gelöbnis per Handschlag). Ein „Undersess“ oder „Inwohner“ bedeutete damals den Mieter einer Wohnung, da er kein eigenes Haus besaß.
Werner Perlinger
Als der Marktschreiber und nicht der Bürgermeister den Markt regierte
+Eschlkam. Im Jahr 1808 kam es zu einer grundlegenden Neuordnung der staatlichen Verwaltung Bayerns, die von dem Staatsjuristen Graf Maximilian von Montgelas geplant und initiiert wurde. Dieser war damals der leitende Minister in dem zwei Jahre zuvor von Napoleons Gnaden gegründeten Königreich Bayern. Obwohl der ersten bayerischen Konstitution (Verfassung) von 1808 für die Neuorganisation der staatlichen Verwaltung keine lange Lebensdauer beschieden war, war sie bereits ein weiter Schritt hinein in die Zukunft des modernen Verfassungsstaates und der modernen Staatsbürgergesellschaft. Bereits nach zehn Jahren wurde sie durch die wesentlich umfangreichere Verfassung von 1818 abgelöst.
Diese eingeleiteten Verwaltungsreformen, beginnend mit dem Gemeindeedikt vom 24. September 1808, beseitigten zwar vorerst die auf den alten Privilegien bestehende Selbstverwaltung der Städte und Märkte. Sie bildeten aber auch die Grundlage für eine landesweite Kommunalorganisation, die den mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Gemeinden schon ab dem zweiten Gemeindeedikt vom 17. Mai 1818 mehr Selbstverwaltungsrechte als bisher einräumte; davon später.
Zum Jahr 1808: Das politische Streben, ausgehend vor allem von Innenminister Graf von Montgelas zu Anfang des 19. Jahrhunderts war, das Land Bayern zu einem zentralen Einheitsstaat werden zu lassen, allein ausgerichtet auf den gerade herrschenden Monarchen, den König Max I. Joseph. Auf regionaler Ebene war es Absicht des zentralen Staates, dem jeweiligen Landrichter in seinem Landgerichtsbezirk, für Eschlkam war es Kötzting, alle Gewalt zu übertragen und, damit er seine Aufgaben optimal durchführen könne, die ihm anvertraute Region in Gemeinden einzuteilen. Eine zunächst empfindliche Einbuße hat durch diese eingeleiteten staatlichen Reformen unser märktisches Gemeinwesen erhalten, als die bayerische Regierung unter von Montgelas daran ging, den Gemeinden ihre Selbstständigkeit zu nehmen und sie zu letzten Werkzeugen des Staates zu machen. In diesem Sinne wurde die dem Markt Eschlkam seit dem frühen 13. Jh. zustehende und stets ausgeübte „Niedere Gerichtsbarkeit“ (diese befasste sich mit den geringeren Delikten des Alltags, sühnbar mit Geldbußen oder leichteren Leibstrafen) entzogen und an das Landgericht Kötzting verlegt, sowie auch die Verwaltung des Gemeinde- und Stiftungsvermögens genommen.
Ein mächtiger Mann
Sämtliche bisherige Aufgaben wurden landesweit nun eigenen von der Regierung aufgestellten „Kommunaladministratoren“ übertragen. Für Eschlkam war, wie in anderen Gemeinden auch, für diesen neu geschaffenen Posten der entsprechend dafür gebildete Marktschreiber als „Komunaladministrator“ bestimmt; in der benachbarten Stadt Furth der Stadtschreiber Anton Kaufmann. Kgl. bayer. Kommunaladministrator in Eschlkam durfte sich nun der Marktschreiber Franz de Paula Bach nennen. Er führte die Rechnungsbücher der Marktgemeinde und bestimmte allein den Verlauf der für den Markt wesentlichen Initiativen. Nicht er wurde wie bisher vom Marktrat und dem Bürgermeister angewiesen, sondern er traf kraft seines nunmehrigen Amtes allein die Entscheidungen. Damit war er, politisch betrachtet, der mächtigste Mann in der Gemeinde. Der jeweilige Bürgermeister rückte vom Status her an die zweite Stelle und mit ihm die Markträte.
Dem Marktschreiber Pach wurde, das sei am Rande erwähnt, am 12. Dezember 1809 im Hause Nr. 33/Waldschmidtplatz 2 (Rathaus) der Sohn Alois (P)Bach geboren, der im 19. Jahrhundert als Freund und Kollege des Malers Carl Spitzweg eine der berühmten Malerpersönlichkeiten in Ostbayern werden sollte.
Minister von Montgelas wird abgesetzt
Erst nach dem hauptsächlich von Kronprinz Ludwig (König als Ludwig I. ab 1825) erzwungene Abgang des Ministers von Montgelas im Jahr 1817 und mit dem Erlass der zweiten konstituierenden Verfassung für das Land Bayern am 17. Mai 1818 trat eine entscheidende Besserung für die Gemeinden ein. Es wurde nun unterschieden nach Munizipalgemeinden (nach Städteverfassung) mit einem Bürgermeister und nach Ruralgemeinden (nach Landgemeindeverfassung) mit einem Gemeindevorsteher an der Spitze der Verwaltung. Dazu gehörte der Markt Eschlkam. Ruralgemeinde (von lateinisch „rurare“ für „auf dem Lande leben“) ist die im Königreich Bayern in den Jahren von 1818 bis 1835 gebräuchliche Bezeichnung für eine Landgemeinde. Ab 1835 spricht man amtlicherseits nur mehr von Landgemeinden. Deren Verwaltung oblag im Allgemeinen dem Gemeindeausschuss mit dem Gemeindevorsteher (Hauptorgan) an seiner Spitze, dem Gemeindepfleger, dem Stiftungspfleger und drei bis fünf eigens ausgewählten Gemeindebevollmächtigten. Die Mitglieder des Gemeindeausschusses wurden von der versammelten Gemeinde (Gemeindeversammlung) aus deren Mitte gewählt. Die wichtigsten Gemeindeämter sollten nur mit Personen besetzt werden, die zum Kreis der im Markte Höchstbesteuerten gehörten. Die Gemeindeversammlung hatte nur eine beratende Funktion. Frauen, Austrägler und Männer, die keine Steuern bezahlten, galten so gesehen nicht als Gemeindemitglieder.
Und so änderte sich diese Situation auch für Eschlkam im Jahr 1819. Der Magistrat erhielt ab diesem Zeitpunkt einen Katalog von neuen Befugnissen, wie sie mit Ausnahme der „Niederen Gerichtsbarkeit“ zum Teil vorher schon gegeben waren. Dazu gehörte u.a. die Aufnahme von Bürgern, die Ausstellung von Heiratsbewilligungen, oder die Verleihung der Gewerbeerlaubnis. Bald wurde es für die Gemeinde auch zur Pflicht Baugenehmigungen auszustellen.
Dazu letztlich noch einige interessante Details: Unter dem Titel „die Gränzen der Befugnisse der neugebildeten Magistrate betreffend“ können wir lesen, dass in Eschlkam für die Gemeindebevollmächtigten (im Gegensatz zu ihren Kollegen in größeren Städten) bei Ausübung ihres Amtes „keine besondere Kleidung vorgeschrieben ist, sie können sich jedoch (bei Sitzungen und öffentlicher Repräsentanz) anständiger Kleidung bedienen“; ferner: „für das subalterne (der Marktführung untergeordnete) Polizeipersonal kann es gleichwohl bei der bisherigen Uniform verbleiben“. Mit der neuen Verfassung von 1818 erhielt der jeweilige Bürgermeister wieder seinen früheren Status zurück – er allein stand von nun an wieder an der Spitze der Gemeinde.
Werner Perlinger
In Heiratsverträgen wurden von Frischvermählten künftige Besitzverhältnisse geregelt
+Eschlkam. Unter dem Titel „Übergabe in wirtschaftlich schwieriger Zeit“ wurde bereits der im Jahr 1747 erfolgte Besitzerwechsel des Anwesens Waldschmidtstraße 14, heute der Gasthof Penzkofer, zwischen Franz Paul Schmirl (+) und seinem Sohn Franz Anton dem Leser vorgestellt. Nur einige Jahre später ließen Franz Anton und seine ihm angetraute Frau Anna Maria einen Heiratsvertrag ausfertigen, nun Thema dieser Abhandlung.
Einen interessanten Einblick in die sozialen Verhältnisse der besitzenden Marktbürger im 18. Jahrhundert gewähren neben anderen Unterlagen auch die im Archiv von Eschlkam in den Briefprotokollen niedergeschriebenen Heiratsverträge. Abgeschlossen haben solche Verträge meist die mit Grund- und Sachbesitz bereits bei der Eheschließung für damalige Verhältnisse gut ausgestatteten Bürger. Als ein Beispiel aus dem reichhaltigen Fundus sei dem Leser nun der am 26. Mai 1753 geschlossene und vom Marktschreiber protokollierte Vertrag zwischen dem Gastgeber und Besitzer eines der „Hoamaterhöfe“ (heute Gasthof Penzkofer), Franz Anton Schmirl und seiner frisch angetrauten Frau Anna Maria, geborene Mauser unterbreitet:
Laut Inhalt des Vertrags ward festgestellt und beschlossen, dass die angetraute Ehefrau, Tochter des Baders und Mitglied „des Innern Rats (und zugleich) Burgermeister“ Paul Mauser (Nr. 7/Kleinaigner Straße 3) und seiner Frau Anna, ihrem Ehemann 300 fl (Gulden) in bar als Heiratsgut bereits mitbrachte, dann eine „Kuhkalben“ (junge Kuh); ferner „Schreinzeug (Truhen) und Ehrn Kleid (Kleider die nur an den Sonn- und Feiertagen getragen wurden) dergestalten“, dass, sollten ohne Erben der Todesfall eintreten, er, Schmirl, ihren Eltern oder, in Ermangelung dessen, ihren „nächsten Anverwandten neben denen 3 Stuck besten Hals Kleidern (die damalige dem heutigen Dirndl ähnliche Frauentracht, wie wir sie bildlich noch auf alten Votivtafeln in Kirchen, Kapellen oder in Museen bewundern können) vor allem aber 150 fl zurückzuzahlen schuldig sein“.
Feste Vereinbarungen
Ähnliches galt auch für den Ehemann Franz Anton Schmirl. Würde er ohne „Leibserben“ frühzeitig sterben, so sei aus dem am 1. Juli 1747 bereits erlangten Vermögen neben denen „3 Stuck besten Hals Kleidern“ 200 Gulden an seine nächsten Verwandten auszuzahlen.
Würden sich später in dieser Angelegenheit weitere strittige Punkte ergeben, so sollten „solche denen kurbayerischen Landtstatuten und als hergebrachten Observanz (Gewohnheitsrecht) nach decerniert (hier entschieden) und erredet (verhandelt) werden“.
Zeugen und „Beyständter“ aufseiten des Schmirl waren Franz Sebastian Ruesch: verpflichteter „Kürchen- und Marcktschreiber alhier“ (er wohnte im Rathaus), dann Veith Spätt, „ganzer Pauer von Großaign“. Als Zeugen der Schmirlin fungierten der Vater Paul Mauser, Wolfgang Lährnbecher, burgerlicher Weißpöckh (Nr. 60/ Marktstraße 15), und Franz Georg Fischer zu „Unterfaistern“ (Bauer in Unterfaustern).
Zur Bekräftigung der vertraglichen Abmachungen wurde der „gegenwarttige Heuraths Contract auf der Partheyen geziementes Bitten von Magistrats- und obrigkeiths wegen in duplo (zweifach) ausgeferttiget und ieden Thaill davon ein gleichlauthetes Exemplar zuegestellt“. So geschehen in „Eschlcamb den 26. May 1753.“ Als „Sigl Gezeugen“ sind genannt: Balthasar Stoiber (Nr. 35/Marktstraße 7) und Hans Georg Preysinger (Nr. 31/Burgweg 2), beide „burgerliche Schneidermeister“.
Knapp 50 Jahre später ließ sich am 5. April 1800 das frisch getraute Paar Michael Seidl, Handelsmann (Nr. 56/Blumengasse 8) und Anna Maria, geb. Hastreiter einen „Heurats Brief“ ausstellen. Demnach brachte die Braut als Ausstattung mit in die Ehe ein „Ober- und unterbeth (Bettzeug), (einen) Kasten (Schrank), (eine) Truchen (Truhe) und einen Schießlkorb“ sowie 350 Gulden an barem Geld. In diesem Falle nicht aufgeführtt, obwohl bis in die Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg noch üblich, stellen eine Wiege für die zu erwartenden Kinder sowie das Spinnrad mit dem Spinnrocken ebenso feste Bestandteile der Mitgift für die Frauen dar.
Die Gagelhenn
Auch wurde bei den Heiratsabmachungen des Paares Seidl bereits für die Kinder, sollten sie einmal heiraten, die „Gagelhenn mit Bier, Brot und Brandwein“ festgelegt. Die Kosten für diese auch als „Morgenmahl“ bezeichnete kleine Feier, wenn die Tochter oder der Sohn das Elternhaus verlassen, hatte in der Regel der Vater zu tragen. Dieser an sich selten gewordene Brauch ist im Hohenbogen-Winkel heute noch üblich.
Der sog. „Kasten“ war ein meist vom Ortsschreiner zweitürig gefertigter (Braut)schrank, bemalt in den Türfüllungen mit Heiligen- oder Blumenmotiven, in dem die guten Kleider (wie die oben genannten Halskleider) wie auch Leinenballen und andere Textilien aufbewahrt wurden. Die häufig an der oberen Querleiste angebrachte Jahreszahl erinnert an das Jahr der Heirat. Eintürige „Kästen“ waren in der Regel den alleinstehenden Frauen oder Männern vorbehalten, oft den Ehehalten (Mägde oder Knechte) auf den Höfen. Der genannte „Schießlkorb“ ist ein rahmenartiges Gestell, in dem nahe dem Küchenherd an der Wand Teller und kleine Schüsseln für den täglichen Gebrauch aufbewahrt wurden.
Abschließend noch einige allgemeine Erklärungen: Auch bei uns im Hohenbogen-Winkel gab es seit alten Zeiten den Brauch, dass die in ein Anwesen einheiratende Braut zusammen mit ihrer Aussteuer auf einem „Kammerwagen“ zum Haus des Bräutigams gefahren wurde. Transportiert wurden auf einem Leiterwagen die Möbel der ehelichen Schlafkammer, dazu noch Bett-, Tisch- und Leibwäsche, Leinenballen, die Kinderwiege, Geschirr und Stickereien für die gute Stube. Der „Kasten“, das Bett und die Truhe wurden offen auf dem Wagen transportiert, so dass jedermann sehen konnte, was die Frau für den neuen gemeinsamen Haushalt mitbrachte und wie fleißig sie ihre Aussteuer zusammengestellt hatte.
Werner Perlinger
Der Markt Eschlkam in alten Bildern
+
Eschlkam. In einer ganzen Reihe von Aufsätzen wurden bisher verschiedenste archivische Inhalte aus alten Akten des Marktarchivs vorgestellt. Nun sei eine Ansicht aus einem Bilderzyklus es ehemaligen Erzdekanats Cham vorgestellt. Entstanden auf Initiative des Erzdekans von Cham, Johann Freiherr von Wolframsdorf, um das Jahr 1745, zeigt das Gemälde - Öl auf Leinwand - den Markt Eschlkam auf einem Hügel inmitten der bergigen Kultur- und Waldlandschaft. Im Ensemble dominiert die Pfarrkirche St. Jakob mit ihrem barocken Zwiebelturm, umgeben von noch beachtlichen Resten der Kirchenburganlage. Hier erkennen wir, dass der damalige Kirchturm, nahezu völlig neu gebaut im Jahr 1720, einen kleineren Querschnitt in der Grundfläche hatte, als der heutige. Der jetzige Turm wurde von Grund auf 45 Meter hoch neu in den Jahren 1833-1835 gebaut. Er wirkt in der Landschaft himmelwärts gleich einem Zeigefinger Gottes.
Der ehemalige Wehrturm im Nordosten der Anlage, auch Pulverturm genannt, präsentiert sich dagegen heute zur Hälfte abgetragen. Das Mesnerhaus trägt ein Krüppelwalmdach. Die kleinen Lichtschlitze an der Außenmauer des Hauses ersetzen die Fenster und erinnern an die ehemalige Wehrhaftigkeit. So ist auch der heutige Toreingang in den Friedhof, damals dargestellt als kleiner Turm mit einem Pyramidendach, zusätzlich mit Palisaden abgeschirmt. Stattlich wie noch heute nimmt links davon der vor einigen Jahren renovierte Pfarrhof seinen Platz ein. Im Bereich der Pfarrwiden (Feld- und Wiesengründe der Pfarrei) bestellt gerade ein Mann mit dem Pflug ein Feld, wohl der Knecht des Ökonomiepfarrhofes. Im Vordergrund blasen Hirten den Dudelsack und die Schalmei. Am rechten Bildrand erscheinen leicht versetzt die ansehnlichen Gebäude der Hofmark Kleinaign, dabei abgegrenzt die damaligen Dorfhäuser in Holzbauweise. Die nur schwach erkennbare Gebäulichkeit im Tal könnte die Heuhofer Mühle sein. Links unten ist das Wappen des Pfarrers Georg Erhard Amann (1739-1756) mit dem Ortsnamen Eschlkamb angebracht. Über den Wolken thront als Patron der Pfarrei St. Jakobus der Ältere, erkennbar an seinen Attributen Pilgerstab, Muscheln und Streitaxt (als Maurentöter).
Ergänzend zu dieser Betrachtung sei detailliert die Stiftung eines kirchlichen Jahrtages des ehemaligen Pfarrers Adalbert Wagner vorgestellt:
Jahrtagsstiftungen sind heutzutage selten geworden. In früher Zeit, gerade auch im 18. Jahrhundert, als dieses Bild entstand, war es vielen Bewohnern vielfach ein dringendes Anliegen, vor dem eigenen Hinscheiden hl. Messen und Jahrtage zu stiften, natürlich nur wenn ihr Vermögen es ihnen erlaubte. Dafür wurde je nach Möglichkeit ein nicht unansehnlicher Geldbetrag an die Kirche gegeben. Die Jahrtage waren hl. Messen, die jährlich an einem bestimmten Tag, meist dem Sterbetag des Stifters, aber auch als Vigilien (am Vortag des bestimmten Tages), zu lesen waren. Zu Beginn des Jahrtagsgottesdienstes wurde der Name des Stifters verkündet. Die Kosten für die Abhaltung dieser hl. Messe wurden aus dem vorher dafür gestifteten Kapital bestritten.
Durch die Inflation im Jahre 1923 gingen diese Gelder unwiderruflich verloren, was leider zugleich auch das Ende der alten Jahrtagsstiftungen bedeutete. Dieser alte Brauch lebt inzwischen wieder auf, ohne jedoch auch nur annähernd die frühere Bedeutung zu erlangen. In der Hauptsache sind Messintentionen gefragt, das Lesen nur einer hl. Messe gegen eine Gebühr.
Die Stiftung von 1828
Zunächst einiges zu dem Priester Adalbert Wagner: geboren am 21. Februar 1773 in Waldmünchen, wirkte er bis zu seinem Lebensende am 25. März 1828 16 Jahre als Pfarrer in Eschlkam. Dort fand er im Friedhof auch seine letzte Ruhe wie sein mittlerweile im Torhaus des Friedhofs eingelassener Grabstein uns kündet. Sein Nachfolger wurde der Priester Wolfgang Kolbeck.
Als Wagner seinen Tod herannahen fühlte, „vermachte er am 8. März 1828 abends um 5 ½ Uhr als Legat (Stiftung) einen Jahrtag, der in einem Hochamte und solemnen (feierlichen) Requiem bestehen sollte, ein Kapital von Hundert Gulden“. Das Geld war günstig anzulegen, so dass von den Zinsen daraus „die jährliche Verrichtung allerdings verrichtet werden könne“. Damit dieses Kapital für den Jahrtag nicht durch Abzug einer „quarta pauperum et scholarum“ (derjenige Teil der kirchlichen Einkünfte, welcher stets für die Armen und für den Schulfond zu verwenden war) nicht sogleich geschmälert werde, gleichzeitig noch weitere 50 Gulden, halbiert für die Armen und die Schulen zu je 25 Gulden, wobei das Geld für das Schulwesen der ganzen Pfarrgemeinde sofort zu verwenden sei. Als „Testierer“ ermächtigte Wagner das königliche Landgericht Kötzting die 150 Gulden nach seinem Tode „von der ohnehin vorliegenden Geldbarschaft zu sich zu nehmen und zu dem … genannten Zwecke zu verwenden“.
Außerdem hatte Pfarrer Wagner in seinem Testament verordnet, dass von 2000 Gulden, die er bei der K. Staatsschulden Tilgungsspezialkasse in Regensburg angelegt hatte, seine Köchin Margaretha Iberer, Schneidermeisterstochter, „lebenslänglich die Zinsen zu genießen habe“. Nach ihrem Tode aber seien von den Zinsen, aufgeteilt zu je 1000 Gulden Kapital, die armen Familien in der Pfarrei und die armen Schulkinder zu unterstützen. Diese Verfügung konnte erst nach dem Ableben der Köchin Iberer wirksam werden. Sie verstarb 78jährig am 13. Februar 1857 in Hahnbach.
Werner Perlinger
Ein „Kalkant“ hatte im Kirchenjahr ein breites Betätigungsfeld
+Eschlkam. Im Rahmen der „Wiederbesetzung des Todtengräbers und Kalkantendienstes“ (siehe letzten Beitrag) wurden anlässlich der Verhandlungen darüber mit dem Magistrat vom damaligen Pfarrer Karl Pittinger detailliert die Aufgaben des Totengräbers und Kalkanten aufgelistet. „Kalkant“ ist die heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für den Blasbalgtreter an der Orgel, oder auch Kirchendiener. „Regelmäßige Verrichtungen des hiesigen Totengräbers, der zugleich Orgelblasbalgzieher, der zugleich Sakristeidienstgehilfe ist,“ so titelt die im Original wiedergegebene Stellungnahme Pittingers vom 4. Januar 1855. Minutiös zählt der Pfarrer sämtliche Pflichten auf, die der Kalkant und der Totengräber während des Jahres zu erfüllen hatten.
Bezüglich des Kalkanten heißt es unter Punkt I: „Auf dem Chor allemal ohne Ausnahme nicht bloß bei den Vor- und nachmittägigen Gottesdiensten, sondern auch bei allen kirchlichen Musikproben, so oft die Orgel gespielt wird, die Blasebälge zu ziehen, oder ziehen lassen durch jemand andern.
Punkt II, gegliedert in 17 Punkten, informiert über den Umfang der Aufgaben in der Sakristei und in der Kirche selbsten: 1) Wenn er nicht auf dem Chor beschäftigt ist, die Ordnung beim Speisegitter u. Altar zu beaufsichtigen, u. die Unruhigen zurecht weisen, u. dem Pfarrer anzeigen; 2) (Das) bei allen Vespern an den Werk- und Feiertagen; 3) An allen Sonn- und Festtagen u. bei pfarrlichen Gottesdiensten; 4)Bei allen Leichengottesdiensten die Pfennige wechseln und ganz gewißenhaft einliefern; 5) Bei den Prozessionen in der Seelen Octav das Crucifix zu tragen; 6) (Dann auch) im Advente bei den gewöhnlichen Roraten; 7) Bei den vorkommenden längeren Wasserweihen besonders zu Ostern, Pfingsten, Stephani, Heil. Drei Königsfeste das Crucifix zu tragen; 8) An Maria Lichtmeßen bei der Prozession und Wachsweihe; 9) An den drei Fastnachtstägen bei Aussetzung des hochwürdigsten Gutes Vor- wie Nachmittag; 10) In der Fastenzeit hindurch bei den Kreuzweg-Andachten das Chrucifix tragen, und Sonn- u. festtägigen Miserieren (Bußgottesdienste); 11) In der Charwoche die letzten drei Tage durchgehends bei den Verrichtungen zu erscheinen wie auch bei den Dunkelmetten; 12) In der Kreuzwoche hat er bei den Prozessionen die Fahne zu tragen; 13) (Auch) am Christi Himmelfahrtstage u. Pfingstfeste bei den Vorstellungen der Auffahrt u. Sendung des heil. Geistes; 14) In den Octaven Johann v. Nepomuck nachmittägigen Litaneien u. in der Octav des Fronleichnams-Jesu Vormittag wie Nachmittag, auch sind von ihm aus für die Kirche die Birken zu besorgen; so auch am Kirchweihfeste und im Patronomium (Patroziniumsfest St. Jakob); 15) In der Charwoche die heil. Oele beim H. Dekant abzuholen ;16) Die Fahnen an den Vorabenden der Feste aufrichten, darnach abzulegen u. aufzuheben, ebenso auch die schönen Himmel mit Beihilfe des Bruderschaftsdieners; 17) Bei der Fronleichnams-Prozession hat er auch für die Tragung der 2 kleinen Fähnchen zu sorgen, wofür er von der Kirche eigens bezahlt wird pro 48 Kreuzer für sich und für diese zwei Träger.“
Punkt III informiert den Leser über die Pflichten des Totengräbers von Seite der Kirche aus: 1) „Im Gottesacker muß er an jedem Abend auf der West- und Südseite die Thore schließen und immer den ganzen Friedhof sehr reinlich halten, besonders keinerlei Vieh darin gedulden, sondern jedes sogleich daraus hinaustreiben. – Jede Unreinigkeit sogleich daraus beseitigen. Die Gitterthüren, welche zur nördl. Hälfte des Gottesackers führen, müssen von ihm oder seinen Angehörigen beim Ein- und Ausgehen geschlossen werden. 2) Die 10 Stafeln beim Aus- u. Eingange des unteren Freythores sind vom Kothe, vom Schnee u. Eis zu säubern, daß Niemand in Gefahr kömmt, zu fallen. – den Schnee in den Gängen des Gottesackers, dort wo der Priester zu den Begräbnissen hingehen muß, wegschaufeln. - Die Gräber müssen allzeit in der polizeilich vorgeschriebenen Tiefe gemacht werden. 3) Nirgendswo darf er ein Grab machen, wenns der Pfarrer nicht gestattet, z.B. nicht zu nahe an den Wegen, nicht allzunahe den Pfarrkirchmauern.- Die vorschrieftsmäßige Tiefe muß er bei jedem Grabe herstellen. - Jedes ungetaufte todte Kind vorher dem Pfarrer ansagen. 4) Hinsichtlich der Einforderung der Gebühren für das Gräbermachen hat er sich an die sowohl in der älteren Faßion als auch in der pfarramtl(ichen). Stol-Gebühren Heften aufgeschriebenen Ansätze, welche ihr ohnehin bekannt sind, unabänderlich zu halten.“
Tiefgreifende Bedeutung
Unzweifelhaft hatte vor 170 Jahren der Kalkant, der zugleich Totengräber war, einen breit gestreuten Aufgabenbereich. Der Magistrat war zufrieden und bestimmte lediglich, dass die Birkenbäume für Fronleichnam „auf Kosten der Pfarrkirchenstiftung herbeigeschafft werden sollen“. Die Dienste des Kalkanten und Totengräbers waren lang schon in einer Person vereinigt, so dass für die Arbeit des Totengräbers jährlich 48 f (Gulden), für die des Kalkanten 36 f zu entrichten waren. Das gesamte Jahreseinkommen betrug demnach 84 f. Dazu ein Vergleich: Ein Maurer kam pro Tag nach 12 Stunden Arbeit auf 40 Kreuzer. Ein Lehrer konnte damals je nach seiner erreichten Position pro Jahr 150-400 Gulden verdienen. Der Gulden wurde zu 60 Kreuzer gerechnet; ein Laib Brot kostete 4 Kreuzer, ebenso 1 Liter Milch. Ein Kaplan hatte ein Jahreseinkommen von 150-200 f, ein Pfarrer (je nach Größe und Bedeutung der Pfarrei) 400-2400 f und der Bischof konnte ein Jahresbudget von 8000 f erwarten. Daher wurden vom Marktrat die Dienste >Kalkant und Totengräber< zusammengelegt, „damit das hiermit betraute Individuum doch ein besseres Auskommen habe, denn von den Erträgnissen des Todtengräberdienstes allein könnte sich Niemand fortbringen; sowie es auch Niemanden möglich wäre, vom Kalkantendienst allein leben zu können“, so die abschließende Feststellung des Magistrats unter Bürgermeister Simon Moreth.
Welche tiefgreifende Bedeutung die Tätigkeit des Totengräbers für den Menschen hat, sei poetisch ausgedrückt in der Abspaltung des Jenseits unüberbrückbar vom Diesseits wenn es heißt:
„Wir graben auf, wir graben nieder, was uns in die Finger fällt kehrt niemals wieder“.
Werner Perlinger
Die Vergabe des Totentgräberdienstes um die Mitte des 19. Jahrhunderts - Ein im Friedhofsgelände sich befindlicher Kuhstall ist für Pfarrer Pittinger ein Ärgernis
+Eschlkam. Am 20. November 1854 tagte das Gremium der Kirchenverwaltung. Einziges Thema war die „Wiederbesetzung des Todtengräbers und Kalkantendienstes“. „Kalkant“ ist die heute nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für den ehemaligen Blasebalgtreter an der Orgel, oder auch für den Kirchendiener allgemein. Die Kirchenverwaltung bildeten damals die Bürger Wilhelm Wernhard (Hsnr. 7/Kleinaigner Straße 3), Anton Baumann (Hsnr. 21/steht nicht mehr), Andrä Plötz (Hsnr. 58/Blumengasse 2) und Andrä Späth (Hsnr. 63/Großaigner Straße 9). Als Kirchenschreiber fungierte der Marktschreiber Joseph Anton Beutlhauser. Als Abgeordneter des Gemeinderates nahm der Krämer Karl Müller (Hsnr. 25/Waldschmidtplatz 8) teil. Den Vorsitz über dieses Gremium hatte Pfarrer Karl Pittinger inne. Als Priester betreute er die Gemeinde von 1843-1859.
Beschlossen wurde, dass nach dem Abgang des Totengräbers Würz seine Witwe Walburga „auf die Lebensdauer, jedoch in widerruflicher Weise unter der Bedingung belassen bleiben möchte, daß sie durch ein würdiges und taugliches Individuum (eine Person) den Totengräber- u. Kalkantendienst versehen lasse“. Eine solche Maßnahme würde in heutiger Zeit für großes Erstaunen sorgen. Doch ist die Erklärung einfach. Damals gab es keine Rentenversicherung. Die Witwe, wohl ohne Vermögen, hätte von der Gemeinde aus der Armenpflegschaftskasse versorgt werden müssen. Daher übertrug man ihr die Organisation des Beerdigungswesens und somit auch einen Teil der Einkünfte. Der andere Teil verblieb bei dem die Grabarbeiten ausführenden oben genannten „Individuum“.
Drei Individuen
Als bereits tätige „Individuen“ im Friedhof werden Georg Denzl, Wolfgang Würz und Franz Xaver Schifferl aufgeführt. Sie sollten auch den Vorzug bei wieder anstehender Bewerbung haben. Befristet wurde die Maßnahme zunächst auf drei Jahre. Schließlich erklärte der Vorsitzende der Kirchenverwaltung – es war Pfarrer Pittinger – „daß er sich das Urtheil über das Individuum vorbehalte, nämlich ob dasselbe würdig oder unwürdig, nachlässig oder fleißig sei“.
Nicht ganz einverstanden mit der provisorischen Übertragung des Totengräberdienstes an die Witwe Würz war der Magistrat. Er bestätigte am 21. November wohl die getroffene Abmachung, was die Übertragung des Dienstes an sich betraf, monierte aber, dass nach dem Tode der Witwe vor allen anderen Bewerbern doch „eines ihrer sie überlebenden Kinder berücksichtigt zu werden verdiene“. Auch sollten „noch würdigere Bewerber als die bereits sich gemeldeten Individuen, sich hervorthun können“. Und dabei blieb es zunächst.
Kuhstall des Totengräbers stört
Bereits Monate vorher, am 28. August 1854, stellte Pfarrer Karl Pittinger an den Magistrat als Ortspolizeibehörde das Ansuchen, dass der Kuhstall, der bereits vom Ehemann der Witwe Walburga Würz in „ungebührlicher Weise an die Kalkanten-Wohnung angebaut wurde, beseitigt werden möchte“, allein schon wegen des Erlasses des „Hochwürdigten Ordinariates Regensburg“ in dieser Sache vom 1. August 1854. Pittinger kritisiert am 19. März 1855, dass noch nichts geschehen sei. Mit den Worten „da die Madame W. Würz bisher noch nicht Folge leistete, oder vielleicht vom Magistrate dazu nicht beauftragt wurde, so wird hierüber um Aufschluß ersucht“. Der Magistrat informierte am 26. März, dass anstelle des Stalls – er ist übrigens im Plan der Erstvermessung als Anbau des Totengräberhauses eingezeichnet – früher dort ein „Abtritt“ (Abort) gewesen sei. Mit Erlaubnis des Pfarrers Adalbert Wagner (1811-1828) wurde im Jahr 1812 „diese für einen Friedhof nicht schickliche Lokalität entfernt und dem Todtengräber Würz die Erlaubnis ertheilt“, an dieser Stelle einen Kuhstall zu errichten. Der Streit um den Abriss zog sich hin. Am 9. Juni 1855 schaltete sich das Landgericht Kötzting ein, schrieb an die „Todtengräbers- und Kalkantenswitwe Würz“, und befahl, nachdem das Ordinariat schon am 1. August 1854 und dann am 27. April 1855 auf Entfernung dieser Gebäulichkeit gedrungen hatte, den Stall „binnen 8 Tagen durch Abbruch aus dem Gottesacker zu entfernen, widrigenfalls solches auf Kosten der Würz von Amts wegen bewerkstelliget werde“. Und so geschah es denn wohl auch.
Bereits am 5. August 1855 hatte der Magistrat beim Landgericht Kötzting beantragt die Gebühren für die Arbeit des Totengräbers erhöhen zu können, was aber die übergeordnete Behörde am 7. April 1856 mit dem Hinweis ablehnte, dass der Dienst nach wie vor der Witwe Würz überlassen sei, „sohin eine neue Dienstverleihung nicht geschehen ist, man keine genugsame Veranlassung finde, eine Erhöhung der Gebühren fürs Grabmachen zur Zeit vorzunehmen, da das kgl. Pfarramt und sämtlich eingepfarrten Gemeinden hirgegen protestiert haben.“ Der Witwe Würz wurde das Schreiben vorgelesen und sie musste die Kenntnisnahme mit ihrer Unterschrift bestätigen. Des Schreibens unkundig unterzeichnete Walburga Würz mit einem Kreuz als bestätigendes Handzeichen.
Im Jahr 1865 musste ein neuer Totengräber und Kalkant gefunden werden. Am 27. Dezember wurde dafür der Maurer Jakob Pinzinger verpflichtet und am 27. Januar 1866 vom Landgericht Kötzting mit der Auflage, „der Abnährung der Todtengräberswitwe Walburga Würz genehmigt“.
Pinzinger allein musste demnach für den Lebensunterhalt der Walburga Würz sorgen, damit von dieser Last die Gemeinde nicht betroffen war. Auch hatte er über seine Arbeit ab sofort ein genaues Protokoll zu führen und dieses bei Bedarf stets vorzulegen, „da durch den jüngst geführten Kirchenerweiterungsbau (1865 wurde das Langschiff um das Doppelte verlängert) der Gottesacker in Bezug auf die Begräbnisplätze in Unordnung gerathen ist“. Daher müsse die Marktgemeinde im Benehmen mit dem Pfarramte als ortspolizeiliche Vorschrift eine „Gottesackerordnung“ erlassen. Die Bedeutung dieses landgerichtlichen Schreibens unterstreicht allein schon die eigenhändige Unterschrift des behördlichen Vorstehers als Bezirksamtmann (heute der Landrat) und Regierungsrat.
In Folge wird der damalige umfangreiche Arbeitsbereich eines Totengräbers und Kalkanten vorgestellt.
Werner Perlinger
Aus alten Gerichtsprotokollen des Marktes - Kindsmorthat und ein Diebstahl im Rathaus
+Wurde ein Kindsmord begangen?
Eschlkam. Am 10. Mai 1684 hatte sich Margaretha Späth, Frau des Bürgers und Gastgebers Georg Späth, vor dem Marktgericht zu verantworten. In Abwesenheit ihres „Mahnes“ hatte sie sich gegenüber ihrer Magd Maria Pehrin (bei) deren begangener „Kindsmorthat nit nur allai verwegentlich (verwegen) verhalten und nit ordentlich angezaigt, sondern der Deliquentin Stüffmuttern (Stiefmutter der Pehr) das todte Khindt in des Fürtuch (Schürze) allwekh zu tragen gegeben, wardurch nit zu wissen wie mit dem Khindt um(ge)gangen worden (ist), also gehörigen Orth khein insinuieren beschehen (Verschulden erkannt worden), weniger ain(e) Visitation (Untersuchung) des Khinds halber vorgenommen werden khönnen, hinfürders (künftig aber) dergleichen Verbrechen, Gott wolle es aber allseits gnediglich verhitten, nit vorzuhalten“ (hier: nicht zu unterstützen bzw. nicht anzuzeigen). Wegen dieser wohl versuchten Verheimlichung wurde die Späth vom Marktgericht mit 1 Pfund Pfennigen (entspricht etwa 1 Gulden) gestraft, die sie „alsobaldn zu erlegen“ habe. „Jedoch alweg Ihro churfürstlichen Durchlaucht“ in diesem Falle „dißfalls vorernannter Straff, so unerwiesen, abgewandelt worden“ (vermindert oder ganz erlassen, da bei der Späth kein direkter Beweis für eine Beihilfe zur Verheimlichung einer vorsätzlichen Kindstötung gegeben war). Die Späth wollte ihrer Magd in deren Not nur helfen und hätte sich ansonsten so der Beihilfe zu einem möglichen Verbrechen schuldig gemacht. Wäre aber die Maria Pehr vom Landgericht Kötzting der Kindstötung überführt und verurteilt worden, wäre sie zur Strafe hingerichtet worden. Sehr wahrscheinlich hatte die Magd lediglich eine Totgeburt, und das tote Kind musste auf den Friedhof getragen werden.
Die Not junger lediger Frauen war in früheren Zeiten oft groß, wenn sie - aus welchen Umständen auch immer - eine ungewollte, ja aufgezwungene Schwangerschaft auszutragen hatten. Nicht selten wurde die Abhängigkeit der Mägde von ihren Brotgebern, ob am Lande oder in der Stadt, von diesen schamlos ausgenützt, was manchmal die Ursache für tragische Entwicklungen war. Denken wir nur an das Schicksal einer jungen Frau, die im ausgehenden 18. Jahrhundert in Frankfurt wegen Kindsmord verurteilt und hingerichtet wurde. Ihr furchtbares unausweichliches Schicksal hat angeblich Johann Wolfgang von Goethe bei Abfassung zu seinem Werk >Faust I und II< inspiriert.
Diebe im Rathaus
Eschlkam. Sogar die Räumlichkeiten in einem Rathaus waren früher vor Langfingern keineswegs sicher. Das musste die junge Margarethe Tenzl im Jahr 1689 aufs bitterste erfahren. Damals am 16. April, dem Mittwoch nach dem Sonntag Misercordia domini (Barmherzigkeit des Herrn), erschien die junge Frau, noch ledig, „doch vogtbaren Stands“ (mündig, erwachsen) in der anberaumten Ratssitzung vor Richter und Rat und brachte „diemiettig vor, welchermaßen sie sich bei ihren Schwager Veith Adam Wurzer Marktschreibern alhier aufhalte“. Sie habe in der oberen „Ratsstuben Cammer neben sein Marktschreibers Sachen ain(e) verspörte Truchen stehen“. In dieser Truhe, so die Tenzl, sei „ihr weniges Hals- und Leingewändl“ (eine Art Dirndlkleidung) aufbewahrt. Daneben aber, und darum ging es hauptsächlich, hätten sich „26 ainfache, und 10 doppelte Ducaten (1Ducat entsprach etwa 2 Gulden 20 Kreuzer), dann 15 allerley Reichsthaller (1 Taler zu 90 Kreuzer = 1 ½ Gulden) und bey 44 f (Gulden) Münz, in Verwahrung befunden, welches sie am Freytag vor Mittag umb 10 Uhr nachgesehen und 3 Reichsthaller darzu gethon“. Als sie nun fünf Tage später, eben heute, während „der Khürchenzeit“ nach ihren Sachen gesehen habe, „seye die (Zimmer)thür zwar verschlossen gewesen, aus ihrer Truchen aber woran der Schlissl gestöckht, und volgendes darin verschlagen (entwendet) worden“: So wurde das erwähnte Geld „aus einem verporgnen Lädl“ (Geheimfach) sambt einen „grinen Wistlring“ (vielleicht ein Paten- oder Verlobungsring?) gestohlen. Ferner fehlten noch ein „zwirerntes Wambs“ (aus Zwirn) auf der Seite „furmb“ (am Rande glatt), neben 2 „pästl“ (Posten bzw. Ballen) Leinentuch, ungefähr 26 Ellen (1 Elle = ca. 83 cm) messend, und zwei „Leylacher (Leintücher) ohne unbewussten weissenzeug (herkömmlichen weißen Überzug)“, sowie letztlich zwei alte hohe „Kopf Khandln“ aus Zinn, ohne „Verletzung (Beeinträchtigung) des Marktschreibers seinigen Sächels, da doch alles offen in der Cammer, und (im) Casten (Schrank) gehenkht, (ihr nun) würklichen entfrembt (gestohlen)worden“.
„Welche Entfrembtung (den Diebstahl) muthmaßlich der Marktdiener Gottfridt Stainpacher oder sein Eheweib, die am Freytag das Ratzimer gebuzt, oder des Marktschreibers Dienstmensch (Magd) Barbara Tenzlin, so umb das entfrembte gelt, wo selbiges gewesen, Wissenschafft gehabt, veryebt haben müssen. Die Margarethe Tenzl bittet daher die Ratsherren und den Bürgermeister „diemittig“ gegenüber der von ihr verdächtigten Personen „obrigkheitlichen zu inquirieren (verhören), oder diese gahr handtvest machen zu lassen“.
Tatbestandlich handelt sich in diesem Fall um einen einfachen Diebstahl, keineswegs um einen Einbruch oder gar um einen Raub, d.h. Aneignung einer Sache mit Gewalt. Denn im letzteren Falle wäre die nächsthöhere Instanz, damals das Landgericht Kötzting zuständig gewesen.
Die Ersparnisse der Tenzl erscheinen jedoch erheblich, denn damals musste ein Maurer oder Zimmerer für 1 Gulden Lohn mindestens zwei bis drei Wochen und länger arbeiten.
Offenbar aber wurde der für die junge Tenzl doch schwerwiegende Diebstahl nicht aufgeklärt, denn das Ratsprotokoll berichtet für die nächsten Wochen und Monate über diesen Fall nichts mehr. Ein hartes Los bedeutete für die junge Tenzl der Diebstahl des Geldes und der anderen Sachen insoweit, als sie dadurch wahrscheinlich ihre mögliche, im Laufe der Zeit angesparte Mitgift für eine spätere Heirat urplötzlich verloren hatte. Und die jeweilige Mitgift heiratswilliger Leute spielte damals eine sehr wesentliche Rolle wenn sie einen eigenen Hausstand gründen wollten und das von den Ratsherrn und dem Bürgermeister genehmigt oder wegen fehlender „Sicherung des Nahrungsstandes“ sehr zum Leidwesen der jungen Leute abgewiesen werden musste.
Werner Perlinger
Nicht einfach war in Eschlkam in frühen Zeiten der Nachtwächterdienst
+Eschlkam. Die Aufgabe eines Nachtwächters bestand darin, nachts durch die Straßen und Gassen des Marktes zu gehen und, wenn nötig, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Er warnte die schlafenden Bürger vor Feuer, Feinden und Dieben. Er überwachte das ordnungsgemäße Verschließen der Haustüren ebenso wie auch die Versperrung der Toranlagen am Friedhof. Häufig gehörte es zu den Aufgaben des Nachtwächters, die Stunden anzusagen – weniger als Auskunft für die Mitbewohner, eher mehr als ein Beweis dafür, dass er seinen Dienst ordnungsgemäß erledigte. Er hatte das Recht, verdächtige Personen, die nachts unterwegs waren, anzuhalten, zu befragen und notfalls festzunehmen. Zur typischen Ausrüstung eines Nachtwächters gehörten daher eine Hellebarde oder eine ähnliche Stangenwaffe, eine Laterne und ein Horn, mit dem er die Stunden ausrief. Der Nachtwächter lebte allgemein in sehr bescheidenen Verhältnissen. Mit der flächendeckenden Einführung von Straßenbeleuchtungen und neuen Polizeigesetzen um die Wende zum 20. Jahrhundert ging allerorten damit der Nachtwächterdienst zu Ende.
Was die Traditionen des Nachtwächterdienstes in Eschlkam betrifft, blicken wir zunächst zeitlich weit zurück: Wir schreiben das Jahr 1686, knapp 40 Jahre nach dem Ende des auch für den Markt verheerend sich auswirkenden Dreißigjährigen Krieges. In der Sitzung des Marktrates von Eschlkam am 15. Februar wurde das Bürgermeisteramt an Wolf Sighardt Altmann übergeben. Altmann war damals Eigentümer des von der alten Hausnummerierung her ersten „Hoamater“-Hofes, heute der Gasthof Penzkofer. In dieser Sitzung wurden u.a. auch die jeweils zwei „Wachter“ (Nachtwächter) ermahnt, ihren Dienst ernster als bisher zu nehmen.
1706: Für die Besoldung der Nachtwächter wurde von genannten 49 Bürgern Wachtgeld in Höhe von 13 Gulden 53 Kreuzer erhoben. Die Nachtwächter Wolf Heißlmayr und Leonhardt Pongraz wurden für ihren täglichen Dienst zur Nachtzeit, auf dass sie „die Uhr ausschreyen“, in diesem Jahr mit 16 Gulden entlohnt.
Stets karge Löhne für die „Nachtwachter“
In Prüfberichten der Marktgemeinde werden Jahre später auch die Einkünfte einzelner Marktbediensteter aufgelistet. Mehrere erhaltene Quittungen dafür sind abgelegt unter dem Titel „Verificationen (hier Belege, bzw. Beweiszettel) zur Kammer Rechnung für den Churfstl. Gränz Bann Markt Eschlkam pro anno 1771“. So quittierten im Beisein des „Ehrnvestn, und Wohlweisen Herrn Andreas Meidinger (damals Inhaber von Nr. 51/Blumengasse 18), derzeit Ambtsburgermeister“ am 31. Dezember 1771 Johann Sünger und Wolfgang Heislmayr dafür, dass sie das ganze Jahr hindurch die „Nachwacht versehen, und die Uhr ausgeruffen den Empfang von 16 Gulden, für jeden 8 Gulden Lohn“. Am letzten Tag des Jahres 1774 erhielt der Nachtwächter Andre Fleischmann zusätzlich 2 Gulden „Herbergsgeld“ (Mietzuschuss) ausbezahlt.
Ein Protokoll des Landgerichts Kötzting – Landrichter war Carl von Paur - vom 21. April 1847 berichtet, dass Sebastian Lernbecher, Inwohner und Sebastian Hastreiter den Nachtwächterdienst „sich jeweils abwechselnd versehen“. Als Jahreslohn erhielt jeder 10 Gulden. Zugesichert war beiden die freie Wohnung im Hüthause (einst Nr. 49), eigentlich gedacht als gemeindliche Einrichtung für den Wohnbedarf der Familie des Dorfhirten. Beide klagen daher, dass sie in den Genuss einer freien Wohnung bisher nicht gekommen seien, „weil das Hüthaus stets mit Bewohnern angefüllt ist, die vom Magistrate daselbst untergebracht werden, da das Hüthaus zugleich auch Armenhaus ist“. Eine Entschädigung in Höhe von 4 Gulden pro Jahr sei bisher nicht gezahlt worden. Daher seien sie „an unseren zugesicherten Einnahmen alljährlich verkürzt worden“. Als Familienväter baten sie unbedingt um Abhilfe, da „sie in sehr dürftigen Umständen leben – zumal bei gegenwärtigen harten Zeiten jeder Kreuzer hart entbehrlich ist“. Beide dürften dann auf Anweisung des Landgerichts ihre Entschädigung erhalten haben, auch wenn darüber der Akt schweigt.
Drei Jahre später, am 14. November 1850, wurde vom Magistrat für den aus Altersgründen „abgetretenen“ Nachtwächter Sebastian Hastreiter der ledige Bürgersohn Wolfgang Würz mit einer jährlichen „Renumeration von 10 Gulden“ aufgestellt. zahlbar aus der Kommunalkasse. Ausschlaggebend für die Wahl des Würz war, dass er „ein unbescholtener, kräftiger, nüchterner und herzhafter (mutiger) Mann ist“. Am gleichen Tag noch wurde Würz „auf das Rathaus citiert“ (gerufen), und man belehrte ihn dort über seine „aufhabenden Pflichten und nahm ihm sofort, damit er diesen Verpflichtungen getreu und gewissenhaft nachkomme, das Handgelübde ab“. Bestätigend unterschrieb Würz das Protokoll. Gewiss war der Magistrat froh, für diesen nicht leichten Dienst eine geeignete Persönlichkeit gefunden zu haben, denn wie oft geschah es, dass angetrunkene Nachtschwärmer sich gerne den Anweisungen der Nachtwächter widersetzten. Da war mutiges Eingreifen oft gefragt.
Werner Perlinger
Das alte Mauthaus in Eschlkam wurde im Jahre 1827 erbaut
+Eschlkam. Gastwirt und Metzger Joseph Späth errichtete aus eigenen Mitteln das imposante Gebäude für die Zollbehörde Eschlkam. Nachdem Kurfürst von Bayern, Max III., Joseph am 01. Januar 1806 die Königswürde annahm, erging zum 01. Januar 1808 eine neue Zoll- und Mautordnung. Durch diese Verordnung wurde die Zollverfassung und Zollverwaltung mit einer Generalzoll- und Mautdirektion an der Spitze neu geordnet und dabei das Zollwesen selbstständig gemacht. Aufgrund königlicher Anordnung vom 16. September 1819 wurden im Rahmen dieser neuen Zollverordnung in Bayern die lange Zeit schon bestehenden Mautämter aufgehoben. Auf den Hauptkommerzialstraßen, wo der Handelsverkehr unterwegs war, wurden dafür Oberzollämter mit einem Oberzollbeamten an der Spitze errichtet. Ein solches Oberzollamt entstand im Jahr 1819 in Eschlkam und das zur Zollstation degradierte Furth wurde diesem unterstellt. Vorsteher des Oberzollamtes in Eschlkam wurde der Oberzollbeamte Karl Ruesch.
Da nur die eine Straße über Eschlkam, die andere, aber mittlerweile stärker frequentierte Straße über von Furth aus über Vollmau nach Böhmen führte, war der Standort des Oberzollamtes in Eschlkam durch diese verkehrliche Wendung gefährdet. Noch sind die Würfel zu Gunsten der Stadt nicht gefallen; die Behörde war noch nicht verlegt. Bei dieser Lage wollte am 11. Juli 1826 die „Königlich Baierische Zoll Inspection des Regen- und Unterdonau Kreises“ wissen, wie hoch der Mietzins für die Amtslokalität und die Wohnung des Oberbeamten in Eschlkam wäre. Drei „Quartiere“ hatte dafür die Marktführung vorgeschlagen. Es waren dies die Anwesen des Joseph Lemberger (Nr. 37/38-Marktstraße 5), Joseph Schöppl (Nr. 34-Marktstraße 5) und Joseph Späth (Hsnr. 5-Further Straße 3). Alle drei Häuser lagen günstig an der für den Zoll wichtigen Straße zur Landesgrenze bei Neuaign.
Ein Hin und Her
Zugleich fragte am 14. Juli 1826 die kgl. Bayerische Zollinspektion des Regen- und Unterdonaukreises bei der Stadt Furth nach geeigneten Gebäuden für ein Oberzollamt nach. In der Stadt wurde schließlich 1828 das Oberzollamt offiziell eingerichtet. In Eschlkam verblieb nach Aufhebung des Oberzollamtes lediglich ein Zollamt, das nunmehr dem Oberzollamt Furth unterstand. 1834 wurde in Folge einer neuen Zollordnung das Oberzollamt Furth wieder aufgehoben und in Eschlkam ein Hauptzollamt errichtet und dorthin die Further Behörde verlegt. Soviel zur Zollgeschichte im Hohenbogen-Winkel in diesen Jahren.
Aber gerade die Planungen hinsichtlich des Standorts einzelner Zollbehörden im Jahr 1826 wurden für den Bürger und Gastwirt Joseph Späth zu einem gewaltigen wirtschaftlichen Problem, denn er hatte im Vertrauen auf das Verbleiben des Oberzollamtes im Markte für diese Behörde im Jahr 1827 allein nur aus eigenen Mitteln einen repräsentativen Bau unmittelbar neben seinem Anwesen errichtet, das ehemalige sog. „Mauthaus“ (Nr. 5 ½/Waldschmidtstraße 4 ½). Nur Joseph Späth ergriff die Initiative, vertrauend auf den Verbleib des Oberzollamtes in Eschlkam, für diese für den Markt wichtigen Behörde neben seinem Gasthaus ein eigenes Haus zu bauen, gewiss sehr mutig und ein gewaltiger finanzieller Kraftakt. Das Oberzollamt zog zunächst auch ein, und mit den sicheren Mieteinahmen versprach sich Späth nicht nur die Deckung der Baukosten sondern langfristig auch einen finanziellen Gewinn.
4000 Gulden gekostet
Sichtlich von der dennoch drohenden und wenig später eintretenen Verlegung enttäuscht, richtete der „Tafernwirt“ und Metzger Späth am 21. Mai 1828 einen langen und inhaltlich interessanten Brief sogar „an Seine königliche Majestet von Bayern (König Ludwig I.), allerhöchstes Staatsministerium der Finanzen“. Er schrieb u.a., er habe 1826 zunächst sein Gasthaus für die Unterbringung der Behörde „zum Opfer gebracht. Um aber noch mehr zu tun, faßte ich den Entschluß (wohl noch 1826), ein ganz neues Haus zu bauen, um dem Zollbeamten ein allseitig entsprechendes Lokal, und dem Beamten eine tüchtige Wohnung zu verschaffen“. Den Bau, „der mich über 4000 Gulden kostete, richtete ich nach dem Bedarfe eines Oberzollbeamten ein“. So beinhaltete das Erdgeschoß eine geräumige Kanzlei, die Registratur, 2 Zimmer und eine Küche. Im Stock darüber waren 4 Zimmer, eine neue Küche mit Speise. Ebenfalls 4 Zimmer und eine Küche waren in der Etage darüber. Späth erinnerte auch, dass es seit der Inbetriebnahme wohnmäßig über mangelnde Bequemlichkeit keinerlei Beschwerden gegeben habe. Er bedauerte, dass er bei Verlegung der Behörde in die Nachbarstadt „in eine traurige Lage versetzt werde“. Die Verlegung betrachtete Späth als einen für ihn „unersetzlichen Verlust“. Auch habe er, gestützt auf amtliche Zusicherungen, zunächst sein gut gehendes Gasthaus mietmäßig hergeben und „sogar ein ganz neues Gebäude mit einem so großen Kostenaufwande hergestellt, daß mir nur durch einen langen Zeitverlauf und ausschließend durch den Sitz des Oberzollamtes in etwas ersetzt zu werden vermag…die Folge wäre (bei Abzug der Behörde) ein unverdienter Ruin, der umso schwerer fiele, als die Veranlaßung (zu bauen) in Versicherungen amtlicher Autorität gegeben war“. Letztlich betont Späth, „daß nur Eschlkam zum Sitzes Oberzollamtes schon ausschließend nach örtlicher Lage qualifiziert sei“. Und er bittet den König „der Versetzung der Zollbehörde nicht statt zu geben“.
Erfolg hatte Späth mit seinem Appell nicht, aber es verblieb - wie oben schon erwähnt – die Unterbehörde in Eschlkam. Wenige Jahre später, 1834, wurde Eschlkam nun wieder Sitz eines Oberzollamtes. Das Mauthaus des Joseph Späth erfüllte dann über Jahre seine ihm zugedachte Aufgabe. In ihm wurde 1832 der bekannte und geschätzte Volksschriftsteller Maximilian Schmidt, zu Lebzeiten noch genannt „Waldschmidt“, als Sohn des Zollinspektors Adalbert Schmidt geboren. Das alte Mauthaus wurde 1985 abgerissen und 1994 als Neubau ein 6-Familienhaus errichtet, der stilistisch an seinen Vorgänger erinnert.

Bildunterschrift: Das Luftbild zeigt den gesamten Anwesenskomplex der Familie Xaver Späth in den 50er Jahren; links das Mauthaus, ein dreigeschoßiger fast würfelförmiger Bau mit einem Walmdach. An der Nordseite wurde für den Schriftsteller Maximilian Schmidt, genannt „Waldschmidt“, 1897 eine Gedenktafel angebracht. (Bildnachweis: privat)
Werner Perlinger
Die Aufnahme von Bürgern – eine Entscheidung des Marktrats
+Eschlkam. Die Bürger, wohnend in einer Stadt oder in einem Markt, konnten verschiedene Freiheiten genießen. Aber: neben vielen Rechten hatten sie auch Pflichten zu erfüllen. Um Bürger zu werden, musste der Bewerber einen Antrag stellen, der schließlich vom Bürgermeister und Marktrat geprüft und beschieden wurde. Die Marktführung war bei der Verleihung stets sehr vorsichtig. So gehörte früher beispielsweise die Wehrpflicht zur allgemeinen Bürgerpflicht. Im Kriegsfalle mussten die Bürger ihren Markt Eschlkam mit den eigenen Waffen verteidigen, militärisch organisiert in der uns bekannten „Grenzfahne“. Auch hatten sie Steuern zu zahlen und helfen eventuelle Schulden mit abzutragen. Gemäß weiterer Bedingungen musste man schließlich von ehelicher Geburt sein, einen guten Leumund besitzen und einen gesicherten Nahrungsstand sowie Haus- oder Grundbesitz oder ein Mindestvermögen vorweisen, oder selbstständig ein Handwerk ausüben können. Das Bürgerrecht, das in der Regel zunächst die Ehefrau und die unmündigen Kinder miteinschloss, war für diese nicht erblich.
Im Marktarchiv haben sich Protokolle erhalten, die „Burgers Aufnahmen“ enthalten. Sie beginnen im Jahr 1793, am 2. Jänner. Die Niederschrift schildert im Detail die Beweggründe, warum Franz Weß aus Kleinaign zu einem Bürger des Marktes Eschlkam aufgenommen wurde. Leicht verkürzt lautet das dafür eigens vom Marktschreiber gefertigte Protokoll: „Durch Erheurathung der Anna Seiderer hiesig lediger Burgers Tochter hat der Franz Weß, lediger Leinwebers Sohn von Kleinaigen das von der Seiderin Vater Johann Georg besessene Burgershaus cum pertinentys (mit Zubehör) erlangt, daher er Weß das gehorsame Bitten gestellt, es mechte ihm das Burgerrecht ertheilt werden (Hsnr. 48/Blumengasse 24). Hierauf will man demselben für einen Burger hiermit und dergestalten an- und aufgenommen haben, daß er gegen seiner vorgesetzten Obrigkeit (hier die Marktbehörde) den schuldigen Respekt erzeigen: zu einem Burgerrecht aber erlegen solle er 15 Gulden.
Ähnlich die nächste Aufnahme: am 21. März gleichen Jahres ehelicht Joseph Schreiner, Bauerssohn von Großaign, Anna Maria Schreiner, „burgerliche Haimeters Tochter allhier“, und erlangt so „das von Ihrem Stiefvater Johann Georg Wensauer besessene „Haimet Gut“ (Hsnr. 37/38/Markstraße 11). Gehorsam bittet er, es wolle ihm das Bürgerrecht in Eschlkam erteilt werden. Dafür hatte er 21 Gulden zu zahlen.
Den Exerciergulden gezahlt
1795, am 24. Februar heiratete Anton Hastreiter, lediger Bäckerssohn, Walburga, die Tochter des „Bökenmüllers“ und kam damit in den Besitz dieser Mühle (Nr. 46/Bäcker Mühle Nr. 1). Zugleich hatte er das Bürgerrecht von seinem Vater erblich erlangt und wurde im Gegensatz zu den Vorgenannten nur mit dem der Landesherrschaft zustehenden „Exercier Geld“ von nur 1 Gulden belegt. Dieser sog. (Bürger)gulden wurde vom Staat als „Exerciergeld“ seit 1771, als die bayerische Regierung die Landfahnen und somit auch die Grenzfahne im Hohenbogen-Winkel aufgelöst und das stehende Heer eingeführt hatte, als ein Beitrag zum Unterhalt dieses neuen Landesmilitärs eingezogen. Am 2. März erhält der noch ledige Wolfgang Stauber, von Beruf ein Uhrmacher, von seinen Eltern Thomas und Theresia Stauber das Haus überschrieben und er erlangte damit als „hausansessiger Burger das Burgerrecht“, belegt auch nur mit dem „Exerciergeld“ von 1 Gulden (Hsnr. 22-einst neben Marktstraße 2). Dagegen hatte Michael Schmatz, „Insassenssohn“ (seine Eltern besaßen kein eigenes Haus) am 27. August 1796 zehn Gulden zu entrichten, denn er ehelichte Theresia Späth und kam so in den Besitz des Hauses seines Schwiegervaters Joseph Späth (Hsnr. 20/Marktstraße 1).
Michael Seidl, gebürtig aus „Böheim“ (Böhmen), heiratete die Tochter Anna „des Limböck, burgerlicher Zimmermann und Bronnrichter“ (er baute und reparierte die Brunnen) und erwarb damit dessen „Behausung“ (Hsnr. 56/Blumengasse 8). Als ein „auswärtiger“ (in diesem Fall vom Ausland) bat er um das Bürgerrecht. Diesem Umstand schenkte der Marktrat am 15. November 1796 vermehrt Aufmerksamkeit: In der Zuversicht, dass er sich allen bürgerlichen Bedingungen und Satzungen unterwerfe, seine Ablagen getreulich entrichte, und gegen der Obrigkeit den gebührenden Respect erzeige, „will man denselben Magistrats seits das Burgerrecht hiemit, und dergestalten ertheilen, daß er hierwegen zur Marktskammer zu erlegen schuldig seyn solle 10 Gulden, dann zur Burger Tax 2 und zum Exercir gulden 1 Gulden“.
Dagegen musste Joseph Schneider zehn Tage später, am 25. November 1796, nur 1 Gulden sog. Exerciergeld zahlen, nachdem er mit Heirat der Anna Hölzl auch das Haus ihrer Eltern übernehmen konnte (Hsnr. 13/Kleinaigner Straße 12).
Jahrzehnte später, im Jahr 1826 stellte der Schlosser Joseph Römisch ein Gesuch, in Eschlkam ansässig werden zu können. Römisch stammte aus einer alten traditionsreichen Schlosserfamilie in der benachbarten Stadt Furth. Nur einer seiner Brüder konnte in der Stadt den elterlichen Betrieb übernehmen. Da ergab sich die Möglichkeit, benachbart in Eschlkam durch „Verehelichung mit der hiesigen bürgerlichen Schloßerstochter Anna Gruber, wie auch Conceßionsverleihung der auf dem Gruberischen Behausung ruhenden realen Schloßersgerechtigkeit“ im Markte (Hsnr. 68/Großaigner Straße 6) ehelich und berufsmäßig Fuß fassen zu können. Am 20. Juni 1826 erschien Römisch im Rathaus, begleitet von seinem zukünftigen Schwiegervater, dem Schlossermeister Joseph Gruber und dessen Tochter, und gab sein entsprechendes Gesuch ab. Zugleich legte er „Behelfe“ (Beweise) über seinen guten Leumund, die Pflichtableistung beim Militär und einen „Vermögensausweis“ vor. Zwei Tage später war es soweit: Am 22. Juni stimmten die Gemeindebevollmächtigten – es waren neun an der Zahl – der Aufnahme des Römisch „als Gemeindeglied“ und neuen „Ortsbürger“ einstimmig zu. Eigenhändig unterschrieben das Protokoll die Markträte Anton Hastreiter, Michael Meidinger, Jakob Fischer, Anton Riederer, Joseph Scheppl, Franz Rötzer, Andre Kilger, Wolfgang Stauber und Joseph Schreiner.
Das seien nur einige Beispiele wie die Marktbehörde von Eschlkam es vor über 200 Jahren gepflogen hatte, das begehrte Privileg des „Bürgerrechts“ zu erteilen.
Werner Perlinger
Die früheste Darstellung des Marktes Eschlkam, 1514
+Eschlkam. In einer ganzen Reihe von Aufsätzen wurden bisher verschiedene archivische Inhalte aus alten Akten des Marktes vorgestellt. An dieser Stelle sei erstmals ein Bild präsentiert, das Eschlkam vor gut 500 Jahren zeigt. So stammt diese älteste bisher bekannte Darstellung unseres Ortes aus dem Jahr 1514. Damals wurde im Zuge der andauernden Streitigkeiten zwischen Bayern und Böhmen um den Verlauf der Landesgrenze auf Befehl des herzoglichen Hauses der von bayerischer Seite her angenommene Grenzverlauf gezeichnet:
Diese erste Grenzkarte, damals tituliert als „Grenzvisier“, zeigt detailliert das bayerisch-böhmische Waldgebiet zu unserem Nachbarland hin vom Voithenberg (Gibacht bei Furth) aus bis zum Großen Arber. Die Karte, deponiert im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, ist im Original 4.30 Meter lang und fast einen halben Meter breit. Die Zeichnung im Stile der Donauschule (Albrecht Altdorfer) fertigte im Auftrag und beratenden Beisein des gerade amtierenden Grenzhauptmanns ein gewisser „Wolfgang, Maler zu Straubing“.
Dazu noch folgende Erläuterungen: Das herzogliche Haus in München sah bald ein, dass mit der um 1470 geschaffenen Pflege von Furth zusammen mit den sog. Unterpflegen Eschlkam und Neukirchen aufgrund der Grenznähe und den damit verbundenen häufigen Problemen mit Böhmen tatkräftige und energische Persönlichkeiten als Grenzhauptleute betraut werden mussten. So wurde mit der Hauptmannschaft vor dem „Behemer Waldt und Pfleg zu Furtt“ Sigmund von Seyboltstorff von Lichtmeß 1511 an betraut.
Ein Zustandsbericht
Die damals politisch vielfältigen Gründe für die Herstellung dieses Kartenwerks, sowie die Legende zu den einzelnen Orten und sonstigen wichtigen Punkten in der dargestellten Landschaft dieses sehr eindrucksvollen und informativen Kartenwerks sind andernorts bereits anschaulich und erschöpfend veröffentlicht, nicht aber die einleitende große Sammellegende dieser Karte, Der Text der die gegebenen politischenVerhältnisse schildernden Sammellegende in der Grenzkarte lautet auszugsweise:
„Zu merckhen, daß ich Sigmund von Seyboltsdorff auf Ritterswörthe, derzeit Hauptmann vor dem oberen Wald (mit Sitz in Furth), auf Befehl der durchläuchtigsten hochgeborenen Fürsten, mein gnädigen Herrn Wilhelm und Herr Ludwig …, meine gnädigen Herren, den Wald mit guter gründlicher und wahrhaftiger Erkundung der Alten, so in etlichen Dörfern und Höfen ihre Väter und Freunde gehabt, auch daselbst gewohnet, welche Dörfer, Höfe und Güter vor etlichen Jahren durch die Beham (Böhmen im Hussitenkrieg und während der bayerischen-böhmischen Adelsfehden) verbrennt, die Leute darob erschlagen. Deshalb jetzt das denn ein lauter Wald ist; wiewohl die sichtigen (sichtbaren) Wismahder und Ackerrangen noch sichtiglich vor Augen sind, (und) so zu den angeführten Dörfern, Höfen und Gütern gehören und vor einiger Zeit durch mich und andere von Adel, auch sonst viel und trefflicher und glaubwürdiger Personen notdürftiglich besichtigt, beschaut und wahrhaftig erfunden, daß die Gründe alle und jeder – es seien Wald oder Wismad, Äcker, Berge, Fischwasser oder andere nichts ausgenommen, welche und was in dieser hierunteren Verzeichnung gemalt steht oder ist, gehört alles ohne Mittel zu dem Fürstentum Bayern …“,so der Anfang der für die Entstehung der Karte aussagekräftigen Erklärung des Grenzhauptmanns.
Eschlkam im Bild
In dieser Böhmerwald-Grenzkarte von 1514, einem Frühwerk anspruchsvoller Kartographie zu Beginn der Neuzeit, ist erstmals Eschlkam dargestellt. Wie die Schlossanlage in der Stadt Furth oder der Markt Neukirchen war anstelle einer Ummauerung auch Eschlkam nur mit einem Palisadenzaun zum Schutze gegen ungebetene Gäste umgeben. Wieso der Markt nicht größer dargestellt werden konnte, erklärt sich allein schon aus folgender Einwohnerentwicklung:
Nach einer Steuerliste vom Jahr 1477 zählte der Markt etwa 30 Jahre nach den massiven, sicher auch mehrfachen Zerstörungen im Hussitenkrieg nur 16/17 Anwesen. In den Jahren 1507 und 1515 wurden wiederum nur 16 Mannschaften (das sind die Familien, die ein Anwesen bewirtschafteten) gezählt; 1534 waren es immer noch 17, wobei zwei erst bauen sollten. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts konnten bereits 29 Mannschaften gezählt werden; 1554: 30 Mannschaften. Im Jahr 1580 waren es bereits 50. Dies beweist wie zäh und schwer nach der langen Kriegszeit der Wiederaufbau etwa ab Mitte des 15. Jahrhunderts anlief.
Bildunterschrift: Mit diesem zugleich ältesten Bild aus unserer Gegend werden wir so über das bauliche Aussehen der Häuser im Hohenbogen-Winkel informiert. Auch wenn einzelne Anwesen nur skizzenhaft wiedergegeben sind, so lassen sich gerade für Eschlkam eindeutig gemauerte, aber auch ganz gezimmerte Häuser erkennen, wobei der Typ >Waldlerhaus< mit seinem nur leicht geneigten breiten Satteldach klar erkennbar ist. Die Dächer der Anwesen sind mit Stroh oder Legschindeln eingedeckt. Nur die Kirche mit Turm zeigt ein rotes Ziegeldach. Über dem Ort steht in einer Vignette der Name „Eschlchamb“. Links oben erkennen wir noch Häuser des Dorfes Kleinaign. Die Pflegerfamilie Pfeil wird in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Inhaber der Hofmark Kleinaign. Erst etwa um die Mitte des 16. Jahrhunderts beginnt der Wiederaufbau der in den Hussitenkriegen zerstörten Schlossanlage.
Werner Perlinger
Napoleons Kriege – ein Bezug zu Eschlkam und den Hohenbogen-Winkel
+Eschlkam. Die Völkerschlacht bei Leipzig, andauernd vom 16. bis zum 19. Oktober 1813 und ausgetragen zwischen 210.000 Franzosen und bis zu 310.000 Alliierten, forderte über 110.000 Tote und Verwundete. In diesem Schlachten fügten die verbündeten österreichischen, preußischen, russischen und schwedischen Truppen Napoleon die kriegsentscheidende Niederlage zu. Napoleon war gezwungen, sich nach Frankreich zurückzuziehen. Es kam am 9. März 1814zum Vertrag von Chaumont, in dem die Verbündeten gelobten, niemals mit Napoleon Frieden zu schließen und dagegen die Bourbonen wieder auf den französischen Thron zu setzen. Am 31. März nahmen die verbündeten Truppen Paris ein. Napoleon dankte am 6. April ab. Es folgte der Vertrag von Fontainebleau. Die Regentschaft der Bourbonen wurde wiederhergestellt und Napoleon nach Elba verbannt. Nach Beendigung der napoleonischen Herrschaft wurde von den Siegermächten der Wiener Kongress einberufen, um die Ordnung Europas nach alten, vorrevolutionären Maßstäben wiederherzustellen (Restauration). Zu einem kurzen Nachspiel der Freiheitskriege kam es im Jahr 1815 (während der Kongress schon im Gange war), veranlasst durch Napoleons eigenmächtige Rückkehr aus der Verbannung („Herrschaft der Hundert Tage“). Nach rascher Neuorganisation der Grande Armée und einem letzten Sieg in der Schlacht bei Ligny wurde Napoleons Herrschaft durch seine Niederlage gegen das aus Briten, Niederländern und Deutschen zusammengesetzte alliierte Heer unter Arthur Wellesley, dem Duke of Wellington und die verbündete Streitmacht Preußens unter General Gebhard Leberecht von Blücher in der Schlacht bei Waterloo endgültig beendet, so viel zu den turbulenten Verhältnissen in dieser Zeit.
Wiedergutmachung erfolgte - 484 Gulden Schadensersatz für Eschlkam
Es dauerte Jahre, bis an die infolge der imperialen Herrschaft und Kriege Napoleons leidende Bevölkerung in Bayern eine Wiedergutmachung und Ersatzleistungen erfolgten. Im Gemeindearchiv von Eschlkam haben sich dazu Unterlagen erhalten. Wir schreiben das Jahr 1822, als am 11. Juni der damalige Marktschreiber Franz de Paula Pach, Vater des Kunstmalers Alois Pach, eine Niederschrift anlegte, in der nur die hausbesitzenden Bürger aufgelistet wurden, da diese nun Anspruch auf eine Ersatzleistung für die in der Zeit vom 1. Oktober 1813 bis Ende März 1815 übernommenen Quartierlasten hatten. Der Titel des Aktes lautet: „Subrepartitionen über in Geldbezüge ab dem Franzosen für Lieferungen und Leistungen beim Markt Eschlkam“. So kompliziert diese gewählte Formulierung auch erscheinen mag, es ging schlicht um sog. Kriegsentschädigungen. Für diesen Zeitraum wurden landesweit an die kaiserlich königlichen österreichischen Truppen Verpflegungsgelder in Höhe von 7.735 Gulden ausgezahlt, wobei es galt, dass von jeder Gemeinde „2 des Schreibens kundige Männer zu erscheinen haben und abzuordnen sind“. Dafür wurden der Magistratsrat Andreas Lachs (er findet sich damals in Anwesen Nr. 52/Blumengasse 16) und der Gemeindebevollmächtigte Joseph Schreiner (Anwesen Nr.37/38/Marktstraße 11) zum Sitz des Landgerichts (hier Kötzting) abgeschickt, damit sie die für Eschlkam errechnete Quote in Höhe von 484 Gulden 42 Kreuzern in Empfang nehmen konnten.
Am 11. Juni wurde die von den Quartierlasten betroffen gewesene Bürgerschaft vorgeladen und der „Maßstab der Vertheilung“ nach herkömmlicher Methode, nämlich „nach dem hierorts eingeführt üblichen Portionsfuß“ festgelegt. So entsprach eine „Portion“ dem Betrag von 3 Gulden 15 Kreuzer. Ein Laibl Brot kostete damals etwa 3 Kreuzer, 1 Maß Weißbier 4 Kreuzer; 60 Kreuzer entsprachen 1 Gulden.
Pfarrhof als Quartier begehrt
Allein Pfarrer Albert Wagner erhielt wegen „seiner in der nämlichen Quartierslast“ die gleiche Entschädigung wie der „erste großbegüterte Bürger Joseph Weber“ (heute Gasthof Penzkofer), nämlich jeder von beiden genau 29 Gulden und 15 Kreuzer für jeweils 9 Portionen. Hinsichtlich des Pfarrhofes ist dies insoweit verständlich als Pfarrhöfe aufgrund ihrer wirtschaftlich meist guten Ausstattung in erster Linie von den Offizieren einer Truppe als Quartier ausgewählt wurden. Unter „Portionen“ ist die Zahl wie auch der Umfang der jeweiligen Einquartierungen zu verstehen. Die weniger besitzenden Bürger wurden daher nur mit 1 bis 3 Portionen abgefunden. Insgesamt wurden die 484 Gulden 15 Kreuzer in 149 Portionen aufgeteilt. Mehrmals folgten bis 1832/33 noch weitere Zahlungen; offenbar immer nur dann, wenn der Staat dafür Geld zur Verfügung stellen konnte.
Insgesamt dürfen diese, Jahre nach den Kriegen getroffenen Entschädigungsmaßnahmen des Staates, nur als ein „Tropfen auf den heißen Stein“ bewertet werden, wenn wir in Betracht ziehen, dass in Kriegszeiten gerade die hohen, aufgezwungenen Quartierskosten für durchziehende Truppen so manche Eschlkamer Bürger in eine erhebliche finanzielle Bedrängnis brachten. So wird beispielsweise fünf Jahre nach dem Österreichischen Erbfolgekrieg in einem Vertrag vom 1. Juli 1747 betont, dass die Familie Schmirl (Vorbesitzer von Joseph Weber, heute Gasthof Penzkofer) in den „jüngst verflossenen Kriegszeiten durch die viele zu prostieren gehabte Anlag (Kriegsanleihen) und Quartirs in eine hohe Schuldenlast verfallen“ sei (siehe dazu den Artikel „Die Übergabe des späteren Gasthof Penzkofer“).
Werner Perlinger
Das „Heimatrechth“ berührte viele Lebensbereiche - der Fall Anna Denzl
+Eschlkam. Häufig hatten der Bürgermeister und seine Gemeinderäte im 19. und auch noch im 20. Jahrhundert über „das Recht auf Heimat“ bzw. das „Heimatrecht“ zu entscheiden, eine Maßnahme, die den Verantwortlichen oft wahrlich nicht leicht fiel.
Das Heimatrecht beschreibt die Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Gemeinde, mit dem Wohnsitz als einem gebührend zu würdigenden Grund. Der Verlust trat nur infolge des Erwerbs einer andern Staatsangehörigkeit oder eines andern Heimatrechts ein. So hatte der Wegzug (damals auch: Überzug für Umzug) aus einer Gemeinde in eine andere nicht den Verlust des Heimatrechts zur Folge, vielmehr musste die Heimatgemeinde später den verarmten Heimatberechtigten notfalls wieder an- und aufnehmen und versorgen. Auch die Befugnis zur Eheschließung war von dem Besitz des Heimatrechts und von der Zustimmung der Heimatbehörde abhängig. Das Recht, Grundbesitz zu erwerben und ein Gewerbe zu betreiben, hing ebenfalls vom Heimatrecht ab. In Bayern galt das „Heimatrecht“ noch bis zum Jahr 1917.
Wir schreiben das Jahr 1832. Da wendet sich am 14. Januar die Verwaltung der Ruralgemeinde (ländliche Gemeinde) Vorderbuchberg in schriftlicher Form förmlich an den Marktmagistrat und schildert, dass sich in Vorderbuchberg seit Jahren schon die ledige Inwohnerstochter Anna Denzl mit ihren „außerehelichen Kindern“ aufhalte und auf Vorhalt des Lehrers Reindl von Neukirchen mit dem Schulgeld in Höhe von 4 fl (Gulden) und 48 Kreuzer für ihre bereits schulpflichtigen Kinder „im Rückstand“ stehe. Lehrer Reindl drang auf baldigste Bezahlung, da die Denzl, „die ganz arm ist“, mittlerweile nicht mehr in Vorderbuchberg sich aufhalte, sondern am Multererhof. Deshalb müsse man, so die Ruralgemeinde, „an den wohlweisen Magistrat um Berichtigung dieses Ausstandes das Ansuchen stellen, da die Denzl ihr Heimatrecht in Eschlkam habe“.
Die Eschlkamer ließen ich in dieser Angelegenheit zunächst Zeit. In einer längeren Stellungnahme versuchte der Marktrat zu begründen, dass die Denzl „eine neue Heimat in der Gemeinde Vorderbuchberg“ gefunden habe, nachdem sie als Kind nach dem Ableben ihrer Eltern zu ihrer dortigen „Freundschaft (nähere Verwandtschaft) kam, da erzogen wurde und circa mehr über 30 Jahre dort gelebt habe“. Demnach ist die „neue Heimath ihr zugestanden und von ihr erworben worden.“ Das fragliche Schulgeld – und nur darum ging es bei der ganzen Sache – sei deshalb von der Gemeinde Vorderbuchberg zu begleichen.
Am 12. Juni kam es in der Sache „Heimath“ zu der Feststellung: „Anna Denzl, ehelich erzeugte Inwohnerstochter von Eschlkam, hat in dieser Gemeinde ihre Heimath anzusprechen.“ Die Tatsache, dass die Denzl mehrere Jahre in Vorderbuchberg lebte und (als Magd) diente, könne „ihre ursprüngliche in Eschlkam begründete Heimath nicht aufheben“.
Einen Anwalt eingeschaltet
Die Marktführung gab sich mit dieser Einlassung jedoch nicht zufrieden. Eingeschaltet wurde der Stiftungsanwalt für die Landgerichtsbezirke Cham und Roding, ein gewisser Dr. Parst. Er schreibt am 30. Juni an den Magistrat u.a.: „Hätte ich auch nur entfernte Hoffnung gehabt, in rubrizierter (speziell in dieser) Sache ein günstiges Urtheil zu bezwecken, so würde ich auch um Mitternacht den Rekurs (Gegenklage) ergriffen haben.“ Mit der Tatsache aber, dass die Denzl ihr ursprüngliches Domizil in Eschlkam besaß, eine angenommene Verjährung des Heimatrechts nicht wirksam sei, würde eine „Appellation nur zwecklose Kosten verursacht haben“, so der Anwalt in seiner Antwort. Nachdem der gesamte Vorgang durch seinen Konzipisten (Rechtsanwaltsanwärter) erledigt worden sei, empfahl sich Anwalt Parst „zu ferneren Diensten, und verharre mit bekannter Hochachtung, Dr. Parst, Stiftungsanwalt“. Das ganze Prozedere schließt mit einer Aufforderung des Landgerichts Kötzting an die Marktbehörde, den Schulgeldrückstand – mittlerweile angewachsen auf 6 Gulden 48 Kreuzer – „von der Anna Denzl zu erhollen, oder aber bey ihrer Unvermögenheit diesen Betrag aus dem Lokal-Armenfonde an den Schullehrer Reindl zu bezahlen“. 1 Gulden würde heute etwa einem Betrag von knapp über 6 Euro entsprechen. Verständlich wird der ganze Hergang erst dann, wenn man weiß, dass damals die Löhne für einfache Arbeiten im Vergleich zu heute extrem niedrig waren. Der Markt Eschlkam musste letztlich die Forderung des Lehrers Reindl begleichen.
War man im Besitz des Heimatrechts wurde vom jeweiligen Magistrat dafür ein sog. „Heimatschein“ in Bedeutung einer Urkunde ausgestellt. So erhielt beispielsweise die Zolleinnehmerstochter Anna Maria Ruesch einen Heimatschein von der Gemeinde Flossenbürg im Jahr 1873 ausgestellt, da dort ihr Vater, der Zollbeamte Franz Jakob Ruesch von 1816 bis 1820 in tätig war. Im gleichen Jahr wurde er „quiesziert (in den Ruhestand versetzt) und starb dann 1822 in Eschlkam. Bereits 1792 ist in einer Steuerliste in Eschlkam als Mautgegenschreiber Karl Anton Ruesch als Bewohner des Anwesens Nr. 30/Waldschmidtplatz 3 erwähnt. Die Vorfahren der Ruesch oder auch Rues dürften aus der „Rußmühle“ bei Gleißenberg stammen, da dort im 17./18. Jahrhundert eine Familie Ruesch als Müller dieses Mühlenanwesen innehatten.
Werner Perlinger
Eschlkamer Bürger dienten als Geschworene auch bei den Schwurgerichten
+Eschlkam. Im Marktarchiv finden sich Archivalien, die uns über die Bemühungen der Gemeindeführung unterrichten, auf staatliche Anordnung hin geeignete Persönlichkeiten unter der Bürgerschaft zu finden, damit diese künftig als sog. Geschworene bei den Schwurgerichtsverhandlungen eingesetzt werden können.
Zunächst aber allgemeine Informationen zu diesem Themenbereich: Erst im Jahr 1924 löste der heute gängige Begriff >Schöffe< das ältere Wort >Geschworener< ab. Früher jedoch bestanden Geschworenengerichte vielerorts in unserem Lande. Diese Gerichtsbarkeit wurde nach der Revolution im Jahre 1848 in vielen Staaten des damaligen Deutschen Staatenbundes eingeführt, so auch in Bayern. Die Intention Geschworene bei den Gerichten eigentlich als ehrenamtliche Laienrichter einzuführen war, die Gerichte unabhängiger zu gestalten und auch die Willkür damals meist adeliger Berufsrichter zu begrenzen und der Gerechtigkeit innerhalb der Verfahren zum Durchbruch zu verhelfen.
Wir befinden uns in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Erstmals im Jahr 1848, so die Aktenlage, hatte die Marktführung an das Landgericht Kötzting eine Liste von Bürgern zu schicken, die für die hoheitliche Aufgabe, als Geschworene an Gerichtsverhandlungen mitzuwirken, in Frage kommen könnten. Dazu gab es klare Anweisungen.
Und so erreichte am 10. August 1848 den Markt ein Schreiben des Landgerichts Kötzting, hinweisend auf die Einführung der Schwurgerichte im gleichen Jahr, mit dem Auftrag „diejenigen Personen, welche sich nach diesen gesetzlichen Bestimmungen zu Geschworenen qualifizieren in ein Verzeichnis zu bringen, welches vom Bürgermeister und zwei Magistratsräten zu fertigen und in der Gemeinde während 14 Tagen im Rathause zu Jedermanns Einsicht auszulegen und wie geschehen öffentlich bekannt zu machen ist“.
1849 wurden dem Markte mitgeteilt, welche Voraussetzungen die für die Wahl infrage kommenden Personen zu erfüllen hatten. So hatten die Aspiranten entweder das Amt eines Bürgermeisters, Magistratsrates oder Gemeindevorstehers zu bekleiden, oder sie hatten es wenigstens in den letzten 12 Jahren bekleidet; oder sie können einen akademischen Abschluss, vielleicht sogar mit Doktorgrad vorweisen; oder sie hatten vollständige Kunststudien an einer deutschen Akademie der bildenden Künste absolviert. Es genügte aber auch „jährlich an direkten Steuern einen Gesamtbetrag von wenigstens 20 Gulden entrichtet zu haben“, d.h. finanzielle Unabhängigkeit sollte vorliegen, wenn die erst genannten Bedingungen nicht gegeben waren. Man wollte so auch möglicher Bestechlichkeit einen Riegel vorschieben.
Für das verantwortungsvolle Amt kamen nicht in Frage: gerade im Dienst stehende besoldete Staatsdiener und aktive Angehörige des Militärs; ferner „alle Individuen, welche ein geistliches Amt bekleiden, oder geistliche Funktionen verrichten“; dann auch Advokaten an den Gerichten, wo die ……..gehalten werden. Auch durfte ein Geschworener nicht unter 30 Jahre sein. Geistige wie auch körperliche Gebrechen waren ebenfalls Gründe für eine Ablehnung. Letztlich waren von der Wahl ausgeschlossen, „alle diejenigen, welche wegen eines Verbrechens oder wegen Vergehens der Fälschung, des Betrugs, des Diebstahls oder der Unterschlagung verurteilt worden sind“.
Als ein Beispiel sei dem Leser die im Jahr 1858 von der Marktführung aufgestellte Liste für den Geschworenendienst unterbreitet. Darin aufgeführt sind neben dem Namen, das Alter, der Beruf und die Begründung für die Eigenschaft als künftiger Geschworener. Beigefügt wurde vom Verfasser noch der damalige Wohnsitz in Eschlkam:
1) Joseph Neumeier, 51 Jahre, Gastwirt und Ökonom, Nr. 1 (Waldschmidtstraße 14), er erfüllt allein die geforderte Steuerquote in Höhe von 20 Gulden; 2) Andre Penzkofer, 41, Müller, Nr. 45 (Penzenmühle 1-3), ebenfalls aufgrund der Steuerquote; 3) Anton Saemmer, 41, Weißgerber, Nr. 44 (Kleinaigner Str. 25), zur Zeit Magistratsrat; 4) Franz Pfeffer, 40, Seifensieder, Nr. 60 (Marktstraße 15), Magistratsrat von 1845-51; 5) Anton Korherr, 54, Binder, Nr. 11 (Kleinaigner Str. 9), Magistratsrat von 1845-51; 6) Aloys Schmirl, 47, Schuhmacher, Nr. 41 (Blumengasse 5), zur Zeit (z.Z.) Bürgermeister; 7) Andre Pohmann, 52, Schuhmacher, Nr. 54 (Blumengasse 12), Magistratsrat von 1848-54; 8) Mathias Späth, 41, Gastwirt, Nr. 35 (Marktstraße 7), Mag. Rat 1851-57; 9) Georg Forster, 57, Anwesensbesitzer, Nr. 36 (Marktstraße 9), Mag. Rat 1851-57; 10) Wenzel Späth, 34, Ökonom, Nr. 5 (Further Straße 3), z.Z. Magistratsrat; 11) Joseph Lemberger, 39, Bäcker, Nr. 37/38 (Marktstraße 11), er erfüllt die Steuerquote; 12) Wolfgang Rieder, 43, Krämer, Nr. 61(Großaigener Str. 1), z.Z. Magistratsrat und letztlich Georg Sporrer, 43, Anwesensbesitzer, (Blumengasse 11), z. Z. Magistratsrat.
Wer nun von diesen Personen im Jahr 1858 vom Landgericht Kötzting auserkoren bzw. berufen wurde, letztlich für eine weitere Periode als Geschworener am Schwurgericht in verantwortungsvoller Position wirken zu dürfen, geht aus der Aktenlage im Marktarchiv nicht hervor.
Werner Perlinger
Als es im Markte Eschlkam einer geeigneten Arrestzelle ermangelte
+Eschlkam. Im Jahre 1824, die napoleonischen Kriege waren gerade mal zehn Jahre vorbei, ging es im Markt um die Einrichtung eines sog. Arrestlokals, also einer Art Gefängnis. Denn notorische Bettler und sonstige Herumtreiber, die bewusst jegliche geregelte Arbeit mieden, gab es damals zuhauf und dieser damals nicht kleine Personenkreis stellte häufig eine erhebliche Belastung für die Städte, Märkte und das offene Land dar. Diese Leute gab es zu allen Zeiten, denn eine soziale Absicherung in den verschiedenen Facetten, wie heute üblich, war nicht gegeben. Nicht selten wurde das Bettler- und Vagantenwesen zu einer Plage, besonders dann, wenn sich unter ihnen gefährliche Leute befanden, die, um an Geld zu kommen, vor einzelnen schweren Straftaten wie Diebstahl oder Raub nicht zurückschreckten. Gerade das Grenzgebiet war oft von solchen Leuten regelrecht überlaufen und irgendwie musste man seine Bürger schützen, so auch im Gemeindegebiet von Eschlkam. Wurde man dieser Leute habhaft, kamen sie bis zum nächsten Tag in einem dafür vorgesehenen „Arrestlokal“ in Haft, um sie dann weiterziehen zu lassen (erinnern wir uns an die „Vagantin“ Katharina Falter und deren Schicksal im letzten Artikel).
Arrestlokal im Hüthaus
Das Landgericht Kötzting als die dem Markt übergeordnete Behörde, heute wäre es das zuständige Landratsamt, wünschte am 23. Januar 1824 innerhalb von acht Tagen Aufklärung darüber, warum das Arrestlokal im Hüthause und nicht im Hause des Marktdieners untergebracht sei. Das sog. „Hiethaus“, worin früher die Hirten mit ihren Familien wohnten, hatte einst die Nr. 49, nun Steinweg 6. Zugleich wurde es auch als „Armenhaus“ genützt, wo völlig mittellose Personen des Marktes eine Herberge fanden. Dagegen wohnten die einzelnen Marktdiener mit ihren Familien über lange Zeit hinweg in Anwesen Nr. 62, jetzt Großaigner Straße 5. Am 31. Januar antwortete die Gemeinde dahingehend, dass für ein Arrestlokal das Haus des Marktdieners ungeeignet sei, da es gänzlich nur aus Holz bestehe und derzeit durch die Familie des Marktdieners (Franz Pinzinger) mit acht Kindern überbelegt sei. Außerdem liege dieses Häusel abseits auf einem Hügel, was die mögliche Flucht eines Arretierten begünstige. Auch hätte der Stadtmauerer und Zimmermeister von Furth (damals Anton Großer) als beigezogener Gutachter dieses Häusl für ein Arrestlokal als „zweckundienlich“ eingeschätzt. Dagegen habe er das Armenhaus, es war teils gemauert, wo sich auch die zwei „Nachtwächter“ zeitweise aufhalten, „baulich ausführbar und genügend zur Bewerkstelligung eines Arrestlokales gefunden“, da es „vor (der Möglichkeit des) Ausreißens hinlänglich befestigt werden kann“. Kein Verständnis zeigte der Magistrat, dass „dieses mit Kostenaufwand hergestellte Lokal jetzt nicht gebraucht werden kann“. Auch habe der „vormalige Stations Commandant“ (der Polizeibehörde) bei Begutachtung des Arrestlokals daran „nichts Widriges gefunden“. Mittlerweile war sogar die Regierung eingeschaltet. Die Königliche Regierung des Unterdonau-Kreises, Kammer des Innern mit Sitz in Passau forderte den Landrichter von Kötzting am 4. Juli auf, „er habe dem Magistrate zu Eschlkam zu bedeuten, daß er unverzüglich…ein anderes taugliches Arrestlokal auszumitteln habe…da das dermal projektierte Lokal als unbrauchbar erscheint“. Vier Wochen wurden der Gemeinde dafür Zeit gegeben.
Eine Lösung gefunden
Die Zeit verstrich jedoch bis zum 26. August. Da hatte der Marktrat – lange hatten die Gemeindebevollmächtigten in dieser Angelegenheit beratschlagt - nun eine Lösung gefunden. Man hatte „in einem unweit des dermaligen Gendarmerielokals entlegenen Bürgerhaus in dessen oberen Stocke ein Zimmer zum Arrestanten Lokal ausermittelt, welches nach meiner Ansicht für zweckmäßig anerkannt werde“, so die gutachterliche Feststellung des damaligen Vorstehers des Gendarmerie Stations Commandos, Christoph Schnabel.
Das besagte Zimmer befand sich im Hause des Krämers Josef Bärtl, früher Haus Nr. 25, nun Waldschmidtplatz 8, gelegen also im Zentrum des Marktes unweit des Anwesens wo die Gendarmerie ihren Sitz hatte (vormals in Haus Nr. 2 / Waldschmidtplatz 10; später im Mauthaus Nr. 5 ½ / Waldschmidtstraße 4 ½). Vom Jahr 1734 an besaß die Krämerfamilie Bärtl bis 1837 dieses Anwesen, der heutige „Balsenbäck“. Am 25. Oktober genehmigte das Landgericht den Vorschlag der Marktgemeinde und forderte „zur Errichtung dieser Lokalität unverzüglich Anstalt zu treffen“, was auch geschah. Denn am 7. Dezember 1824 meldete die Marktgemeinde, „das neue Arrestlokal befindet sich dermal zu Gebrauch in Vollzug“. Damit war endlich für verdächtig herumziehende, nicht sesshafte Personen eine taugliche, kurzzeitige Unterkunft geschaffen.
Dieser Zustand hielt offenbar nicht allzu lange an, denn 23 Jahre später, am 2. April 1847, berichtet der Königliche Landrichter von Kötzting an den Magistrat, am 23. Februar habe „bey Unterbringung eines aufgegriffenen Vaganten“ der Gendarm Stoiber, aus eigener Tasche für 6 Kreuzer Brennholz kaufen müssen, „um das Arrestlokal zu beheitzen, um (so) den Arrestanten vor Kälte zu schützen“. Dabei stellte sich heraus, dass der Arrestraum sich wiederum im Hüthause zu ebener Erde befand. Dadurch könne einem Arrestanten „durch das Fenster Werkzeuge gereicht werden“, um damit auszubrechen, so die Befürchtung der Behörde. Schleunigste Abhilfe wurde gefordert.
Der Magistrat jedoch erwiderte, es fehle der Gemeinde einfach das nötige Geld „ein eigenes Gefängnis zu bauen“. Wenn auch die Lokalität vom Marktzentrum „etwas entlegen ist, so würden in diesem Hause doch mehrere Parteien wohnen, so dass eine Flucht rasch vereitelt werden könne, noch dazu „da der alte Soldat Bachmaier den Auftrag habe, gehörig zu wachen“. Damit schließt der Akt und die eigentlich untragbaren Zustände blieben zunächst noch bestehen.
Werner Perlinger
Der Fall der Katharina Falter – eine Frau mit Kindern ohne Heimat
+Eschlkam. Die Marktbehörde hatte sich mitunter auch mit herumziehenden Personen zu beschäftigen, die keinen Pass oder gar einen festen Wohnsitz aufweisen konnten. Unter dem Titel >Die Vagantin Katharina Falterin< schildert ein Akt im Marktarchiv wie beispielsweise im Jahr 1837 die Behörden mit wohnsitzlosen Personen umgingen. Das Wort >Vagantin< (von lateinisch vagare für umherstreifen, ziellos unterwegs sein) meint hier eine Bettlerin. Sie gehörte zur untersten sozialen Schicht, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus Almosen, milden Gaben bestritt. Eine soziale Absicherung wie wir sie heute schon lange kennen – und das sei vorausgeschickt - gab es damals nicht.
So schreibt am 30. April 1837 Josef Schrimpf, Stadtrichter des Stadtgerichts Neumark (Všeruby) in Böhmen an die Marktbehörde, dass eine Katharina Falter, gebürtig aus „Krabitz“ (seit 1946 ein Ortsteil der Stadt Furth), welche mit 3 lebenden Kindern versehen ist, wegen Paßlosigkeit, arbeitslosen Herumziehen und Betteln abgeschafft (ausgewiesen) wurde“. Schrimpf stellte an Eschlkam noch das „dienstfreundliche Ansuchen“ die Person an das für sie zuständige Pfleggericht „abzuliefern“. Besonders wurde bemerkt, dass „dieselbe ihr vorgeschriebenes Zehrgeld zu 6 Kreuzer erhalten hat“. Also hat man die Frau nicht ohne Unterstützung weitergeschickt.
Nur einen Tag später, am 1. Mai, beschwert sich Stadtrichter Schrimpf beim Markt, die Falter sei mit ihren 3 Kindern „heutigen Tags wieder hierher transportiert“ worden. Daher sah sich Neumark „bemüssigt, selbe neuerdings über die Gränze fortschaffen“ zu lassen „mit dem Ansuchen selbe nicht nach Krabiz sondern zum Landgericht Cham zu übersenden“, da sie „im königlichen Bayern gebürtig ist“.
Eine Hin- und Herschieberei hatte begonnen, man muss sich nur in die Lage der Frau und ihrer Kinder versetzen. Sollte die Falter nicht geduldet und wieder „anher gesendet“ werden, werde man sich an das K(aiserlich) K(önigliche) Kreisamt wenden und um Schutz für einen „angedrungenen (aufgedrängten) Ausländer“ (bitten). Einen Tag später, am 2. Mai, informiert der Eschlkamer Bürgermeister (Michael) Kaufmann (Hsnr. 31/Burgweg 2), „(die Falter) wird wieder nach Grabitz in ihr Heimatort samt ihren 3 lebenden Kindern ergo recepisse (wegen Rücknahme) verschoben zur ersten Schubstation Furth alldahin“. Dort in Grabitz lebte noch ihr Vater Blasius Falter als „aufgenommener Insaß“ (wohl im Armenhaus; über eine solche Einrichtung verfügte jede Gemeinde).
Am 6. Mai forderte das Landgericht Kötzting vom Markt, sich künftig „strenger an die bestehenden Verordnungen über Annahme von Personen, die vom Auslande (hier Böhmen, das zur K. K. Monarchie Österreich gehörte) eingeschoben werden wollen, zu halten“. Eine weitere Stellungnahme zur „Haimath der Katharina Falter“ gab am 8. Mai das Landgericht Cham gegenüber der Kötztinger Behörde ab.
Nach erneuter Schilderung der einzelnen Abläufe erfahren wir dabei, dass die Falter vorher im Banat gewesen ist. Wohl war sie vor geraumer Zeit – wie viele andere Deutsche aus Armutsgründen auch - in dieses Land ausgewandert und kehrte dann wohl wegen für sie gegebener Perspektivlosigkeit wieder in ihre Heimat zurück.
Gerügt wurde vom Chamer Landrichter (Dr. Franz Xaver) Reber, dass der Markt die Frau mit den Kindern ohne Nachprüfung ihrer Staatsangehörigkeit übernommen habe, „ohne dass der Nachweis ihres Heimatrechts dem Schubpaß (Abschiebeformular) beigefügt war“. Nachdem die böhmische Behörde die Falter nicht mehr zurücknehmen wolle, „so verwahrt man sich hiermit gegen die Haimaths- und Alimentationslast (Sorge für den Lebensunterhalt) bezüglich derselben, wenn sie als der Gemeinde Grabitz angehörig nicht anerkannt werden sollte“. Wie die Angelegenheit für die Falter und ihre Kinder schließlich endete, berichtet der Akt nicht. Wahrscheinlich verblieb die Falter mit ihren Kindern für die nächste Zeit in Grabitz, unterstützt von der dortigen Gemeinde.
Bei Betrachtung dieser Vorgänge müsse man sich schon auch fragen welche Chancen die Kinder solcher heimatlosen Leute hatten. Obwohl bereits am 23. Dezember 1802 durch Verordnung des Kurfürsten Max IV. in Bayern die >Allgemeine Schulpflicht< gesetzlich verpflichtend war konnten die Kinder der Falter für längere Zeit kaum eine Schule besuchen. Sie blieben meist Analphabeten. Damit war ihnen eine wesentliche Möglichkeit genommen aus dem Teufelskreis des Vagantenwesens auszubrechen und mittels Erlernung eines Berufes einen bescheidenen gesellschaftlichen Aufstieg zu wagen.
Im folgenden Artikel wird der Leser erfahren, wo im Markte und auf welche Weise die sog. Vaganten, die nicht sesshaften Leute jeweils über Nacht notgedrungen beherbergt wurden.
Werner Perlinger
Aus einem Polizei Verhandlungs- und Strafprotokoll der Jahre 1819/21
+Eschlkam. Im Rahmen der gegebenen Polizeihoheit hatte der Marktrat für die Wahrung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Diese unliebsamen Aufgaben waren in der Regel dem jeweiligen Marktknecht übertragen. Wie in allen Orten im Hohenbogen-Winkel, so wurde auch in Eschlkam besonders auf die Sicherheit vor Schadensfeuer geachtet, denn bekanntlich zerstörten Brände früher mitunter ganze Ortsteile. Besonders wurde dem Flachsdörren (am eigenen Herd) und Flachsbrechen in den Stuben besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Marktrat hatte auch die Brot-, Fleisch und Mühlenbeschau durchzuführen, die Lebensmittelpreise zu prüfen und bei den Bäckern das Gewicht der Produkte zu überwachen. Für diese Dienste wurden bei jeder Ratswahl eigens Personen aus dem Ratsgremium bestimmt.
Im Marktarchiv finden sich zahlreiche polizeiliche Protokollniederschriften, vor allem aus dem frühen 19. Jahrhundert. Es seien aus den Jahren 1819 und 1821 im Detail einige Vorkommnisse geschildert, die sich oft wiederholten, jedoch in strafrechtlicher Hinsicht zu den wirklich kleinen Delikten zählen, die darum auch nur vom Magistrat abgehandelt wurden.
Der erste Fall schildert eine Beleidigung wie sie so oder ähnlich in den Wirtshäusern von Eschlkam „beim Bier“ zu fortgeschrittener Stunde immer wieder vorkamen. Die Angelegenheit kam vor das Marktgericht, dem am 6. Dezember 1819 Bürgermeister Schreiner (einer der Hoamater; Hsnr. 37/38/ Marktstraße 11) und die Markträte Bartl (Hsnr. 25/Waldschmidtplatz 8) und (Ignaz) Schmirl (Hsnr. 72/Marktstraße 12), vorsaßen. Was war geschehen: „Anton Hastreiter, Bürger und Bäckermühlner derorten (Hsnr. 46/Bäckermühle 1 u. 2), hat sich in der Gastgebsbehausung des Andrä Kilger (Hsnr. 58/Blumengasse 2) erfrecht, den 4. Herrn Magistratsrat Joseph Korherr (Kufner auf Hsnr. 71/ Großaigner Straße 2) einen Lumpen zu schimpfen, welches er auch vor Magistrat heute nicht in Abrede stellen konnte“. Hastreiter fügte an, „es sey ihm diese Injurie (Beleidigung) leider in der Trunkenheit ausgebrochen“. Dem Hastreiter wurde sein Tun „allen Ernstes verwiesen“ und ihm empfohlen „für hinkünftig eine höhere Achtung, und bescheidenes Betragen aufzutragen.“ Zusätzlich wurde er gewarnt, „daß man einen weiter solchen Vorfall hohen Orts anzeigen, und zur empfindlichen Bestraffung überschreiben werde.“ Hastreiter musste zur Strafe 1 Gulden entrichten und „ad fundus Paup(erum), an die Armenkasse, 28 Kreuzer. Das Urteil unterschrieben Hastreiter (des Schreibens unkundig) mit einem Handzeichen und Joseph Korherr.
Am 13. Januar 1821 beschwert sich vor dem für polizeiliche Verhandlungen zuständigen Ratsgremium, gebildet aus dem Bürgermeister Schreiner und den Magistratsräten Bartl, Schmirl und Korherr, der bürgerliche Metzger Joseph Scheppel (Hsnr. 34/Marktstraße 5), „daß Johann Leuthermann, bürgerlicher Insasse (sich) unterfangen habe große Rinder Vieh zu schlachten und auszupfunden“. Der so Beklagte stellte den Vorwurf nicht in Abrede. Es wurde ihm sein „Anmaßen strengstens verwiesen“ und mit einer Strafe in Höhe von 1 Gulden 24 Kreuzer belegt. Am gleichen Tag wurden im Markt auch die von den Krämern angebotenen „Victualien“ (Lebensmittel) überprüft, ebenso die Maße und Gewichte und sämtliche Prüfobjekte insgesamt. Alles wurde für in Ordnung befunden.
Die Jugend am Tanzboden
Am 25. Januar 1821, auch damals wurden bereits Faschingsveranstaltungen abgehalten, mussten Übertretungen geahndet werden: „Wiewohl am letzten Sonntag gehörig und öffentlich bekannt gemacht worden war, daß keine Feiertagsschüler (heute der Berufsschüler) unter 16 Jahren und Mädchen unter 14 Jahren bei einer Tanzmusik sollen sich blicken lassen, und im Übertretungsfall die nachläßigen Eltern“ bestraft würden, „so haben sich Joseph Fischer und Georg Pfeffer, Bürgerssöhn […] um 7 Uhr Abends beym Wirth Joseph Spaeth (Hsnr. 5/Further Straße 3) tanzend betreten lassen“. Deshalb wurde den beiden und auch ihren Eltern ihr Vergehen „strengstens verwiesen“. Auch wurde den Eltern aufgetragen auf ihre Kinder „mehr wachsame Augen zu haben“. Zur Strafe mussten die beiden Burschen je 15 Kreuzer an die Marktkasse entrichten.
Am 20. Juni wurde der Metzger Scheppel selbst zum Beklagten. Zum Vorwurf wurde ihm gemacht, dass er am Freitag, den 15. Juni ein großes Rind schlachtete, „ohne hinzu den Polizeydiener und den Bankknecht (Bediensteter der Fleischbank) beigezogen zu haben und vom Victualien Komißar (die Schlachtung) zugleich besichtigt worden zu seyn“. Eine Geldbuße war die Folge.
Am 1. September wurde die Baderswitwe Rosalia Grauvoglin (Hsnr. 7/Kleinaigner Straße 3) erntlich gerügt, sie habe in ihrem Backofen, welcher „mit keinem eisernen Schupp (Ofentüre) versehen“, Flachs gedörrt und dieser ist dabei „brennend geworden“. Sie sorgte selbst für rasche Abhilfe, daher fiel die Strafgebühr in Höhe von 30 Kreuzern noch milde aus. Gerade das Dörren von Flachs in Privat- und nicht in den abseits der bürgerlichen Bebauung liegenden Brechhäusern war oftmals Ursache für verheerende Schadensfeuer.
„Die im Dienst zu verweisen seyende ledige Weibspersonen“, war stets auch Aufgabe des Magistrats. Dieser stellte im November 1821 folgendes fest: „es schleicht sich der Unfug ein, daß mehrere ledige Weibspersonen, die allerdings zum Dienen geeignet, […] dem Dienen (als Magd oder Hausbedienstete) sich entziehen, wodurch man über ihr sittliches Betragen nicht hinlänglich versichert ist. Magistratseits hat man nun die Verfügung getroffen und die Beschreibung dieser Weibspersonen, als auch der groß erwachsenen unehelichen Kinder angeordnet“, um ein Verzeichnis darüber an das Königliche Landgericht weiterleiten zu können. Ebenso wurden die „Wanderbüchel“ (Beschäftigungsnachweise) registriert, um diesen Personenkreis „beim nächsten Heiligen Lichtmeß anno 1822 in (den) Dienst zu schaffen“. Eine wirklich wirksame Abhilfe konnten diese Maßnahmen mangels ständiger Beaufsichtigung nicht sein, wie letztlich die zahlreichen unehelichen Geburten beweisen. Noch lag in weiter Ferne das erst zum 1. Januar 1876 eingeführte Gesetz, das die Ehefreiheit grundsätzlich allen sozialen Schichten garantierte.
Werner Perlinger
Aus alten Protokollen des Handwerks – der Willkür war oft Tor und Tür geöffnet
+Eschlkam. In den archivischen Sammlungen finden sich zahlreiche Niederschriften, die sich mit der Konzession befassen, im Markt ein Handwerk ausüben zu dürfen. Das Prozedere war stets gleich. Der Antragssteller, fast immer ein Nachkomme eines noch tätigen Handwerkers, bittet den Marktrat um die Genehmigung in die Fußstapfen des Vaters oder Onkels treten zu dürfen. Vorgelegt dafür wurden eine Ausbildungsbestätigung, ein in der Regel in attraktiver urkundlicher Form abgefasster Nachweis der abgeleisteten Militärpflicht, dann vor allem ein Attest, dass der Antragssteller sich einer Pockenschutzimpfung unterzogen hatte. Mit dem Begriff >Pocken< oder auch >Blattern< genannt, bezeichnet man eine für den Menschen gefährliche und lebensbedrohliche Infektionskrankheit, woran früher viele Menschen starben, daher die Impflicht. Von entscheidender Bedeutung war daneben das „Leumundszeugnis“, ausgestellt bei einem Sohn des Marktes von der Ortsbehörde selbst oder von der Behörde woher der Bittsteller kam.
Der Marktrat, bestehend aus ansässigen Bürgern, gehörend zur wirtschaftlich besser gestellten Schicht, die als Ökonomiebürger nebenher selbst ein Handwerk ausübten, prüften die eingereichten Unterlagen. Vor allem wurde großer Wert darauf gelegt, dass bei Erteilung von Eheerlaubnissen, der Ansässigmachung und damit verbunden mit der Ausübung eines Handwerks oder sonstigen Gewerbes künftig der „Nahrungsstand gesichert ist“. Der Bittsteller musste beispielsweise darlegen, wieviel an Heiratsgut er oder die künftige Ehefrau als Grundvermögen mit in die Ehe bringen, oder ein Elternteil bürgte für eine gesicherte wirtschaftliche Zukunft.
Nicht selten wurden die Anträge auf Heirat oder Gewerbeausübung so mancher Bittsteller abgewiesen mit dem genannten Argument des „nicht gesicherten Nahrungsstandes“.
Und so kamen meist die noch jungen Leute in unliebsame Nöte. Oft nannte das heiratswillige Paar bereits ein oder zwei, ja manchmal drei Kinder sein eigen. Und wiederholte Bitten auf die Erteilung einer Heiratserlaubnis wurden oft unisono, manchmal sogar schroff formuliert, verweigert.
Mögliche Konkurrenz ausgeschaltet
Das galt auch für die Arbeitserlaubnis von einfachen Tagelöhnern oder eben auch für angehende Handwerker. In diesem Fällen wurde meistens darauf verwiesen, dass gerade auf diesem Sektor der Handwerkszweig bereits voll ausgelastet sei. Aber stimmte das auch?
Wir müssen eines wissen: Die Entscheider übten meist selbst ein Handwerk aus oder waren Krämer oder Händler, und diese Schicht fürchtete die an die Tür des Marktes klopfende Konkurrenz. Aus den zahlreichen Unterlagen sei daher beispielhaft für eine unbedingt gewollte aber letztlich doch nicht durchsetzbare Abweisung der Fall des „concessionierten Schreiners“ Joseph Blab angeführt:
Zur Vorgeschichte: 1822 erhielt Blab vom Landgericht Kötzting die Zulassung als Schreiner im Markte Eschlkam und dazu vom Marktrat auch das Bürgerrecht. Am 26. November 1825 berichtet Blab an die der Marktbehörde vorgesetzte oberste Behörde, der „Königlichen baierischen Regierung des Unterdonaukreises, Kammer des Innern“ mit Sitz in Passau, er müsse sich verehelichen, da er als „Gewerbemann…u.a. der weiblichen Arbeit nicht vorstehen könne“. Er habe daher die Marktbehörde um die nötige Heiratslizenz gebeten, was diese aber bisher verweigert. So bat er nun als bürgerlicher Schreinermeister von Eschlkam diese hohe Behörde um richterliche Hilfe. Zwei Monate später, am 28. Januar 1826 erklärte die Marktbehörde die Verweigerung gegenüber Blab mit den Hinweisen, „daß Blab nur ein gutes Auge besitzt, ferner als Marktmusikant“ für die Ausübung des Gewerbes er sich „mehr in geschwächter, als gesunder Leibesconstitution befindet“. Deshalb könne die Zusage zur Verehelichung nicht gegeben werden. Sämtliche Markträte, neun an der Zahl und allesamt Handwerker, unterschrieben diese Entscheidung.
Pfarrer Albert Wagner hilft
Die Situation für Blab erschien aussichtslos, da mischte sich der Ortspfarrer Albert Wagner ein. Er galt als ein Priester von tiefer moralischer Gesinnung und stand der Pfarrei von 1811-1828 vor. Seine für den Leser sehr interessante Stellungnahme lautet: „Sonderbar! Wie man von Seite der Bürgerschaft und ihrer Vertreter den unsittlichsten und heillosesten Menschen, als z. B. einem Anton Pach und einem Michel Hastreiter die Heuraths-Bewilligung ohne Bedenken ertheilet: ordentlichen Menschen aber, und sittlichen guten, z.B. dem Joseph Blab dieselben abschlägt, oder ihnen, was einem Schullehrer Dobler wiederfahren ist, Hindernisse über Hindernisse entgegensetzt!!!
Das einzig gesunde Auge des Jos. Blab und sein vorgeblich geschwächter Gesundheits-Zustand sind gesuchte Vorwände. Blab hat mit einem Auge bisher arbeiten können: wird es ferner können, hat auch auf Doktor und Apotheke noch keinen Kreuzer verwendet. Die wahre Ursache (für die Ablehnung) läßt sich leicht errathen; es ist der leidige Brodneid von Seite der übrigen Schreiner; weil sie die schönen Arbeiten, welche Blab liefert, nicht machen können.“ (gez.) Wagner, Pfarrer.
Die Worte des Pfarrers schienen nicht wirkungslos gewesen zu sein. Am 12. April 1826 entschied der Regierungsbeamte Mulzer von der Behörde in Passau, dass der Marktrat „aus ganz ungültigen Gründen die Erlaubnis zur Verehelichung versagte“. Auch rügte Mulzer, dass die Marktführung „eine so auffallende Willkür und ausdrücklichste Vernachlässigung des Gesetzes an den Tag gelegt“ habe. Joseph Blab, geb. 1792, Sohn des Eschlkamer Bürgersleute Georg und Therese Blab, hatte gewonnen. Er durfte am 29. Mai 1826 seine Braut, die Häuslerstochter Anna Seiderer heiraten – „eine Person von guter Aufführung und die auch nicht ohne Vermögen ist“. 1828 erbaute Blab auf einer von Joseph Bartl gekauften kleinen Wiese unmittelbar neben dem Torhaus ein eigenes Haus, die Nr. 74, heute Kirchstraße 6. Zehn Jahre später, 1836, verstarb Blab. Seine Witwe heiratete sechs Jahre später, 1844, den Straßenwegmacher Johann Messerschmied aus Regen.
Werner Perlinger
Als in Eschlkam die Turmuhr streikte – Mesner Zirngibel wehrt sich entschieden gegen Vorwürfe
+Eschlkam. Im Gegensatz zu heute, wo jeder Haushalt über eine oder mehrere Zeitmesser verfügt, waren in frühen Zeiten für die Bewohner einer Stadt, eines Marktes oder auch eines Dorfes Uhren, angebracht in luftiger Höhe an den Kirchtürmen, eine weit größere Bedeutung. Wenn heute nur mehr vereinzelt, so richteten früher die Menschen immer wieder ihren Blick auf die Uhr im Turm, ob sie nun direkt davor standen oder sich gerade entfernt auf freiem Gelände befanden. Umso mehr wurde darauf geachtet, dass diese Uhren, Werke metallmechanischer Kunst, stets einigermaßen genau die Zeit vermittelten. Das brachte es aber mit sich, dass Reparaturen häufig nötig waren. So erhielt im Jahr 1748 Wolfgang Stauber, Uhrmacher und bürgerlicher Inwohner in Eschlkam, 3 Gulden für Reparaturen an der damaligen Uhr im Kirchturm. 1761 erst konnte er für sich und seine Familie im Markt mit Nr. 22 ein eigenes Haus erwerben.
Gut 100 Jahre später, am 7. Januar 1856, beklagte sich der Magistrat unter Bürgermeister Simon Moreth gegenüber der Kirchenverwaltung (im Folgenden: KV): „seit den Sommer-Monaten vorigen Jahres macht man die Wahrnehmung, daß die hiesige Kirchenuhr bald zu früh, bald zu spät geht und manchmal ganz und gar steht“. Unverständnis äußerte der Magistrat deshalb, weil die Uhr vor nicht langer Zeit von dem Chamer Uhrmacher Steidl repariert worden sei und von der KV sogar ein Sextant „behufs richtiger Stellung der Uhr angekauft wurde“. Daher nahm der Magistrat an, dass der Sextant nicht benützt, die Uhr „entweder nicht fleißig aufgezogen, oder aus irgend einer Absicht bald vorgetrieben, bald zurückgehalten wird“. Die sofortige Beseitigung dieses Missstandes wird gefordert, sonst müsste „dem jetzigen Uhraufzieher dieses Geschäft abgenommen und dasselbe einem anderen hierzu tauglichen Individuum übertragen werden“. Der „Uhraufzieher“ war seit Jahren der Mesner Joseph Zirngibel.
Einen Tag später antwortet Pfarrer Karl Pittinger als Vorstand der KV, der Sextant werde „fleißig benützt wenn die Sonne scheint und die gemachten Wahrnehmungen würden dann dem Mesner gesagt, um sowohl seine Zimmer-Uhren, als auch die Thurm-Uhr darnach zu regulieren wie dies mit den Uhren im Pfarrhause geschieht“. Auch der Uhrmacher Steidl werde bald kommen und nach der Ursache forschen. Ein Sextant, als Gerät besser bekannt bei der Seefahrt für die Lagebestimmung, dient der Feststellung der wahren Mittagszeit, nämlich dann, wenn die Sonne am höchsten steht. In diesem Moment hatte der Mesner die Turmuhr genau auf 12 Uhr einzustellen.
Schon im März 1843 seien die gleichen Probleme aufgetreten. Sogar die „Titl. (titulierten) Herren Hauptzollamtsbeamten haben zur Zeit der Titl. Herren Oberinspectoren Vogl und Rehm das öftere unrichtige Gehen und Schlagen der Kirchthurm-Uhr mündlich (mitunter 1 Mal auch schriftlich) getadelt“. NB. (Nota bene) meinte Pfarrer Pittinger, der Sextant sei dem Mesner einige Wochen lang samt den Instruktionen über seinen Gebrauch in seiner Wohnung gelassen worden um mit dessen Hilfe die Uhren darnach zu regulieren. Pittinger glaubte eher, Zirngibel habe das Gerät nicht benutzt.
Der streitbare Mesner
Zur Person: Josef Zirngibel, geb. am 21. Januar 1783, wohnte als Mesner im sog. Mesnerhaus Nr. 27/Kirchstraße 3.Seit 1808 war er verheiratet mit Anna Maria Januel, Lehrerstochter von Rimbach. Als Witwer will er 1844 Therese Stauber, Bräumeisterstochter (28 Jahre alt) heiraten. Die Genehmigung wird ihm vom Marktrat zunächst versagt, da er als „veraltert und abgekarpfet“ gilt. Auf seinen Einspruch hin erlaubte das Landgericht Kötzting als höhere Instanz schließlich die Heirat. Nomen est Omen - der Name „Zirngibel“ bedeutet sprachetymologisch den „Raufbold“, eben einen streitbaren Menschen. Der Begriff >Mesner< leitet sich ab von dem lateinischen Wort „mansorius“, was so viel heißt wie „Hausverwalter, Hausmeister“, in unserem Fall für die Pfarrkirche.
Zirngibel erkannte, dass man ihm die Schuld an dem Malheur zuschieben wolle und deshalb bezog er zu den erwähnten Vorwürfen am 12. Januar ausführlich Stellung: Nicht er sei schuld an dem „unregelmäßigen Gang“ der Uhr, „sondern daß bei der heurigen großen Kälte kein Schall-Laden vor den Fenstern“ im Gegensatz zu früher angebracht sei. Darüber hinaus wirke sich die Zugluft auf die Uhr höchst nachteilig aus. Gleiche Probleme gebe es auch in Furth, so Zirngibel. Gleichzeitig monierte er, „dass die Wechselstangen durch starke Winde ausgehoben wurden“, er aber diesen Schaden selbst bereinigt habe. Diese Gestänge sind die Verbindungen zu den vier Zifferblättern. Letztlich meint der Mesner, ich „darf aber auch hoffen, daß man für einen 74 jährigen Mann etwas Schonung haben möchte“, da er in kurzer Zeit 50 Dienstjahre erreichen werde. Zirngibel unterschrieb als Pfarrmesner und Cantor, denn leitete er auch den Kirchenchor.
Am 16. Januar nimmt Zirngibel erneut Stellung zu drei Fragen der KV: Demnach seien an der jeweils auftretenden falschen Zeitangabe – die Uhr geht einmal vor und dann wieder nach – der starke Wind und die große Kälte schuld, umso mehr als vor den sehr großen Schallfenstern keine schützenden Läden angebracht seien. Auch möge hinsichtlich der Vorwürfe die Uhr „von unparteiischen Kennern untersucht werden“. Und sollte ihm der kleinste Fehler angelastet werden, wolle er sich einen „Verweis gefallen lassen. Jedoch behalte ich mir das Aufziehen bevor, wie seit meiner Anstellung“.
Auf die dritte und letzte Frage, ob er „ein taugliches Individuum vorschlage oder nicht, antwortete Zirngibel selbstbewusst: „Keineswegs, ich will und werde meine Pflichten erfüllen, und nicht das geringste von (des) Dienstes Erträgnissen ablassen, wohl mein Nachfolger kann thuen was er will“. Mit diesen Aussagen Zirngibels endet der Akt. Man hatte es dabei bewenden lassen. Wahrscheinlich wurden wegen der Kälte schützende Maßnahmen ergriffen, damit beispielsweise die Öle im Gangwerk nicht verhärteten oder in den heißen Sommermonaten verharzten und eintrockneten. Denn gerade diese technisch bedingten Umstände hinderten den genauen Gang der Kirchturmuhr im Markte Eschlkam.
Werner Perlinger
Die alte Schule wurde erst im Jahre 1896 erbaut – kein Hinweis im Archiv
+Eschlkam.Wer von Furth kommend die Anhöhe zum Marktplatz hochfährt, dem fällt ein an der Gabelung Waldschmidtstraße/Marktstraße stehendes wuchtiges Gebäude auf. Im Gegensatz zu den anderen Bürgerhäusern zeigt es drei Etagen und lässt an seinem Äußeren leicht erkennen, dass es sich hierbei nicht um ein herkömmliches Bürgerhaus handeln kann. Tatsächlich diente das Gebäude bis zum Jahr 1959 als Volksschule. Interessant dabei ist, dass die bisher in chronikalen Abhandlungen stets genannte Bauzeit 1824 nicht stimmt.
Vorerst aber einiges aus der Eschlkamer Schulgeschichte, jedoch nur punktuell angeführt: So wird in der Generalvisitation der Diözese Regensburg vom Jahre 1590 erstmals das Schulwesen im Markte erwähnt mit dem Hinweis: „Schuelmaister allda mit Namen Wilhelm Ottenseel; er hält allein im Winter Schule. Ein Verzeichnis der defectn (Mängel) wurde dem Herrn Pfleger übergeben. Wie im benachbarten Furth auch, gab es im Markt bereits eine Schule, wenn auch die Einrichtung (vielleicht bauliche) Mängel aufweise.
Der Hinweis anlässlich der Hausübergabe von Nr. 69, jetzt Großaignerstraße 7, im Jahr 1754: „nach Wissen ältester Bürger stand dort einst das „gemainer Markts Schuller Häusl“, lässt die Vermutung zu, dass an nahezu gleicher Stelle wohl schon vor dem Dreißigjährigen Krieg (siehe 1590) das erste Schulhaus von Eschlkam anzusiedeln wäre. Einen Beweis für seine Existenz liefert auch ein amtlicher Bericht vom Jahr 1616. Darin wurde ein besserer Besuch der Schule angemahnt, da die Kinder nur im Winter in die Schule geschickt würden und im Sommer aber „dahaimb bei der Arbeit behelt (würden)“; und dies obwohl die „Khinderlehr (Religionsunterricht) gehalten würde und auch die Schuell bestellt (in Ordnung) sei“. Nach den massiven Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg (besonders im Jahr 1634) fand der Unterricht dann über eine lange Zeit sehr häufig im Mesnerhaus, oder auch im Hause der einzelnen Lehrer statt, z. B. in Nr. 64, nun Großaigner Straße 11, allein von 1734-1824.
Am 6. August 1688 erhielt den Lehrerposten der Mesner Wolfgang Khininger mit Wirkung von Michaeli (29. September) an. In den Sommermonaten zuvor entfiel in der Regel der Schuldienst, da die Kinder für die vermehrt anfallenden landwirtschaftlichen Arbeiten oft unentbehrlich waren – ein Trend, der bis in unsere Zeit herein spürbar war. 1691, am 4. März bittet Hans Wolf Tenzl um die Übertragung der Schulmeisterstelle. Als Qualifikation bringt er vor, er habe das 6. Schuljahr absolviert und deshalb sei er im Rechnen, Lesen und Schreiben entsprechend erfahren. Der Rat stimmte dem Antrag zu. 1724 hieß der Schullehrer im Markte Liborius Greß. Ausgezeichnet unterrichte er bereits drei Jahre an der Schule, so ein Bericht des damaligen Pfarrers Michael Oberschwender an die Diözese Regensburg.
Einführung der Schulpflicht
Es sollte fast noch ein Jahrhundert dauern, als am 23. Dezember 1802 durch Verordnung des Kurfürsten Max IV. in Bayern die >Allgemeine Schulpflicht< und ein Jahr später ein allgemein verbindliches Lehrerbildungsgesetz eingeführt wurden. Mit der einsetzenden Lehrerausbildung kamen neue Ideen und konkrete Lehrmethoden in die Schule. Erstmals konnten die Kinder die doch so notwendigen Schulbücher benützen. Im Laufe der nächsten Jahre kamen die Markträte zur Erkenntnis, es müsse nun endgültig ein geeignetes Schulhaus gebaut werden. Dafür wählte man einen im Markt von den Straßenführungen her zentral liegenden Platz. Es war dies der, wo damals das „Metzger-Flore-Haus“ Nr. 24 stand. 1824 erwarb nun der „Schulsprengel Eschlkam“ das für die Schulkinder günstig gelegene Anwesen für ein künftiges Schulhaus von dem Metzger Riederer. Dieser kaufte sich aus dem Verkaufserlös das Anwesen Nr. 61, heute Großaigner Straße 1. Die lange schon gewünschte Schule mit Lehrerwohnung konnte endgültig gebaut werden.
Der Staat wird aktiv
Im Plan der Erstvermessung vom Jahr 1840 ist das Schulhaus eingezeichnet als ein von der Fläche her verhältnismäßig kleines Gebäude, baulich sich anlehnend an das Nachbaranwesen Nr. 23 (Marktstraße 2). Im Westen wie auch südlich zu den Straßen hin waren kleine Gartenflächen vorgelagert. Diese gezeichnete Bausituation entspricht aber keineswegs dem vorhandenen mächtigen Baukörper der sog. „alten Schule“. Im Marktarchiv findet sich jedoch kein Hinweis auf eine spätere Baumaßnahme. Man steht vor einem Rätsel. Erst ein Blick in die Kataster-Umschreibe-Hefte im Staatsarchiv Landshut schuf Klarheit. Am 7. April 1896 kaufte der Staat, nicht mehr der Schulsprengel bzw. die Gemeinde, die zwei anliegenden freien Grundflächen und die nächste Schule konnte nun in den uns sichtbaren Dimensionen gebaut und in Betrieb genommen werden, heute die „alte Schule“.
Am 2. Oktober 1955 wurde der Grundstein zur jetzigen dritten Schule am Ortsrand gelegt und diese am 12. Februar 1957 eingeweiht. Aber erst 1959 schloss das mächtige Haus im Marktzentrum endgültig seine Pforte, und die heutige Schule an der Schulstraße nahm ihren vollen Betrieb auf.
Werner Perlinger
Umrittsprotokolle – ein Zeugnis überörtlicher Prüfungen
+Eschlkam. Wie heutzutage der Bayerische Kommunale Prüfungsverband die Tätigkeit der Kommunen regelmäßig prüft, so geschah dies gründlich auch schon vor Jahrhunderten. Sie nahm der „Rentmeister“ vor. Im 15. Jahrhundert lautete der Titel „Landschreiber“. Unter ihm stand die Gesamtverwaltung der äußeren Ämter und Gerichte als obere Aufsichtsbehörde. Als Inspektionsbeamter seines ganzen Rentamtsbezirkes - für den Hohenbogen-Winkel war es Straubing - hatte er bei den jährlichen „rentmaisterlichen Umbritten“ (Inspektionsreisen) die Prüfberichte über sämtliche ihm unterstellten Pflegsbeamten einzureichen, Untersuchungen über Beschwerden anzustellen, auch persönliche Bitten und Vorstellungen entgegenzunehmen. Die Situation „Umritt“ erinnert an das mittelalterliche Wanderkönigtum. Der jeweilige Herrscher im Reich, ob Kaiser oder König, hatte keinen festen Regierungssitz, sondern er „durchritt“ mit seiner königlich-kaiserlichen Gesellschaft das Reich und sorgte an den einzelnen Pfalzen, wo er jeweils kurze Zeit verblieb, für Recht und Ordnung in der Region.
Und so hat sich auch im Marktarchiv Eschlkam ein Akt über Umrittsprotokolle erhalten. Er beinhaltet „über den Churfürstlichen Marckht Eschlkhamb von annis (Jahren) 1719 bis 1730 und zum thaill ao: 1731“ ausschließlich die Prüfung der von der Marktschreiberei geführten Bücher. Ausgiebig werden darin zunächst die Mängel bei der Führung der Rats- und Verhörsprotokolle von 1719 bis 1733 durch den Marktschreiber aufgezeigt, wie beispielsweise, dass das eine oder andere Ratsprotokoll noch ungebunden vorgelegt worden sei. Vor allem aber wurden Fehler in der Rechtsprechung des Marktgerichts aufgezeigt, erörtert und bei einzelnen Fällen rechtliche Belehrungen erteilt.
So hatte z. B. Hans Georg Peter, Schneider, 1723 zugezogen aus Furth, für die Erlangung des Bürgerrechts und die Ausweisung eines Platzes (wohl für den Hausbau = Nr. 44; nun Kleinaignerstraße 25) 3 Gulden zu bezahlen. Gerügt wurden die mangelnde Begründung für die Hergabe des Platzes und die im Akt fehlenden Grundstückskosten. Gestraft wurde auch der Zimmermann Wolfen Hastreiter, weil er wider des obrigkeitlichen Verbots eine „Ferchen“ (Föhre) gefällt hatte. Bei einer Rauferei hatte der Sattler Martin Neumayr (Haus Nr. 22) dem Andre Fleischmann (Großaigner Straße 15) einen „Daumben=biß“ zugefügt. Geregelt wurde die Bezahlung der dafür in Geld verhängten Strafen. Auch wurde erachtet, dass bei Aufnahme von Tagwerkern und Inwohnern als Bürger die Gebühr von nur zwei bis drei Gulden zu gering sei. Hauptsächlich fürchtete man, dass so „unvermögliche Inwohner, welche gemainiglich mit Kündern versehen seint…“ später im Alter „der Burgerschafft mit der Unterhaltung auf den Hals fallen“ (der Gemeinde zur Last werden).
Geheime Sitzungen verboten
Besonder gerügt wurde von der Kommission, dass bei den amtierenden oder auch Vicebürgermeistern „vill Extra : oder Stubenrhät gehalten worden“ (sog. ortspolitische „Kanapee-Sitzungen“ in Privathäusern). Befohlen wurde, dass sämtliche „Burgerl. Händl“ (Angelegenheiten der Bürger) künftig nur mehr im Rathaus zu behandeln seien und sie „kheine Stuben-Rhat mehr halten sollen“.
In „Commissions auftrag“ hätten Bürgermeister und Rat auch die „Kürchenrechnungen“ aus den Jahren 1719 bis 1733 vorlegen sollen. Der Marktschreiber, der seit jeher wie andernorts auch, zugleich als „Kürchenschreiber“ diese Rechnungen für das Gotteshaus bis zur Säkularisierung der Kirchengüter im Jahre 1803 führte, brachte entschuldigend vor, dass die Rechnungen, verfasst bis zum Jahr 1728, zusammen mit den sog. „Verificationen“ (Belege für Ausgaben) stets an die Regierung in Straubing geschickt worden seien. Seitdem sei von dort keine Rechnung mehr eingefordert worden. Aufgrund dieser erheblichen Mängel konnte auch keine „Zächschrein visitation“ vorgenommen werden. Der „Zechschrein“ war früher eine im Pfarrhof deponierte, besonders bruchsichere Truhe, in welcher der vorhandene Kirchenschatz an Geld, Kleinodien, Urkunden und Bücher verwahrt wurde. Deshalb wurden Bürgermeister und Rat ernstlich ermahnt und aufgefordert, die fehlenden Rechnungen der Jahre 1729 bis 1733 innerhalb von 6 Wochen in „vollkhombenen Stand“ zu setzen und an die Regierung einzuschicken. Letztlich wurde der Marktschreiber aufgefordert, künftig die Kirchenrechnungen sorgfältig abzufassen, ansonsten werde ihm die „Kürchenschreiberey nebst dem Genuß (Verdienst daraus) abgenommen“.
Bei „Erinnerung in geistlichen Sachen“ wurde der Pfarrer Michael Oberschwendter 1730/31 schriftlich erinnert, dass er vier Jahre keine Kirchenrechnung verfasst habe, obwohl der „Kürchenschreiber Georg Andre Aicher (zugleich der Marktschreiber) von den Kürchenpröbsten (Kirchenverwaltung) bezalt worden“ sei.
Die Ratsherren gerügt
Gerügt wurde, dass die „Raths Verwandten“ (die Markträte) an den Sonn- und Feiertagen – ausgenommen an den „höchsten Festtäg“ - während der Gottesdienst seit kurzem nicht mehr „in ihren gehörigen Kürchstüell“ sitzen, sondern sich „ohne Mantl (eigene Tracht für die Ratsherren) unter die Burger mischen“. Dagegen sitzen in den für die Ratsherren vorgesehenen Bankplätzen lauter „Künder und Bueben, über welches die Pfarrkhünder (die Gläubigen) lachen“. Dem Bürgermeister und seinem Rat wurde daher befohlen mit einem guten „Exempl vorzuleichten und an den Sonn: und Feyrtägen in gezihmenter Ehrbarkheit pr. Mantl, und in ihren Stühlen zu erscheinen“…und neben sich weder Kinder noch andere „gemaine Burger zu geduldten“. Ernstlich wurde die Marktführung auch ermahnt, an den „Frauen: und Apostl: dann andern hochen Festtägen“ Tanzveranstaltungen zu untersagen. Geduldet wurde das bisher nur, weil solche Veranstaltungen den „Pier Verschleiß“ förderten. Bei weiteren Zuwiderhandlungen drohe als empfindliche Strafe die Abschaffung des „Preuen und Pierschenkhen“.
Viele uneheliche Kinder
Letztlich zeigte man Verständnis für die Beschwerde, nämlich dass viele Bauern gleich nach der Frühmesse sich in die Wirtshäuser begeben, daher den „hohen Gottesdienst und die Predigt (Hochamt um 9 Uhr) nit anhören, auch in der Fruehe schon sich volltrünkhen“, was die bürgerliche Obrigkeit „der örgernus halber auf kheine Weis gedulten solle“. Beklagt wurde die Zunahme der Unmoral, da viele uneheliche Kinder geboren wurden, woran die Eltern und Hausväter selbst daran schuld seien, weil sie ihre Häuser und Schlafkammern „nicht recht verspöhren, ia woll gar die Ehehalten unverspöhrter nit weith voneinander liegen“. Auch wurde gerügt, dass sie die Eltern „die Kinder und Ehehalten bis in die spate Nacht hinein beim Danz gedulden.“ Da erkannt wurde, dass in der Gemeinde die „Leichtferttigkheit stärkher als in andern Ohrten dieses Rentamtbts in Schwung ist“, wurden der Bürgermeister und der Rat „bey schwerer Verantwortung vor Gott und hoher Obrigkheit“ ermahnt, die diesbezüglich erlassenen Mandate einzuhalten und beispielsweise bei der üblichen „Rauchfang Beschau“ zugleich die Lage der Schlafstätten für die Kinder und Ehehalten zu prüfen; auch das „nächtliche Cammerfenster- und Gäßl gehen“ zu unterbinden.
Bei Durchsicht der Kammerrechnungen (Rechungsbücher der Kämmerei) für die Jahre 1719 bis 1730 wurde von der Umrittskommission die Art der Rechnungsführung genau unter die Lupe genommen; vor allem auf die Führung der Bücher nach Einnahmen und Ausgaben das Augenmerk gelegt. So rügte die Kommission beispielsweise, dass im Jahr 1719 für das verliehene Bürgerrecht an den Metzger Leonhard Regner, der aus Furth auf das Anwesen Marktstraße 2 zugezogen war, nur 3 Gulden verlangt worden waren, den gleichen Betrag aber auch Johann Stroppel (Strobl) zu zahlen hatte, der nur für einen Inman (Inwohner) ohne eigenes Haus als Bürger aufgenommen worden war. Erst im Jahr 1728 erwarb dieser das Anwesen Blumengasse 1 von Barbara Kerscher. Insgesamt aber hielten sich für die einzelnen Jahre die Rügen an der Führung der Kämmerei-Bücher in Grenzen.
Bürgermeister und Rat als Notariat
Auch wurden die Briefprotokolle der Jahre 1719 bis 1731 geprüft. Das Protokoll für diese Zeitspanne zeigte sich „unfolirt und unein gebundten“. Eine Ermahnung an den Marktschreiber folgte. Verschiedene Verbriefungen und Niederschriften über Haus- und Grundstückskäufe wurden beanstandet und dazu rechtliche Belehrungen erteilt. Beispielsweise war im Jahr 1725 der Bürger Johann Hastreiter „auf die Gandt“ gekommen. Mit Einwilligung seiner „Creditoren“ (Gläubiger) wurden das Haus (Marktstraße 7) und weiteres Vermögen an den Bürgersohn Wolfgang Spät „ex officio“ (von Amts wegen) um 440 Gulden verkauft. In diesem Fall wurde hart gerügt, dass „die Laudemia (zu entrichtende Gebühren bei Besitzveränderung) oder Kaufrechten nicht eingebracht oder überschrieben“ wurden. Johann Andre Chorherr, Kufnerssohn, hat nach Wien geheiratet. Hinterfragt wurde, ob er das „landesherrschaftliche Freygelt zum Pfleg Gericht Közting entrichtet“ habe. Die Tatsache „unterstehen sich Burgermaister und Rhat, dem Franzen Schmirl, Burger und Gastgebern (heute Gasthof Penzkofer) ainen Consens zue Verschreibung seiner churfrstl. Erbrechts Gütter umb 300 Gulden anlehen zu ertheilen“ wurde nicht gutgeheißen, „da ansonsten die Creditoren (Gläubiger) Schmirls in eine unverantwortliche Gefahr gerieten“.
Durchgesehen wurden von der Umrittskommission auch die sog. „Inventurbücher“ aus den Jahren 1720 bis 1730. Es war üblich, nach dem Tode eines Bürgers bei Erbstreitigkeiten das gesamte hinterlassene mobile und immobile Vermögen schriftlich aufzunehmen und dann nach rechtlichen Gesichtspunkten unter die Erben zu verteilen. Diese Inventurbücher sind insoweit interessant als sie uns nach Jahrhunderten einen Einblick geben, wie unsere Vorfahren lebten – eine erschöpfend berichtende Quelle über die Wohnkultur unserer Altvordern. Bei dieser Prüfung wurden nur formale Fehler in den Niederschriften beanstandet; aber auch, dass z. B. „der Burgermaister und Rhat, von einer Inventur, und der Verthaillung“ zu hohe Gebühren von den Hinterbliebenen eingefordert hätten. Eine neu aufzustellende „Taxordtnung“ (Gebührensatzung) wurde ernstlich aufgetragen. Letztlich erfolgte noch die Prüfung der sog. Vormundschaftsrechnungen vom Jahr zuvor.
Karge Löhne für die „Nachtwachter“
In diesen Prüfberichten werden 40 Jahre später auch die Einkünfte einzelner Marktbediensteter aufgelistet. Mehrere erhaltene Quittungen dafür sind abgelegt unter dem Titel „Verificationen (Belege, bzw. Beweiszettel) zur Kammer Rechnung für den Churfstl. Gränz Bann Markt Eschlkam pro anno 1771“.
So quittierten im Beisein des „Ehrnvestn, und Wohlweisen Herrn Andreas Meidinger, derzeit Ambtsburgermeister“ am 31. Dezember 1771 die Bürger Johann Sünger und Wolfgang Heislmayr dafür dass sie das ganze Jahr hindurch die „Nachwacht versehen, und die Uhr ausgeruffen den Empfang von 16 Gulden, für jeden 8 Gulden Lohn“. Damals verdiente ein Handwerker (Maurer oder Zimmermann) pro Woche etwa 2 Gulden. Johann Reiser erhielt als Marktdiener für das gleiche Jahr 20 Gulden. Mit eingeschlossen darin waren für ihn 4 Gulden Pfandgeld sowie die umsonst geleisteten Botendienste, ungefähr ½ Meile Wegs (knapp 4 km). Im gleichen Jahr erhielt Franz Anton Schmirl 2 Gulden 28 Kreuzer Reisegeld erstattet, da er als Vertreter der Gemeinde Eschlkam in Kötzting an der Beerdigung des kurfürstlichen Pfleg- und Landgerichtsschreibers Joseph Schultes teilgenommen hatte. Die Petschaft Schmirls im Archivale zeigt einen aufsteigenden Löwen nach links gerichtet. Am 2. März 1774 erhielt Michael Grauvogel, „burgerlicher Chyrurgus“ (damals ein Wundarzt – er praktizierte im ehemaligen Badhaus, Kleinaigner Straße 3) 8 Gulden 48 Kreuzer erstattet für „Pier und Brod“, das er bei „Übergebung“ des Bürgermeisteramtes ausgegeben hatte. Wolfgang Hausladen, Gastgeber (Haus Nr. 21), erhielt am 15. März 2 Gulden 39 Kreuzer für Bier und Brot, was die „Ratsfreunde“ (Markträte), die Viertelmeister (Markträte) und der Ratsdiener verzehrt hatten, als sie in allen Häusern die „Rauchfang Visitation“ (Prüfung der Kamine) vornahmen. Am letzten Tag des Jahres 1774 erhielt der Nachtwächter Andre Fleischmann 2 Gulden „Herbergsgeld“ (Mietzuschuss) ausbezahlt.
Resumee:
Auch damals schon, vor nahezu 300 Jahren, geben die hier erwähnten Protokolle einen direkten und ungeschönten Einblick in die Verhältnisse zwischen den Marktbewohnern und der Obrigkeit. Ausführlich lesen wir von den alltäglichen Problemen, den kleinen Differenzen zwischen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit, auch von denen der Bürger untereinander – Angelegenheiten, die sich in gleicher oder ähnlicher Art und Weise bis in unsere Zeit stets wiederholen.
Werner Perlinger
Bewerbungen um die Marktschreiberstelle im Jahr 1857
+Eschlkam. Eine zentrale und gehobene Stellung in einer Stadt oder einem Markt hatte über die Zeiten hinweg- wie in unserer Reihe schon mehrfach erwähnt - stets der jeweilige Stadt- oder Marktschreiber, der stets eine für das zu bewältigende Amt ausgerichtete, juristisch orientierte Ausbildung genossen hatte. In heutiger Zeit nennen wir ihn den „geschäftsleitenden Beamten“ einer Gemeinde, ob Stadt oder Markt.
Seit dem Jahr 1847 versieht als Marktschreiber Joseph Anton Beutlhauser seinen Dienst. Geheiratet hatte er - wie im letzten Beitrag erörtert - im April 1849 Anna Serve, die Tochter des Glashüttenverwalters von Herzogau bei Waldmüchen. Zehn Jahre nach dem Beginn seiner Tätigkeit in Eschlkam kündigte er unerwartet und ohne Angaben von Gründen der Marktführung sein Amt mit Schreiben vom 8. Juli 1857 auf. Darin heißt es: „Verehrlicher Markts-Magistrat, ich zeige demselben hiermit an, daß ich vom Magistrat Eggenfelden als Marktschreiber gewählt und als solcher durch hohe Entschließung der k(öniglichen) Regierung von Niederbayern de dato am 25. Juni bestätigt worden bin.“ Nachdem er bis zum 20. Juli dort antreten solle, bittet Beutlhauser um die Aushändigung eines Zeugnisses über „meine Geschäftstätigkeit und mein moralisches und politisches Verhalten“ in Eschlkam. Der Bürgermeister, seine Markträte und auch die Bürger waren offenbar sehr überrascht, wenn nicht sogar verärgert. Dennoch billigte man den Abgang des scheidenden Beamten. Wahrscheinlich wollte dieser sich finanziell verbessern, nachdem der Markt Eggenfelden unweit Pfarrkirchen an Einwohnern und vorgegebener Infrastruktur weit vor Eschlkam rangierte. 1902 erhielt diese Kommune den Status einer Stadt.
Als übergeordnete Behörde forderte das Landgericht Kötzting am 21. Juli 1857 Eschlkam auf, dass der somit „erledigte Marktschreiberdienst zur Bewerbung öffentlich (in den öffentlichen Blättern) auszuschreiben ist, indem eine Verleihung ohne diese Ausschreibung unthunlich ist“. Außerdem erhielt die Gemeinde den Auftrag, „wegen Besorgung der currenten (laufenden) Geschäfte ein Provisorium zu treffen“. Dafür war ab 10. August als „Dienstverweser“ für die laufenden Geschäfte der Verwaltung der Marktschreiber Grafenauer aus Neukirchen b. Hl. Blut für monatlich 16 Gulden verpflichtet worden. Am 29. Juli kam die Gemeinde dem Ansuchen nach und informierte künftige Bewerber, dass der Dienst in Eschlkam „mit einem fixen Jahresgehalt von 300 Gulden und freier Wohnung“ verbunden sei. Auch sollten sich nur Bewerber melden, die die ausbildungsmäßigen Voraussetzungen erfüllten.
Ein charakterfester Mann gesucht
Außerdem informierte am 19. August 1857 die Gemeinde hinsichtlich künftiger Gehaltsvorstellungen des Nachfolgers von Beutlhauser, dass u.a. die Witwe des ehemaligen Marktschreibers Franz de Paula Pach, Anna, noch lebe und alljährlich als „Alimentation“ (Rente) 65 f (Gulden) aus der Kasse der Marktkammer beziehe „und hierwegen der künftige Marktschreiber keine Leistung haben soll“. Ergänzend erklärte die Kirchenverwaltung, dass „die Schreibergeschäfte der Kirchenverwaltung nur dann dem künftigen Marktschreiber übertragen werden sollen, wenn sich die Kirchenverwaltung die Überzeugung verschafft hat, daß dieser ein charakterfester Mann sei“.
Obwohl am nordöstlichsten Bereich von Niederbayern liegend, kamen bereits ab Anfang Juli acht Anfragen um die freie Stelle, sogar bis aus Landshut. Gesuche reichten ein: der Advokatenscribent Pongner aus Kötzting; der Skribent (lat. für Schreiber) P. Reindl aus Landshut, der Schulprovisor Michl Meidinger von Schwarzenberg, der Franz Xaver Vötterl aus Straubing, der Landgerichtsskribent Josef Hartl von Kötzting, der Landgerichtsoberschreiber Joseph Reitinger von Mallersdorf und letztlich noch ein Andreas Neumeier, ebenfalls aus Mallersdorf.
Unter den Bewerbern wurde vom Magistrat schließlich Joseph Reitinger ausgewählt. Seine vorgelegten Zeugnisse überzeugten, vor allem aber, dass er in der Lage sei, eine Kaution in Höhe von 1000 Gulden zu leisten. Am 13. Februar 1858 bestätigte die Regierung von Niederbayern mit Sitz in Landshut die vom Magistrat und den Gemeindebevollmächtigten getroffene Wahl. Gebilligt wurden auch die 300 Gulden Jahreslohn aus der Gemeindekasse, die Übernahme der Kosten für die jährlich anfallenden Schreibutensilien, auch eine jährliche Vergütung von 8 Gulden für die Beheizung der Amtslokalitäten (hier das Dienst/Schreibzimmer) sowie die freie Wohnung im Rathause. 1 Gulden von damals entsprach im Wert etwa 13 Euro von heute. Zum gering erscheinenden Gehalt sei erklärt, dass damals die täglichen Bedürfnisse weit weniger kosteten als heute.
Feierlich ins Amt eingeführt
Im Beisein der Magistratsräte und der Gemeindebevollmächtigten wurde am 30. März 1858 der neue Marktschreiber von Eschlkam, Joseph Reitinger, im Rahmen einer kleinen Feierstunde ausführlich über seine Pflichten und auch über sein künftiges dienstliches Verhalten aufgeklärt, wie z. B. amtliches Stillschweigen. Grundsätzlich verboten waren unbefugte Mitteilungen an Parteien, Privatkorrespondenz in Amtssachen, Annahme von Geschenken und unberechtigte Benutzung amtlicher Notizen und Materialien für öffentliche Schriften etc. Vor allem aber musste er versprechen, nicht an geheimen oder dem Staatszwecke zuwiderlaufenden und vom Staate nicht gebilligten Gesellschaften teilzunehmen. Gemeint ist hier z. B. die geheime Gesellschaft der „Freimaurer“. In dieser Hinsicht wurde Reitinger „gehörig belehret“.
Drei Punkte umfasste die zu sprechende Eidesformel wie: Treue dem König, Gehorsam dem Gesetze gegenüber und Beobachtung der Staatsverfassung, wie auch der Schwur, dass er „zu keiner geheimen Gesellschaft oder zu irgend einer Verbindung deren Zweck dem Staate unbekannt, von demselben nicht gebilligt, oder dem Interesse des Staates fremd ist, gehöre, noch je in Zukunft gehören werde so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium“. Nach dem abgeleisteten Eid folgte die Stabung, „daß mir die vorstehenden 3-fachen Verpflichtungen umständlich (hier genau) erörtert und genau vorgetragen wurden, bestätige ich hiermit unter dem feierlichst abgelegten Eide durch eigenhändige Unterschrift“, Jos. Reitinger. Somit war Reitinger im Jahr 1858 der neue Marktschreiber von Eschlkam geworden.
Werner Perlinger
Marktschreiber Beutlhauser erhält die Heiratserlaubnis – der Zöllner Schifferl nicht
+Eschlkam. Vom Mittelalter bis weit in das 19. Jahrhundert hinein gestatteten in Städten und Märkten der Magistrat nur demjenigen die Ehe und damit die Gründung einer Familie, der aufgrund von Vermögen oder Einkommen in der Lage war, eine Familie zu unterhalten. Im 18. und 19. Jahrhundert galt die einfache Lohnarbeit mithin nicht als ausreichende Grundlage für eine Ehe, da meist „der Nahrungsstand nicht gesichert sei“, so die häufig amtlich verwendete Sprachformel bei den Ablehnungen. Ehebeschränkungen führten zu einem Anstieg des Heiratsalters und einer größeren Zahl ledig bleibender Männer und Frauen. Deshalb häuften sich die unehelichen Geburten vor allem in der Schicht der Tagelöhner, Knechte und Mägde. Endlich wurde zum 1. Januar 1876 dank des Reichskanzlers Otto von Bismarck (1871-1890) durch das „Gesetz über die Beurkundung des Personenstands und der Eheschließung“ grundsätzlich die Ehefreiheit eingeführt. Kritik dagegen kam anfänglich aus konservativen und kirchlichen Kreisen. Seitdem führen die Gemeinden, wie die Kirchen bereits seit dem Konzil von Trient ab dem Jahr 1563, die Personenstandsbücher (Geburts-, Ehe-, und Sterbebücher).
Wir schreiben das Jahr 1849: Am 31. März stellt der Marktschreiber von Eschlkam, Joseph Anton Beutlhauser, ein Bittgesuch um „Verehelichungsbewilligung mit der herrschaftlichen Verwalterstochter Anna Serve von Herzogau“ betrff. Dazu muss man auch wissen, dass der Schreiber eines Marktes wie Eschlkam in der Regel die einzige Persönlichkeit war, der die Geschäftsführung im Rathaus oblag (siehe letzten Artikel über Marktschreiber Pach). So war er gerade vom vielseitigen Aufgabenbereich her über die Jahrhunderte in einer Gemeinde mit die wichtigste Person. Heute spricht man vom „geschäftsführenden Beamten“ in einem Rathaus. Aber auch diese Person hatte sich bei Belangen bzw. Anträgen in eigener Sache den jeweils dafür geltenden Vorschriften zu unterwerfen. Beutlhauser stellte deshalb folgendes Gesuch: „Zwei Jahre schon versehe ich den hiesigen Marktschreiberposten und habe während dieser Zeit stets meine aufhabenden Pflichten erfüllt, so daß niemand gegen mich auch nur mit der geringsten Klage auftreten kann. Ich bin gesonnen, da ich weiß, daß ich von dem größerern Theile der hiesigen verehrlichen Bürgerschaft gelitten bin, noch mehrere Jahre, vielleicht für immer nemlich bis zu meinem Tode, hier zu verbleiben. Da ich aber des gegenwärtigen Einsiedlerlebens schon ganz überdrüssig bin, so möchte ich mich verehelichen…“. Damit bat er den Magistrat von Eschlkam um die „Bewilligung der Verehelichung“.
Verehelichung genehmigt
Die Glashüttenverwalterstochter Anna Serve, wie er seine Braut bezeichnete, „hat zwar nicht viel an Vermögen, aber ist gut und christlich erzogen… mein Gehalt ist gar nicht groß, aber genügend, daß eine Familie sich darob bei einiger Einschränkung ernähren kann und so hoffe ich, daß meiner dießfalligen Bitte auf gnädige Willfährde zu Theil werde“, so der bittende Beutlhauser.
Die Gemeindebevollmächtigten „ertheilten die Verehelichungsbewilligung“ mit ihrer persönlichen Unterschrift. In diesem Jahr 1849 waren dies (in Klammern die früheren Hausnummern): Simon Moreth (42), Georg Wenisch (15), Joseph Römisch (68), Franz Rötzer (19), Michl Dachauer (6), Joseph Lemberger (37), Andre Plötz (58), Andre Späth (63 oder 45 ½ = wäre Moosbauer) und Joseph Pfeffer (59 oder 65).
Der Magistrat, bestehend aus dem Bürgermeister Sämmer (44) und den drei Mitgliedern Pfeffer (59 oder 65), Schmirl (41 oder 72) und Pohmann (54), begründete seine Zustimmung wie folgt: „(der) Bittsteller ist seit zwei Jahren dahier als Marktschreiber, erfüllt seine Dienstpflichten genau und pünktlich, das jährliche Gehalt ist so gestellt, daß eine Familie davon sich nähren kann, daher demselben die nachgesuchte Verehelichungsbewilligung ertheilt werden mußte, um so mehr, als auch die Gemeinde und Armenpflege in diese willigt. Magistrat, den 2. April 1849“.
Vier unmündige Kinder
Weniger Glück in seinem Bestreben eine Eheerlaubnis vom Magistrat zu erhalten, hatte dagegen der Witwer J(ohann). B(aptist). Schifferl, von Beruf königlicher Unteraufschläger (Erheber der Akzisen, der indirekten Aufwandssteuern, z.B. einer Biersteuer). Am 21. Juni 1855 schilderte Schifferl, ihm sei im vorigen Jahre seine Frau verstorben und er wolle sich nun mit der Bürgerstochter Magdalena Leitermann aus Rötz verheiraten. Er selbst habe als Unteraufschläger, tätig in Regen, ein Jahresgehalt von 500 Gulden und es wäre ihm lieb, wenn seine Kinder wiederum eine Mutter bekämen, da er als Aufschlagsbeamter selten zu Hause sei. Deshalb bat der Beamte den Magistrat seiner Heimatgemeinde, „daß meinem Gesuch gütigst willfahren werde“.
Interessanter Weise griff der eine Wiederverheiratung doch fördernde Umstand, dass vier unmündige Kinder zu versorgen seien, so möchte man annehmen, beim Marktrat nicht. Vielmehr wiesen die Magistratsräte auf die Tatsache hin, „dass Schifferl als Unteraufschläger nicht in definitiver Eigenschaft (fest) angestellt ist und sich in einem hohen Lebensalter befindet.“ Gerügt wurde auch, dass er keinerlei Privatvermögen besitze, ebenso seine ausersehene Braut aus Rötz. Obwohl er vier unmündige Kinder habe, sei er keinem Unterstützungsverein beigetreten, so dass er später in einer Notlage daraus finanzielle Hilfe hätte erwarten können.
Der eigentliche Hauptgrund für eine Abweisung war – obwohl königlicher Beamter - sicherlich das nicht feste Arbeitsverhältnis in der Zollbehörde. Stets hatte die Marktführung Angst davor möglicher Armut im Markte Vorschub zu leisten. Ob es Schifferl gelungen ist, später doch noch eine Heiratserlaubnis zu besorgen, kündet uns dieser Akt nicht.
Werner Perlinger
Als Franz de Paula Pach sich um die Kirchenschreiberei in Eschlkam bewarb - Vater des bekannten Kunstmalers Alois Bach diente der Gemeinde als Marktschreiber
+Eschlkam. Ein berühmter Sohn des Marktes Eschlkam ist zweifelsohne der Kunstmaler Alois Bach, ein Zeitgenosse und Freund des weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Carl Spitzweg. Bach (1809-1893) gilt als Genre-, Tier- und Landschaftsmaler. Vor allem bekannt wurde Bach durch seine meisterhaften Pferdeporträts aus dem Marstall des Fürsten Thurn und Taxis in Regensburg oder auch des Prinzen Leopold von Bayern. Er wurde am 12. Dezember 1809 in Eschlkam als Sohn des königlich bayerischen Kommunaladministrators (amtlicherseits eingesetzter Gemeindeverwalter, der die Aufgaben des Bürgermeisters zu übernehmen hatte) Franz de Paula Pach geboren. Damals wurde der Name „Bach“ mit >P< geschrieben. In den nächsten Zeilen wollen wir uns dem Vater des Künstlers widmen, als dieser sich als Marktschreiber um die Stelle eines „Kirchenschreibers“ bewarb:
In einem Gesuch vom 21. Juli 1806 stellt Franz de Paula Pach an den „Koeniglichen bairischen Administrations Rath der Kirchen und milden Stiftungen unterthänigst und gehorsamst“ die Bitte ihm als Marktschreiber zusätzlich den Posten der Kirchenschreiberei zu geben. Pach begründet sein Anliegen mit dem Hinweis, sein Vater Wolfgang Andrä Pach sei am 7. Juli verstorben und habe „eine Witwe mit 4 unversorgten Kindern“ hinterlassen. Er der älteste Sohn habe keinerlei Vermögen vom Vater zu erhoffen, „wohl aber habe ich ihm meine gegenwärtige Geistesbildung, insoweit es meine gegenwärtigen Berufsgeschäfte erfordern, einzig zu danken“. Pach informiert weiter, dass er seinem lange Zeit krank gewesenen Vater „in seinen Geschäften Aushilfe“ geleistet habe. Zudem diente er längere Zeit beim Stadtgericht in Deggendorf als Schreiber. Darüber legte Pach ein „Attestat“ vor. Fachlich gut gerüstet erhielt er in seinem Heimatort die Marktschreiberstelle. Da mit diesem Posten bisher stets auch die Kirchenschreiberstelle verbunden war, „so sehe ich mich verpflichtet bei dem Königlichen-Kirchen-Administrationsrath um die allergnädigste Verleihung dieser Kirchenschreiberstelle“ zu bewerben.
Auch wenn diese Aufgabe mit nur einem geringen Gehalt verbunden ist – „allein wenn man bedenkt, daß die Marktschreibens Bedienstung zu Eschlkam 400 Gulden (pro Jahr) abwirft“, so sei es verständlich „zur Befriedigung der Lebensbedingtniße…nach einem Zuschuß zu trachten“. Letztlich bittet Pach, ihm „diese Kirchenschreiberstelle zu Eschlkam in der Eigenschaft wie selbe mein Vater zu genüßen gehabt“, zu verleihen.
Die Antwort des „Königlichen Administrations Rath“ in München erfolgte sehr bald. Bereits am 25. Juli schrieb diese für kirchliche Angelegenheiten in Bayern höchste Stelle an das königliche Rentamt in Kötzting als Unterbehörde, „daß bereits unterm 9. Dezember 1803 (…) auf eintretende Sterbefälle gedachter Kirchenschreiber dieser Platz nicht mehr ersetzt werden sollte“. Zudem wies die Behörde das Rentamt in Kötzting an, die „sohin bezogenen Gratialien und Addition vom heurigen Etatsjahr 1805/06 einzuziehen und dies mit „dem einschlägigen Pfarrer zu besorgen“.
Säkularisation der Kirchengüter
Der Leser wird sich nun fragen wieso damals amtlicherseits mit einer solchen Härte verfahren wurde. Sie erklärt sich aus der Säkularisation der Kirche und ihre Güter im Jahre 1803. Dazu folgendes: Unter den zahlreichen reformerischen Maßnahmen, die der damalige bayerische Innenminister Maximilian Graf von Montgelas (Amtszeit 1799-1817) durchführte, ragte die Säkularisation heraus, das heißt die Beseitigung der staatlichen Herrschaft kirchlicher Würdenträger sowie die Verstaatlichung und Enteignung von Kirchengut – eine für die damalige Kirche schwerwiegende Maßnahme, die seit ihrem Inkrafttreten am meisten der Kritik ausgesetzt war, ja und auch heute noch ist. Vorangegangen waren die Nationalisierung allen Kirchenguts in Frankreich durch die Revolution im Jahr 1789, in Österreich Endes des 18. Jahrhunderts die Aufhebung von allein 700 Klöstern durch Kaiser Joseph II. aus dem Hause Habsburg.
In Bayern erfolgte sie aufgrund eines Reichsgesetzes, nämlich des „Reichsdeputationshauptschlusses“ vom 25. Februar 1803. Im Reichsdeputationshauptschluss wurde festgesetzt, dass die weltlichen Fürsten für ihre linksrheinischen Gebietsverluste an Frankreich abgefunden werden sollten. Dies geschah durch Säkularisation kirchlicher sowie durch Mediatisierung (Auflösung) kleinerer weltlicher Herrschaften bisheriger Reichsstände rechts des Rheins.
Pach ein Opfer der Reform
Bayern wurde gründlich säkularisiert. Viel wertvolles Kulturgut ging dabei leider verloren, geistige Zentren wurden zerstört. Der Staat wollte daraus finanziellen Gewinn ziehen, was aber im Großen und Ganzen gründlich misslang. Bei uns blieb lediglich das Kloster Neukirchen b. Hl. Blut davon verschont, denn es wurde landesweit als sog. „Absterbekloster“ für nun heimatlose Franziskanermönche ausersehen.
Der eigentliche Beweggrund für die Säkularisation bei uns war aber der, dass die Kirche seit Jahrhunderten eigentlich ein Staat im Staate war. So besaßen um 1800 in Bayern die Klöster mehr als die Hälfte des Bodens. 56 % der Bauern zahlten ihre Steuern an kirchliche Einrichtungen. Das wollte man unbedingt abschaffen. An diese Steuergelder wollte man ran.
Im Falle der Kirchenschreiberei in Eschlkam bedeutete dies, dass künftig nur das Rentamt in Kötzting diese Dienste leisten solle. Aber der nunmehrige Marktschreiber Franz de Paula Pach, Vater des oben genannten Kunstmalers, gab nicht auf. Am 2. September schreibt er erneut an die oberste Kirchenverwaltung in München. Die abschlägige Antwort sei für ihn „äußerst niederschlagend“ und er begründet einen erneuten Vorstoß in einzelnen Punkten damit, dass „ein Kirchenschreiber in loco aus nachstehenden Ursachen unumgänglich nothwendig ist“. So zählt Pach auf, die Ortskirche habe viele ausstehende Kapitalien zu verwalten, ebenso die Aufsicht über den vorgegebenen beträchtlichen Zehent, außerdem habe der jeweilige Kirchenprobst (Kirchenpfleger) nie die für die Verwaltung des Kirchengutes nötigen Kenntnisse, ebenso erkenne er nicht die Probleme, die bei „Baufällen“ (Baumaßnahmen) der Kirche entstünden. Pach führt noch weitere persönliche Gründe an, wie dass er zudem für „unversorgte Brüder“ aufkommen müsse, wobei einer sich „in Studiis“ befinde. Doch die Antwort aus München war eindeutig, nämlich dass „der Bittsteller wiederholter abgewiesen werde“. Somit war auch die „Kirchenschreiberei“, in Eschlkam bisher erledigt vom Marktschreiber, für die nächste Zeit beseitigt.
Werner Perlinger
Die Kommunalgebäude - eine Beschreibung aus dem Jahr 1809
+Eschlkam. Die kommunalen Einrichtungen bildeten seit jeher im Markt die Anlaufstelle der Bürger. Hier wurden Anliegen der Bürger angehört und bearbeitet, Entscheidungen über Angelegenheiten des Marktes vom Marktrat getroffen und letztlich auch die Finanzen der Kommune verwaltet. Zentrales Gebäude dafür war und ist auch heute noch das Rathaus. Erhalten hat sich im Archiv ein Bericht über den Zustand dieses Gebäudes und seine Einrichtungen in napoleonischer Zeit, also vor gut 200 Jahren. Es heißt da:
„Das Rathaus ist eingädig gemauert (d.h. nur das Erdgeschoß, darüber der obere Stock als hölzerner Blockbau) und mit einem Dachstuhl von Legschindeln versehen. Zu ebener Erde wohnt der königliche Kommunaladministrator und im oberen Stock ist das „Rathsessionszimmer“ (Sitzungsraum der Markträte) nebst einem Gewölbe zu der Registratur, welch oberes Stockwerk nach mehreren allergnädigsten Kreiskommissariats Entschließungen provisorisch, bis ein Schulhaus hergestellt sein wird, gegenwärtig benützt werden darf; hingegen den schulpflichtigen Gemeinden obliegt, für das Lokal der Schule und Wohnung des Schullehrers zu haften und keineswegs das Kommunalvermögen geschmälert werden darf“. (Grundlage dazu bildete die alle Gemeinden bindende Verordnung des Kurfürsten Max IV. in Bayern vom 23. Dezember 1802, wonach die allgemeine Schulpflicht im Lande zwingend eingeführt wurde). Anbei befindet sich ein kleiner Stadel und (eine) Stallung nebst einem sehr kleinen Höfl“. Der Wert dieses öffentlichen Gebäudes wurde mit 800 Gulden bewertet.
Das Markt, oder Amtsdienerhaus (früher Nr. 62): Dieses ist durchaus gezimmert (Waldlerhaus) und mit einer sehr kleinen Stallung und Scheune versehen samt den dabei befindlichen Haus- und Wurzgärtchen ad (zu) 1/16 Tagwerk. Die Anlage wurde mit 100 Gulden bewertet.
(Die) „Fleischbank, und Brodhaus“: (Die Einrichtungen) liegen zwischen dem Rathaus (Nr. 33) und des Wolfgang Stauber(s) Uhrmacherwohnung (Nr. 22); ist gemauert mit 2 Fleischbänken und mit einer Dachung von Legschindeln versehen. An Pachtschilling zahlen die Metzger im Jahr 9 Gulden; die Bäcker vom Brothaus 4 Gulden. Diese Einrichtungen wurden auch mit 100 Gulden bewertet.
Das „Hirtenhaus (Nr. 49-auch Armenhaus) ist gezimmert und hat auch ein sehr kleines Hausgärtchen ad 1/16 Tagwerk“; insgesamt geschätzt auf 150 Gulden.
Als Gesamtwert errechnet sich der Wert allein der kommunalen Gebäude in Eschlkam auf 1050 Gulden.
Unter den sog. „Dienstwiesen“ (für den Unterhalt gegeben an die Marktbediensteten) sind aufgeführt ein „Wiesel, zweimähdig beim Oelbrunn, benutzt solches der Schullehrer und ist ½ Tagwerk groß“, geschätzt auf 35 Gulden. „Ein Wiesel in der Paint (Point) wird auch vom Schullehrer benützt, nur ¼ Tagwerk haltig“, Wert 15 Gulden
Letztendlich erwähnt ist die „Nutzwiese des Wasenmeisters“, gelegen am Chambfluss, ebenfalls nur ¼ Tagwerk groß; Wert 15 Gulden. Der Wasenmeister übte den Beruf des Abdeckers aus. Er beseitigte die „gefallenen“ (zu Tode gekommenen) Haustiere indem er sie weit ab von der nächsten Siedlung begrub.
Die Endabrechnung ergab schließlich für den immobilen Besitz der Gemeinde den Betrag von 1115 Gulden. In dieser Zeit kostete ein Schaff (Scheffel zu 222 Liter) Korn 20 Gulden, die gleiche Menge Weizen 24 Gulden, ein Kalb 7 Gulden. Der Tageslohn für einen Zimmermann betrug ca. 20 Kreuzer (60 Kreuzer ein Gulden).
Mit zu den wichtigsten Tätigkeiten der Marktverwaltung gehörte die notarielle Beurkundung von Hausübergaben, niedergeschrieben und somit der Nachwelt erhalten geblieben in sog. Briefprotokollen. Ein Beispiel sei angeführt:
Übergabe eines „Burger Heusl“
Am 7. Januar 1722 traf Maria, Witwe des ehemaligen Müllers und Ratsherrn Johann Lärnbecher von der „Bäckermühle“ eine notarielle Verfügung. „Auf geleisteten Beistand“ durch den Ratsherrn Georg Denzl übergibt sie ihrer Tochter Maria das „bisher ruhig ingehabt, genuzt und genossene Burgers Heusl am Schloßgraben, gleich neben dem Markhts Rhathaus entlegen“. Von der Lagebeschreibung her war es das jetzige Anwesen „Textilwaren Brey“, Waldschmidtplatz 1. Sie hatte dieses kleine Anwesen am 4. Februar 1707 „durch Kauf an sich gebracht“. Der Schätzwert von nur 35 Gulden erscheint gering, auch wenn es sich nur um ein „Heusl“ handelte. Jedoch war mit der Übergabe eine wichtige Bedingung verknüpft dergestalt, dass die neue Eigentümerin, hier die leibliche Tochter, ihre Mutter als die Übergeberin, ob gesund oder und krank, „mit aller Notdurft versehe, sie nach ihren Absterben christcatholischen Gebrauch nach zur Erden bestattigen lassen wolle und solle“. Zeugen dieses Vertrages waren der Schuhmacher Hans Hastreiter und der „Peck“ Hans Vogl, „beede Burger alhier“. Diese Vereinbarungen stellen einen frühen Modus einer sog. >Leibrente< dar. Die Müllerswitwe wollte sich mit dieser so getroffenen Vereinbarung bis zum Lebensende absichern.
Werner Perlinger
Die Polizeibehörde – einiges aus ihrem Aufgabenbereich im 19. Jahrhundert
+Eschlkam. Im Bereich des Marktes und der bürgerlichen Gründe besaß der Marktrat auch die Polizeihoheit. Daher hatte er stets energisch gegen Trunkenbolde, Spieler und auch gegen Personen vorzugehen, die es mit der Moral nicht genau nahmen. Es sei ein besonderer Fall erörtert, der vor 180 Jahren seine Kreise bis in die Landeshauptstadt München zog.
Eschlkam, gelegen an der „Kommercialstraße“ (Handelsstraße) nach Klattau, war von 1834 bis 1854 deshalb Sitz eines Hauptzollamtes und damit lebten Zollbeamte im Markt und verrichteten ihren Dienst. So waren im Jahr 1842 die Marktbehörde und das Landgericht Kötzting mit einer Hauptzollamtsassistentsgattin namens Anna Dörr in strafrechtlicher Hinsicht beschäftigt. Diese Frau hatte zwei Jahre zuvor, 1840, den Vorgesetzten ihres Mannes, den Zolloberkontrolleur von Eschlkam, Joseph Dürr, als dieser an ihrer Wohnung vorbeiging, vom offenen Fenster herab übel beschimpft und ihn einen „schlechten Kerl und Spitzbuben“ geheißen. Es kam zur Anzeige und die Dörr erhielt wegen dieser Beschimpfung „24 stündigen Arrest, welche Strafe dieselbe auch schon erstanden (abgesessen) hat“. Wahrscheinlich wurde sie einen Tag im Rathaus in einer eigens dafür geschaffenen Arrestzelle „verwahrt“. Dies erklärt, warum die Dörr Jahre später, auch wegen gemachter Schulden, amtlich als eine Person mit „zweifelhaften Ruf“ angesehen wurde. Bei dem an und für sich noch geringfügigen Vergehen der Beleidigung blieb es aber nicht.
Deshalb sei ein pikanter Fall geschildert, den Jahre später die Marktführung zu bearbeiten hatte: Es handelte sich um den „verdächtigen Umgang des Sebastian Würz von Eschlkam mit der Hauptzollamtsassistentengattin Doerr von da“. Unter dem Titel „Mießiggang“ betreff. brachte die ansässige Gendarmeriestation am 14. Juli 1847 bei der Marktbehörde zur Anzeige, dass der ledige Totengräbersohn Sebastian Würz, dienst- und beschäftigungslos, sich bei seinen mittellosen Eltern aufhalte und „sich mit der nicht im besten Rufe stehenden Zollamtsassistentengattin Anna Dörr auf eine bereits auffallende Art herumtreibt.“ Allein schon aus der Sorge für arbeitsscheue Personen später einmal aufkommen zu müssen, handelte die Marktbehörde unter Bürgermeister Anton Sämmer sofort und lud den Sebastian Würz am 17. Juli vor.
Keinen „Umgang“ gehabt
Dieser aber brachte zu seiner Entlastung hinsichtlich des vorgeworfenen Müßiggangs vor, dass er „durch Uhrrichten, Musik, Malen einen schönen Verdienst habe und sich dadurch hinlänglich ernähren könne“. Bezüglich des „Umgangs mit der Anna Dörr“ betonte er, „daß ich mit dieser Person keinen Umgang habe“, sondern seine Besuche in der Wohnung nur dem Beamten Dörr gelten würden. Er sei diesem besonders „verbindlich, weil er mir versprochen, daß er für mich Sorge tragen werde und er mich in einer Kanzlei als Schreiber oder sonst wie unterbringen will“.
Der Marktrat ließ sich jedoch nicht beirren und schenkte seinen Ausführungen bezüglich seines Verhältnisses zu der Frau Dörr keinen Glauben. Die Ratsherren verfügten, dass Würz „bei Vermeidung der Ausschaffung (hier Ausweisung) aus dem Markt Eschlkam den Umgang mit dieser Frau aufgebe“. Das Gremium beließ es mit dieser eindringlichen Warnung und belegte Würz lediglich mit einem „Verweis“. Als relevanter Grund wurde angegeben: „Es ist aber auch notorisch (hier: offenkundig), daß er mit der Anna Dörr einen vertrauten Umgang gepflegt hat“. Deshalb wurde ihm unter Berufung auf einschlägige gesetzliche Vorgaben, stammend noch vom 21. Januar 1763 und 7. November 1787 „der Umgang mit dieser Person untersagt und verboten“. Zur verhängten Strafe gehörte auch die Auflage die „Protokolltaxe“ des Marktes in Höhe von 36 Kreuzer und 17 Kreuzer als „Anzeigengebühr“ für die Gendarmerie zu entrichten. Zur Sache nicht vernommen wurde der offenbar doch „gehörnte Beamte“, wie wir sehen werden.
Musisch begabt
Dagegen wurde für Würz positiv erkannt, dass er mit „Musikmachen, Malen, Uhrrichten und sehr viele mechanische Arbeiten, worauf er sich gut versteht, einen schönen Verdienst hat“ und er somit seinem alten Vater nicht zur Last falle. Die Totengräberfamilie Würz wohnte damals am Friedhofseingang unmittelbar neben dem Kobel in Anwesen Nr. 29. Heute befinden sich dort die WC-Anlagen für die Kirch- und Friedhofsbesucher.
Zum Schluss wurde der Totengräbersohn noch belehrt, er könne gegen diesen Entscheid bei der königlichen Regierung von Niederbayern, Kammer des Innern, innerhalb von acht Tagen Berufung einlegen. Diese Möglichkeit nutzte Würz sicher nicht, denn am 24. August 1847 stellte ihm der Marktrat ein sehr positives Leumundszeugnis aus. Beantragt hatte er dieses, da er sich um eine „Thurnerstelle“ (als Türmer) bewarb. Es wurde bezeugt, „daß er während seines ununterbrochenen Hierseins sich immer mit Musik beschäftigte und als erster Violinspieler auf dem hiesigen Kirchenchor bedienstet war; auch pflege er eine gute Aufführung“. Ob sein beruflicher Wunsch in Erfüllung ging, kann nicht gesagt werden. Laut Aussage eines Kopulationsattests (Heiratsurkunde) vom 3. Oktober 1857 hatte Würz gut zehn Jahre später die Tochter des Bräumeisters vom Kommunebrauhaus, Katharina Stauber. Soviel vorerst abschließend zur Person des musikalisch begabten Totengräbersohnes.
Interessant für den Leser ist der weitere Verlauf der Angelegenheit, die Person Anna Dörr betreffend:
Am 27. Juli 1847 erfahren wir, dass der Ehemann Franz Seraph Dörr genau an dem Tag, als die Vernehmung des Würz stattfand, am 17. Juli verstorben ist. Da dieser, so die Akte, „nicht definitiv“ angestellt war, hatte die Witwe keinen Anspruch auf eine Pension. „Zum Behufe der Erlangung eines Gnadengehalts von der königlichen Generalzolldienstadministration“ erbat nun die Witwe Dörr von der Marktführung ein Leumundszeugnis, was sie auch erhielt.
Im Attestatenbuch (eigentlich ein Kopularbuch mit Abschriften von ausgestellten Urkunden) von 1846/47 findet sich im Marktarchiv abschriftlich das Zeugnis. Demnach attestierte die Marktbehörde am 27. Juli 1847, „daß sie sich durch ihr Betragen, welches sie seit einigen Jahren an den Tag legte, nicht das beste Lob erwarb, daß sie schon einige Male polizeilich abgestraft wurde und namentlich auch nach höchsten Erkenntnissen der K(öniglichen) Regierung von Niederbayern, Kammer des Innern, vom 8. Mai vorigen Jahres wegen verschiedener Angelegenheiten in Untersuchung war, deswegen gestraft und ihr Name öffentlich bekannt gemacht wurde. Übrigens steht sie auch wegen leichtfertiger Schuldenmacherei in üblen Rufe“.
Mit diesem Inhalt verständlicherweise äußerst unzufrieden, „kam sie im größten Sturm auf das Rathaus, schimpfte arg. Dessen nicht genug, besuchte sie den Bürgermeister in seiner Wohnung und warf dort das Zeugnis - zerrissen in mehrere Stücke – diesem vor die Füße“. Daraufhin beschlossen der Bürgermeister Sämmer und sein Marktrat, die Dörr, „da sie wegen leichtsinniger Schuldenmacherei im üblen Ruf stehe, und weil sie sich öfters gegen den Magistrat Rohheiten erlaubte, sich binnen drei Tagen aus dem Markt zu entfernen“.
Der Bürgermeister und seine Markträte hatten wohl Angst vor diesem Weibe, denn am 31. Juli baten sie die hiesige Gendarmeriestation um Hilfe bei der „Ablieferung in ihren Heimatorth Amberg, da diese als gefährliche Person bekannt ist und sich daher bei der Arretierung durch einen Landwehrmann voraussichtlich widersetzen würde“. Der Landrichter in Kötzting lehnte das Gesuch um „Gendarmerie Assistenz“(Hilfe) mit dem Hinweis ab, dass „der Magistrat mit dem nöthigen Polizei Dienstpersonal selbst versehen ist“. Vielmehr missbilligte die vorgesetzte Behörde das Abschiebeverfahren gegen die Dörr, da seit dem Tode ihres Mannes erst wenige Wochen verflossen seien und die Dörr „nach eigener Versicherung ohnedies demnächst Eschlkam verlassen wird“, so dass eine „Zwangseinschreitung durch Ablieferung“ sich erübrige.
Eine Urkundenfälschung?
Wenig später jedoch muss die Ausweisung aus Eschlkam erfolgt sein, denn vier Wochen später, am 1. September 1847, wandte sich die königliche Polizeidirektion der Haupt- und Residenzstadt München an die Marktbehörde, die Dörr befinde sich derzeit in München und habe ein Führungszeugnis übergeben, worin der Markt Eschlkam ihr „ein Zeugniß über ausgezeichnet gute Aufführung“ ausgestellt habe. Um die Echtheit des Führungszeugnisses prüfen zu können, bat die Direktion die Gemeinde ihr ausgestelltes Zeugnis „gütigst übersenden zu wollen“. Die Angelegenheit zog sich über Jahre weiter hin. So wird am 10. September 1857 geschildert, dass obiger Sebastian Würz und Simon Spät von Eschlkam für den 3. November 1854 zu einer Schwurgerichtsverhandlung in München vorgeladen wurden. Beide reisten daher bereits am 27. Oktober um 5 Uhr früh ab um München rechtzeitig zu erreichen. Wenige Stunden später, um 8 Uhr, erreichte den Markt die Nachricht, dass die Verhandlung auf den 9. November vertagt worden sei. Es war daher für die Marktbehörde „unumgänglich nothwenig“, einen Boten eilends nachzuschicken, um die Prozessbeteiligten von der Terminänderung zu benachrichtigen. Daraufhin wurde dem Würz und dem Späth ein „Zeugnis ausgefertigt, daß sie die Reise bis Straubing und zurück umsonst gemacht haben“, so der Bericht an das Landgericht in Kötzting. Über den weiteren Verlauf und den Ausgang dieser gerade für die Anna Dörr schwierigen prozessualen Situation in München fehlen die archivischen Unterlagen. Jedenfalls wird die Dörr eine ihr zustehende Strafe erhalten haben.
Werner Perlinger
Vor 140 Jahren für treue und gute Arbeit im öffentlichen Dienst belohnt
+Eschlkam. „Die Verleihung einer allerhöchsten Auszeichnung an Gemeindediener Franz Pinzinger in Eschlkam“, so beginnt ein Schreiben, datiert vom 26. Juli 1880, des damaligen kgl. Bezirksamtmanns Möhrl (heute wäre das der Landrat) vom Landgericht Kötzting an den Herrn Bürgermeister von Eschlkam. „Seine Majestät der König (damals Ludwig II.) haben laut höchster Entschließung des kgl. Staatsministeriums des Innern am 21. Juli geruht, dem Gemeindediener Franz Pinzinger zu Eschlkam in allerhuldvollster Berücksichtigung der von demselben der Marktsgemeinde Eschlkam seit fünfzig Jahren mit Treue und Eifer geleisteten Dienste die Ehrenmünze des Ludwigsordens allergnädigst zu verleihen.“ Diese Ehrenmünze war für Personen niederen Ranges bestimmt, die zum Zeitpunkt der Stiftung ihr 50-jähriges Dienstjubiläum bereits erreicht hatten. Dieser Umstand traf für Pinzinger zu.
Zugleich wurde die Marktführung beauftragt, „Veranstaltung zu treffen, daß die Aushändigung der Ehrenmünze in würdiger und feierlicher Weise stattfinden kann. Ich werde zu diesem Zwecke am Samstag, den 31. des l(aufenden) Monats nachmittags 3 Uhr in Eschlkam eintreffen, um dem Jubilar eigenhändig im Namen und Auftrage seiner Majestät, unseres allergnädigsten Königs, die ihm allerhuldvollst verliehene Auszeichnung an die Brust zu heften.“ Über diesen Akt musste der Bürgermeister „den Vorstand der Pfarrei, sowie die Mitglieder der gemeindlichen Collegien und die Bürgerschaft selbst geeignet informieren“, so die strikte Anweisung des Bezirksamtmanns.
Viele Ehrengäste
Erhalten dazu ist im Marktarchiv eine Niederschrift über den Hergang des für den Gemeindiener Pinzinger eigens abgehaltenen Festaktes. So wurde im „hiesigen Rathhaussaale“ im Beisein vieler Ehrengäste das Ehrenzeichen, die „Ehrenmünze des Ludwigsordens“ dem Franz Pinzinger „an die Brust geheftet und ihm das Brevet (Urkunde der Verleihung) über die Ordensverleihung ausgehändigt“, da er in der „Marktgemeinde Eschlkam seit fünfzig Jahren mit Treue und Eifer“ die Aufgaben als Marktdiener versehen hatte. Der Ehrung wohnten bei der damalige Ortspfarrer Johann Baptist Braun (er stand der Pfarrei von 1877-1897 vor), Bürgermeister Franz Pfeffer („Hoamater“ von Waldschmidtstraße 8), der Gemeindeausschuss, die „Gendarmeriemannschaft von hier“, dann die „Grenzwachmannschaft von Großaign, die Herren Lehrer der Pfarrei Eschlkam sowie eine große Anzahl an Bürgern und Angehörigen des Marktes Eschlkam und der benachbarten Gemeinden“.
„Nach einer feierlichen Ansprache an den Jubilar und die Versammelten wurde die Feierlichkeit beendet mit einem dreifachen Hoch auf seine Majestät unseren allergnädigsten König“, so der im nüchternen Stile der damaligen Amtssprache verfasste Bericht über die große Feier für Franz Pinzinger, wo dieser wohl das erste Mal in seinem Leben öffentlich ganz im Mittelpunkte stand.
Dem Bruder nachgefolgt
Interessant ist es zu erfahren wie Pinzinger 50 Jahre zuvor in dieses Amt gekommen ist. Erhalten dazu hat sich in Abschrift ein Protokoll vom 11. Juni 1830. Es informiert, dass „der den 20. August 1825 auf Ableben seines Vaters als Magistratsdiener aufgenommene Baptist Pinzinger bereits vor 8 Tagen verstorben ist“. Wenige Tage später bat die Mutter die Marktführung, allein schon ihrer sieben unmündigen Kinder wegen, nun den Bruder des Baptist, Franz, dieses Amt zu verleihen. Der damalige Bürgermeister Schreiner („Hoamater“ von Marktstraße 11) und seine Markträte kamen - allein schon um einen Sozialfall in der Gemeinde zu vermeiden - der inständigen Bitte gerne nach und übertrugen die so plötzlich freigewordene Stelle an den späteren Jubilar, damals erst 2o Jahre alt.
100 Gulden Jahresgehalt
Franz Pinzinger erhielt als Marktdiener 100 Gulden Jahresgehalt bei freier Wohnung im Marktdienerhäusl, Großaignerstraße 5. Mit diesem Geld musste er aber auch seine Mutter mit den „minderjährigen Geschwistern“ versorgen, für den jungen Pinzinger gewiss keine leichte Aufgabe. Und so wurde er am 11. Juni 1830 in die Pflicht genommen.
Die zu bewältigenden Aufgaben eines Gemeinde- oder Marktdieners waren vielfältig. So musste dieser in der Gemeinde die Ausführung der gegenüber der Bürgerschaft jeweils erlassenen Gesetze und Anordnungen der Verwaltung überwachen. Dazu gehörte auch die mündliche Verbreitung amtlicher Bekanntmachungen sowie bei jedem Wetter die Überbringung von amtlichen Schreiben oder sonstigen Verwaltungsschriftstücken zu den Bürgern. Ein Gemeindediener führte in der Regel eine Glocke oder Schelle mit sich, um bei den Bekanntmachungen und Ausrufen vorher auf sich aufmerksam zu machen. Gerade und allein schon wegen dieser vielerlei Funktionen war der Gemeindediener allerorten eine allgemein anerkannte Persönlichkeit.
Das Markt-, oder Amtsdienerhaus in Eschlkam war im Jahr 1809 „durchaus gezimmert (Waldlerhaus) und mit einer sehr kleinen Stallung und Scheune versehen samt den dabei befindlichen Haus- und Wurzgärtchen ad (zu) 1/16 Tagwerk“. Die Anlage war damals mit 100 Gulden bewertet. 1848 bereits wollte die Gemeinde das mittlerweile marode gewordene Haus versteigern. Es fand sich aber kein Käufer. Der jeweilige Marktdiener und seine Familie mussten mit dem alten und räumlich sehr beengten Bau weiterhin vorlieb nehmen.
Werner Perlinger
War ein Giftanschlag gegen den Pfarrer geplant?
+Eschlkam. Wir befinden uns in der Mitte des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahr 1853. Im Pfarrhof und auch in der Gemeinde herrscht im September große Aufregung. War ein Attentat gegen den geistlichen Herrn geplant, fragen sich die Marktbürger. Und es erfährt der hochlöbliche Magistrat, dass auf einer Wiese, die als „Widum“ zum Ökonomiepfarrhof gehörte und so der damals amtierende Pfarrer Karl Pittinger nutzen durfte, über das Gras, das täglich zum Füttern gemäht wird, das Pulver Arsen ausgestreut worden sei. Der Begriff „Widum“ bedeutet Witwengabe, oder wie in unserem Fall die Pfarrpfründe insgesamt, in Eschlkam der Haus- und Grundbesitz für den Unterhalt des jeweiligen Pfarrherrn.
Doch zurück zum Arsen. Dieser Stoff in Pulverform galt gerade im 19. und noch im 20. Jahrhundert bis in unsere Zeit herein als ein beliebtes Mittel für einen hinterhältig geplanten Mordanschlag mittels Gift. Noch dazu war das Arsen damals sehr leicht zu beschaffen. Auslöser dieser schwerwiegenden Vermutung war, dass ein großer Teil der besagten Wiese sich dem Betrachter durchgehend mit einem feinen weißen Staub bedeckt zeigte, daneben ebenso betroffen auch ein „großer Fleck“, der nicht zu landwirtschaftlichen Gründen der Pfarrei zählte. Die Begutachter der Wiese, das waren Pfarrer Pittinger und Vertreter des Magistrats, glaubten am 9. September, in dem Staub auf dem Gras das Gift Arsen zu erkennen.
Höhere Behörde eingeschaltet
Davon erfuhr einige Tage später das Landgericht Kötzting als höchste justizielle Behörde für den Bereich Hohenbogen-Winkel. Sofort erging der Befehl, das bestaubte Gras abzuschneiden und Proben davon an die Behörde zur weiteren fachlich kriminologisch ausgerichteten Untersuchung zu senden. Damit betreten wir den Bereich der Forensik - das Gebiet für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden, denn Arsen war im 19. Jahrhundert als ein gerne benütztes Mordgift berüchtigt. Jahrhundertelang ließ sich Arsen chemisch nicht nachweisen. Noch um 1840 waren 90 bis 95 Prozent aller Giftmorde auf den Einsatz dieses Giftes zurückzuführen. Dazu nur ein Beispiel aus der Nachbarstadt Furth:
Am 7. Dezember 1835 wurde Kunigunde Korherr, Binderswitwe aus Furth, wegen eines Verbrechens des Giftmordes in Cham auf der „Köpfstatt“ im Bereich des heutigen Galgenberges „mit einem einzigen zweckmäßig geführten Hieb“ mit dem Schwert von dem aus Straubing beigezogenen Scharfrichter Joseph Zangl hingerichtet. Ihr Verbrechen war, dass sie ihren Schwiegersohn Andreas Oberberger, mit dem sie häufig im Streit lag, am Ostersonntag, den 19. April des gleichen Jahres mit Arsen vorsätzlich ermordet hatte.
Allein von dem damaligen Wissen um einzelne Arsenmorde, die in dieser Zeit hin und wieder vorkamen, ist die Angst und Sorge Pfarrer Karl Pittingers zu verstehen. Ein arglistiger Feind plane, so vermutete er, zumindest das Futtergras für das Vieh seiner Pfarrökonomie zu vergiften. Pittinger wusste auch, dass er in der Pfarrei - er stand ihr von 1843-1859 vor - aufgrund seines manchmal sehr angespannten Verhältnisses mit dem Marktrat nicht nur Freunde hatte.
Behördliche Anweisungen erteilt
Der Amtsarzt des Landgerichts Kötzting, Dr. Müller, gab nun am 14. September die strikte Anweisung vorerst Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. So sei das mit dem weißen Staub bedeckte Gelände gründlich umzugraben, ein Stangenzaun herum zu errichten und Warnzeichen aufzustellen. Zugleich wurde angeordnet, in dieser Sache das Personal des Ökonomiepfarrhofes zu vernehmen. Befragt wurden der Großknecht Peter Obermeyer, die Großdirn Theres Kiefl und die Pfarrersköchin Barbara Adam. Ihre Aussagen überliefert uns der Akt jedoch nicht.
Einige Tage verstrichen und am 23. September konnte nach eingehender chemischer Untersuchung der eingeschickten Substanz der Königliche Landrichter Kraus an den Magistrat von Eschlkam entwarnend berichten, dass auf die der Widumswiese benachbarten Grasfläche lediglich fein gemahlener Kalk zur Düngung ausgestreut worden sei und nicht das gefürchtete Gift Arsen. Offenbar hatte der Wind den pulverisierten Kalk auf die Wiese des Pfarrers geweht. Kalk ist nicht nur ein wichtiger Pflanzennährstoff, sondern auch ein unverzichtbarer Bodendünger, was viele Bauern im Hohenbogen-Winkel damals wahrscheinlich noch nicht wussten.
Dem Pfarrer Pittinger und auch den anderen damit befassten Personen dürfte ein großer Stein vom Herzen gefallen sein. Trotzdem: man hätte nur den angrenzenden Nachbar als den wohl eigentlichen Verursacher fragen müssen, und es hätte die ganze Aufregung und die geschilderten Abläufe erst gar nicht gebraucht.
Werner Perlinger
Eine Lateinschule für Eschlkam?
+Wir schreiben das Jahr 1829. Da erreichte am 30. Mai 1829 den Markt ein Schreiben der Regierung des Unterdonaukreises mit der Anfrage, ob es möglich wäre im Markt eine Lateinschule zu errichten. Lateinschule (lateinische Schule), seit dem ausgehenden Mittelalter jede gelehrte Schule, deren Hauptlehrfach und Unterrichtssprache das Lateinische war. Bis zur Säkularisation im Jahre 1803 fanden sich in Bayern diese Schulen hauptsächlich in den zahlreichen Klöstern. Als diese aufgelöst waren wurde der Mangel solcher Einrichtungen allzu offenkundig. Die Stadt Cham besaß seit dem 16. Jahrhunderte eine Lateinschule. Auch in Neukirchen b. Hl. Blut existierte im Franziskanerkloster eine solche Anstalt hauptsächlich als Vorbereitungseinrichtung für einen folgenden Gymnasialbesuch. Es war König Ludwig I. - er regierte von 1825-1848 - der nicht nur manche seit 1803 säkularisierten Klöster wieder reaktivierte, wie z. B. in den Jahren 1830 Metten und 1838 das wittelsbachische Hauskloster Scheyern, sondern auch die Entstehung von Lehranstalten wie die Lateinschulen auf breiter Ebene förderte.
Es war der 30. Mai 1829, da erreichte vom Landgericht Kötzting aus den Markt ein Rundschreiben der Regierung des Unterdonaukreises, ausgestellt in Passau, ob in diesem Fall in Eschlkam eine lateinische Schule von drei, zwei oder wenigstens einem Kurse errichtet und fundiert werden könne. Dafür habe die damit zu beglückende Gemeinde ein „angemessenes Lokal hierfür auszuwählen sowie die Mittel, wodurch der Gehalt der Lehrer und die nothwendigen Kosten auf Unterhaltung des Gebäudes“, sicher bereit zu stellen. Außerdem habe der Magistrat über die Vorteile zu informieren, die eine solche Einrichtung gerade auch in einer kleineren Marktgemeinde für die Bürger mit sich bringe. Unterschrieben hat diesen Rundbrief der Regierung der (Staats)sekretär Sartorius.
Die Eschlkamer Bevölkerung wurde über diese Pläne der Regierung informiert und bereits am 11. Juli verfasste der Marktschreiber ein zur Sache ausführliches Protokoll. Es ist „aufgenommen worden in Versammlung der gesamten Bürgerschaft des Marktes Eschelkam bey Ablesung des erschienen neuen Studienplanes lediglich wegen Errichtung lateinischer Schulen in Städten und Märkten“. Vom Gemeinderat waren anwesend: Bürgermeister Schmirl und die Markträte Michael Kaufmann, Anton Riederer, Georg Schreiner und als Marktschreiber Wolfgang Pach. Hinsichtlich der auf den Markt zukommenden Kosten, sollte sich eine solche Bildungseinrichtung etablieren, wurden die Bürger ausführlich unterrichtet.
Der erste Punkt der Stellungnahme lautet: „Allein, wiewohl der Nutzen und Vortheil in mehrfacher Beziehung darin zu ersehen ist, so kann man hierorts dennoch nicht sofort den Gebrauch machen eine lateinische Schule zu errichten, weil es hiesigen aus 78 Häusern bestehenden Marktes an (dafür) nachzuweisenden Mitteln gebricht und an und für sich schon zu unkräftig und schwach ist“ (wirtschaftlich einfach unmöglich eine solche Einrichtung zu finanzieren). Dieses Protokoll unterzeichneten eigenhändig folgende Bürger: Joseph Weber, Joseph Schneider, Michael Maidinger, Joseph Pfeffer, Ignatz Koller, Joseph Römisch, Wolfgang Korher, Joseph Fleischmann, Jakob Fischer, Franz Leuthermann und Joseph Scheppel.
Am gleichen Tag noch, den 11. Juli, schickte der Marktmagistrat von Eschlkam an das Landgericht Kötzting die sich wiederholende protokollarische Erklärung „mit dem Anfügen, dass man hierorts zu unkräftig und schwach ist, eine solche (gemeint ist die Lateinschule) errichten zu können“.
Dazu sei angemerkt, dass der Markt erst einige Jahre zuvor, das „Metzger-Florehaus“ (Nr. 24 - heute Waldschmidtstraße 1) angekauft und es zum ersten regulären Schulhaus eingerichtet hatte. Eine neue Einrichtung wie eine Lateinschule hätte andererseits aber für den Markt als zentral gelegener Ort im Hohenbogen-Winkel eine erhebliche Aufwertung bedeutet. Allein die Möglichkeit scheiterte daran, dass die mit dieser weiteren Schuleinrichtung entstehende zwangsläufig neue ökonomische Situation den Markt und seine Bürger schlicht überfordert hätte.
Eigentlich tat sich in solchen Angelegenheiten der damalige Staat leicht. Ohne entsprechende finanzielle Hilfen in Form von geeigneten Zuschüssen animiert er Städte und Märkte wegen der bildungspolitischen Folgen, entstanden durch die Aufhebung der Klöster ab dem Jahr 1803, die Bildung im Lande zu forcieren und anzuheben. Andererseits sei festgestellt, dass der damalige bayerische Staathaushalt stets in Engpässen verharrte, da neben den vielen allgemein zu erledigenden Aufgaben die vom König ohne Rücksichtnahme auf die Belange der Bevölkerung initiierten Prachtbauten in der Landeshauptstadt und nicht zuletzt die meist aufwendige Hofhaltung der wittelsbachischen Regenten das vorgegebene Haushaltbudget stets gar arg belasteten.
Werner Perlinger
Als der Zollbeamte Adalbert Schmidt von Eschlkam sich auf Freiersfüßen befand
+Dem Vater von „Waldschmidt“ wurde die Heiratserlaubnis zunächst nicht gewährt.
Es ist kaum zu glauben, dass der Zollbeamte in gehobenen Dienst, Adalbert Schmidt, in Eschlkam, seinem Dienst- und Wohnort, vom Marktrat – das sind die jeweils im Amte seienden Gemeindebevollmächtigen – erhebliche Probleme bereitet wurden, regulär eine Ehe eingehen zu können.
Wir schreiben das Jahr 1828: Am 19. Oktober wendet sich der königliche Zollbeamte Schmidt an den Magistrat mit dem Hinweis, er habe am 29. August um die „Verehelichung Licenz“ mit der hiesigen Bäckerstochter Katharina Kilger (damals Haus Nr. 58 – nun Blumengasse 2) nachgesucht, was am 1. September auch bewilligt worden war. „Nachdem es aber der Katharina Kilger gefallen hat“, so Schmidt, „diese eingeleitete und sehr mit gediehenen Heuraths-Angelegenheit gänzlich zu annullieren, so ist der Unterzeichnete hierdurch veranlasst den hochlöblichen Magistrat um gefälligen Aufschluss zu bitten, ob die ihm mit der obgenannten Katharina Kilger ertheilten Heurats Licenz auch dan(n) geltend gemacht werden könne, wenn der Unterzeichnete ein anderes nicht aus Eschlkam gebürtiges Frauenzimmer zu ehelichen Absicht hätte, oder ob für einen solchen Fall eine besondere Licenz erforderlich wäre. Einer bald gefälligen Rückäußerung sieht entgegen, der mit aller Hochachtung bestehende K(önigliche) Zollbeamte Schmidt.“
In der Biographie des berühmten Sohnes von Schmidt, dem Schriftsteller Maximilian Schmidt, wird der Vater Adalbert als Zollinspektor geführt. Er war also in führender Position am damaligen Zollamte in Eschlkam beschäftigt.
Der Marktrat reagierte auf das Ersuchen des ortsansässigen Zollbeamten erstaunlicher Weise nicht. Schmidt wandte sich deshalb am 13. Januar 1829 erneut an den Magistrat zunächst mit dem Hinweis, zwölf Wochen seien bereits verstrichen, „ohne daß ich über meine Anfrage ein Resultat erhielt“. Er bat erneut um Antwort und ergänzte, „daß mein gegenwärtiger Heuraths Gegenstand Fräulein Caroline Karg (sei) die Tochter eines verstorbenen Fürst Kemptischen Hofraths und bayerischen Kasten(Steuer) Beamten gleichen Namens ist (Johann Jakob von Karg, Hof- und Kabinettsrat).“ Schmidt führt noch an, dass die Braut nicht ohne Vermögen sei und „ein gebildetes Frauenzimmer mit dem besten Leumuth (Leunmund) versehen“ sei.
Schmidt bittet die anfänglich schon erklärte Heiratsbewilligung auch für „meine gegenwärtige Braut gültig zu erklären“, u.a. auch deswegen weil „Staatsbedienstete einer Gemeinde nie zur Last fallen, daher der Magistrat in dieser Beziehung nichts zu befürchten hat, und die Ertheilung der Heuraths Licenz für k(önigliche) Beamte blos als eine gesetzliche Formalität zu betrachten ist.“
Sollte der Magistrat einen Entschluss fassen, so Schmidt weiter, bittet er bei einer abschlägigen Antwort um deren Begründung. Auch mahnt der Zollbeamte dass Heiratsanfragen „nach allerhöchster Bestimmung längstens binnen 6 Wochen erledigt werden müßen, und ich gegen diese höchste Anordnung schon 12 Wochen von dem löblichen Magistrat in meiner Sache hingehalten wurde, die schon längst im Reinen sein könnte.“
Erst am 4. Februar, drei Wochen später, antwortete der Magistrat des Königlich baierischen Marktes Eschlkam mit dem Hinweis, „daß, nachdem die Gemeindebevollmächtigen hirzu nicht gut gesagt (zugestimmt) haben, (der) Bittsteller mit seinem Gesuche abgewiesen sey.“ Eine Begründung dafür lieferte die Marktbehörde nicht. Und damit endet der Akt.
Man stelle sich die Situation in Eschlkam vor: Einmal die aus welchen Gründen auch immer nicht zustande gekommene Ehe mit einer ortsansässigen Bürgerstochter. Der Beamte Schmidt, der in Zollangelegenheiten oft mit der Marktbehörde zu tun hatte und dazu die Bewohnerschaft, die wohl gerne mehr Hintergründiges in einer solchen Angelegenheit erfahren hätte. Die Gerüchteküche war wohl am Brodeln. Dennoch nahm die Angelegenheit ein offenbar gutes Ende. Der Zollinspektor Adalbert Schmidt heiratete Caroline Karg, aber, so die Auskunft der Ehematrikel, nicht in Eschlkam. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, erblickte drei Jahre später am 25. Februar 1832 Maximlian Schmidt, der spätere gefeierte Literat, genannt „Waldschmidt“, das Licht der Welt.
Werner Perlinger
Der Handelsmann Karl Müller - sein Schicksal in Eschlkam und in Furth im Wald
+„Polizeiliche Untersuchung gegen die Schreinerstochter Anna Maria Kaufmann von Eschlkam wegen öffentlicher Beschimpfung des Handelsmannes Karl Müller“, so lautet der Titel eines Aktes im Gemeindearchiv von Eschlkam, datiert auf das Jahr 1854.
Was war geschehen: 1839, am 6. April erwarb Karl Müller, amtlich bezeichnet als „ein Mensch von besten Leumunde“ und geboren als Brauersohn 1818 in Egg, Pfarrei Böbrach, Landgericht Viechtach, durch „Gandtkauf“ um 4000 Gulden das Bürger- und Krameranwesen der Johann Pöschl’schen Eheleute (Nr. 25, heute Waldschmidtplatz 8) mit den dazugehörigen landwirtschaftlichen Gründen. Vor der Familie Pöschl war Besitzer Josef Breu. Müller war Neubürger und hatte es in den nächsten Jahren in seiner Eigenschaft wohl nicht leicht als Krämer vor allem aber auch als Mensch mit den Marktbürgern zurecht zu kommen. Er scheint sich Feinde geschaffen zu haben: So habe im Mai des Jahres 1854 die ledige Tischlerstochter Anna Maria Kaufmann im Markte das Gerücht „ausgestreut, daß der Krämer Karl Müller von hier in der Prozeßsache des H. Pfarrers Karl Pittinger gegen Katharina Schmirl wegen greller Beschimpfung, in welcher Müller als Zeuge kürzlich beim kgl. Landgericht Kötzting vernommen worden ist, einen falschen Eid deshalb abgelegt habe, weil er, Müller, in seiner Vernehmung angegeben, daß er den H. Pfarrer Pittinger einmal abends um ½ 10 Uhr auch im Kaufmann’schen Hause dahier gesehen habe.“ Es ging also um zwei für eine Gemeinde, wo jeder jeden kennt, sehr brisante Angelegenheiten die schnell Thema des allgemeinen Tratsches wurden: Einmal um Meineid, dann vielleicht auch um ein „verdächtiges Verhalten“ des damaligen Ortspfarrers Pittinger in einem Privathause.
Müller saß irgendwie in der Klemme. Er klagte beim Vermittlungsamte des Marktes gegen die Kaufmann wegen „Ehrenbeleidigung“. Ein anberaumter „Vergleich“ (Sühneversuch) im Rathause scheiterte, da die Kaufmann „nicht nur nicht zu einem Widerrufe zu bewegen war, sondern fest behauptete, daß Karl Müller in der oben erwähnten Prozeßsache (des Pfarrers Pittinger gegen Katharina Schmirl) einen falschen Eid abgelegt habe….“ Da dem Müller, seinen Mitbürgern und vor allem dem Magistrat „alles daran gelegen ist, daß der Bürger, Gemeindebevollmächtigte und Kirchenpfleger Karl Müller von der großen Beschuldigung des Meineides offiziell gereinigt werde“, wurde die Angelegenheit an das Landgericht Kötzting weiter geleitet mit der Bitte, eine strafrechtliche Untersuchung „einleiten zu wollen“.
Die Sache kam ins Rollen. Auf Anfrage des hohen Gerichts meldete der Markt, dass die Kaufmann „auf dem Waschplatze zunächst der Penzkofer Mühle in Gegenwart mehrerer Wäscherinnen am Bach der Magd des Müller, Helene Hornik, ohne eine Veranlassung zugerufen habe, „sage es deinem Dienstherrn, daß er und Herr Pater Capistran (vielleicht aus Neukirchen b. Hl. Blut beigezogen) falsch geschworen haben …“. Auch der Vater der Kaufmann, Schreinermeister Michael Kaufmann, soll im Gastraum des Wirtschaftspächters Kolbeck unter Anwesenden geäußert haben, dass Müller, „der schlechteste Kerl zu Eschlkam ist, weil er falsch geschworen habe“. Das Landgericht forderte am 20. Juli von der Marktführung hinsichtlich der Kaufmanns ein „genaues und umfängliches Leumunds- und Vermögenszeugnis“.
Der Akt des Marktarchives endet unvermittelt am 3. März 1855 mit der Vorladung des Schreinermeisters Michael Kaufmann und seiner Tochter vor das „Appellationsgericht“ in Kötzting. Wie die Sache für Müller vor dem Landgericht in Kötzting ausgegangen ist, vermittelt uns der Akt nicht.
Karl Müller verkaufte laut Brief am 29. Januar 1858 sein Anwesen an Joseph Lackerbauer und verließ noch im gleichen Jahr mit seiner Familie Eschlkam und nahm seinen Wohnsitz in der Stadt Furth im Hause Bayplatz 4 (heute Raiffeisenbank), wo er ebenfalls eine Krämerei mit Gasthaus betrieb.
Aber auch hier konnte sich Müller auf Dauer nicht halten: 1863, am 29. Juni zerstörte ein großer Brand völlig die östliche Hälfte der Stadt vom Gasthof „zum Bay“ hinauf bis zur Bahnbrücke. Wohl aufgrund der vergangenen Vorfälle in Eschlkam und Querelen mit einem seiner Nachbarn wurde er der Legung u.a. auch des großen Stadtbrandes verdächtigt. Der angrenzende Nachbar, der Müller Simon Eberl beschuldigte Müller einen späteren Brand am 27. Oktober 1863 in dessen Anwesen gelegt zu haben. In den Sammlungen des Staatsarchivs Amberg hat sich das Urteil gegen Karl Müller erhalten. Demnach erkannte am 24. Januar 1865 das königliche Bezirksgericht Neunburg vorm Wald in Sachen Karl Müller, Wirt von Furth wegen Brandstiftung zu Recht: „Karl Müller, katholisch, 46 Jahre alt, verheirateter Gastwirt von Furth, ist schuldig des Vergehens einer (einmaligen) strafbaren Bedrohung (die Anklage beinhaltete zunächst drei Vergehen gefährlicher Bedrohung durch Auslegung von drei Branddrohbriefen), verübt an den Bewohnern der Stadt Furth und wird mit Gefängnis von einem Jahre und sechs Monaten bestraft.“ Ein Motiv für die Abfassung eines Brandbriefes war, dass Müller wegen ständiger Auseinandersetzungen mit seinem Nachbarn, dem Müller Eberl, Angst schüren und sich auf diese Weise rächen wollte. Vom Vorwurf der vorsätzlichen Brandstiftung, vor allem der Legung des Stadtbrandes im Jahr 1863 und anderer folgender Brände, das sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, wurde Karl Müller freigesprochen. Müller verstarb am 16. Juli 1878 in der Grenzstadt in Anwesen Stadtplatz 3.
Werner Perlinger
Ein Großbrand in Eschlkam im Jahr 1852
+In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1852 suchte den Markt ein Großbrand heim. Betroffen davon waren die Anwesen des Joseph Neumaier (Gasthof Penzkofer) und des Georg Leitermann (Miethaner). Durch das Feuer vernichtet wurden dabei nicht nur einzelne Wirtschaftsgebäude; vielmehr waren auch die Wohngebäude sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, wie es einzelne Akteninhalte uns offenbaren.
Gerade wegen damals neuerer baulicher Auflagen der Regierung und den damit verbundenen weit höher als vorgesehen entstehenden Kosten gestaltete sich der Wiederaufbau für Neumaier mehr als schwierig. Dazu kam, dass der Schadensersatz von der Landesversicherungsanstalt mangels Vertragsinhalte mit dem Brandleider nicht in dem Maße geleistet werden konnte wie es wegen der von der Genehmigungsbehörde angeordneten Auflagen zunächst nötig gewesen wäre. Daher stellte der Gastwirt Joseph Neumaier als Brandleider am 12. Juli 1852 im völligen Einvernehmen mit der Marktbehörde an die Königliche Regierung von Niederbayern, hier an die Kammer des Innern, ein „Baudispensationsgesuch“ (Befreiung von Bauvorschriften). Auf 19 eng beschriebenen Seiten, verfasst in Anwesenheit des Bürgermeisters Moreth vom damaligen Marktschreiber Joseph Anton Beutlhauser, lässt Neumaier, der gegen die baurechtliche Vorgaben „Berufung“ eingelegt hatte, seine durch den Brand schlimme wirtschaftliche Lage erklären, um so von einzelnen Bauauflagen befreit zu werden. Inhaltlich erfahren wir so, dass um die Mitte des 19. Jahrhunderts das Wohnhaus und die Stallung gemauert, das Wohnhaus mit Schneidschindeln gedeckt, der Stall mit Legschindeln und der Stadel „durchaus von Holz erbaut und mit einer Dachung von Legschindel versehen“ waren.
Dazu: die älteste Schindelform ist die Legschindel. Sie wurde einfach auf die Lattung gelegt und zur Befestigung mit Stangen und Steinen beschwert. Eine Spalt- oder Schneidschindel wird hergestellt, indem eine Rohschindel von einem geraden, feinwüchsigen und astfreien Holzblock mittels Schindelmesser und Schlägel abgespalten und mit dem (Reif)messer auf der „Heinzelbank“ nachbearbeitet wird.
Neumaier wollte dann den Stadel „von Stein erbauen“ und den Viehstall mit Legschindeln wieder eindecken. Das Wohngebäude versprach er „mandatsmäßig herzustellen“(entsprechend den amtlichen Vorgaben). Seine Berufung gründete er auf seine nunmehrige ökonomische „Unvermögenheit zur besseren Bauausführung“ und vor allem auf den Umstand, dass „in hiesiger Gegend großer Mangel an Ziegelmaterial ist“. Dennoch sollte er die Dächer sämtlicher Wirtschaftsgebäude gleich dem Wohnhause mit Ziegeln eindecken, da er auch im Besitze eines Ziegelofens sei. Zunächst listet er seine Vermögensverhältnisse auf. So sei sein Anwesen 13.000 f (Gulden) und das in Schwarzenberg 10.000 f wert. Dagegen stünden Hypothekenschulden in Höhe von 14.000 f und die Currentschulden (laufende Schulden) betragen 3.000 f. Dagegen waren seine Immobilien aber nur mit 800 f versichert, „weil das uralte Gemäuer des Gasthauses größtentheils nur mit Lehm und Bruchsteinen aufgeführt war“. Gar nicht versichert waren bei der Landesversicherungsanstalt seine „Mobiliarschaft“. So betrachtet war Neumaier insgesamt gesehen enorm unterversichert.
Möbel mussten neu angeschafft werden, ebenso die Einrichtung seiner Gästezimmer. Auch gingen die Kleider und die Wäsche gänzlich verloren, „bis auf das einzige Hemd, welches ich (während des Brandes) am Leibe trug“. Neumeier erklärt auch, dass seine große Ökonomie – dazu gehört auch die Einöde Kuchelhof, von wo er im Jahr 1839 nach Eschlkam zog und sich dort einkaufte - auf Grund des rauhen Klimas bei weitem nicht die Erträge bringe, um damit auch nur einigermaßen die kommenden Kosten des Wiederaufbaus zu tragen. Völlig ungeeignet für die Herstellung der nötigen Dachtaschen sei auch der von seiner Kapazität her erwähnte Ziegelofen: Straubing sei für den Bezug von Dachziegeln zu weit (18 Stunden Transportzeit). Von der Stadt Taus habe er wohl für das Wohnhaus mehrere tausend Dachtaschen erhalten. Aber wegen des kürzlichen Großbrandes in Neumarkt (Vseruby) – 34 Häuser gingen dabei zugrunde – könne Taus nicht mehr nach Bayern liefern. Ebenso spricht Neumaier den Mangel an geeigneten Kalk an. Vier Maurer habe er für den Wiederaufbau des Wohnhauses beschäftigt, aber mangels Kalk sei er gezwungen, den Weiterbau einzustellen, da er aus Kötzting und von den Helmhöfen (bei Rittsteig) wegen der allgemeinen großen Nachfrage keinen Kalk mehr bekäme. Allein zur Bedachung seiner Ökonomiegebäude würde er 80.000 Stück Ziegelplatten brauchen, was ihm allein 1240 f kosten würde. Müsste er streng nach den vorgegebenen amtlichen Richtlinien die niedergebrannten Gebäude wieder herstellen, „wäre es mir nicht möglich, dieses große Opfer zu bringen: ich wäre gezwungen, Haus und Hof und alles zu verlassen und dann als Bettler abziehen“, so Neumaier abschließend.
Uneingeschränkt unterstützt von der Marktführung erhielt er am 22. August 1852 schließlich die gewünschte, teilweise „Baudispensation“. Er durfte seine Ökonomiegebäude, bestehend „in Stadel, Stallung und Schupfe“ im Gegensatz zum Wohn- und Gasthaus aufgrund seiner durch den Großbrand verursachten angespannten finanziellen Lage nun doch mit „Legschindeln decken, daß jedoch der Stadel und Stall mit Feuermauern und die Schupfe mit einer Giebelmauer versehen werden“.
Stark mitgenommen vom Brande war auch sein Nachbar Georg Leitermann. Das Wohnhaus war nur im Erdgeschoß gemauert. Den ersten Stock bildete ein herkömmlicher Blockbau aus Holz. Für seine Wirtschaftsgebäude – der Stadel war gezimmert und mit Schneidschindeln gedeckt - musste er wegen der jeweils nahe angrenzenden Nachbarsgebäude verschiedentlich sog. Brandmauern hochziehen.
Mit den heute üblichen, damals jedoch als sehr streng erachteten neuen Vorschriften, vor allem für die Eindeckung der Dächer, wollte die Landesregierung aufgrund der vielerorts anzutreffenden Holzbauweise immer wiederkehrende Großbrände ein für alle Mal verhindern. Bestes Beispiel dafür wie verhängnisvoll geschindelte Dächer sein können, bietet die Stadt Furth: Am 29. Juni 1863 brannte die ganze Osthälfte der Stadt nieder. Nur zwei Gebäude blieben verschont, da sie bereits eine Ziegeldachung hatten. Es waren dies das 1862 erbaute Amtsgericht und das Bürgerhaus Mondscheinstraße 1.
Werner Perlinger
Als einst in Eschlkam Recht gesprochen wurde
+Aus den Rats- und Verhörsprotokollen von 1685 und 1687
Im Archiv des Marktes Eschlkam finden sich unter den älteren Vorgängen neben den Kammerrechnungen auch Rats- und Verhörsprotokolle. Es ist ein reichhaltiger Fundus, der uns teils sehr anschaulich das Leben der Bürger im Markt vor über 300 Jahren vor Augen führt.
Das älteste Protokoll des Marktes, in dem die Thematik und der Verlauf von Ratssitzungen verzeichnet sind, stellt sich dem Leser als ein dicker in Schweinsleder gebundener Foliant vor, der die Niederschriften mehrerer Jahre beinhaltet. Das erste Protokoll über eine Ratssitzung datiert vom 25. Juni 1683. Die innere Titelseite trägt den Hinweis: Deß Churfürstlichen Marckts Eschlchmab angefangen den 25. Juni anno 1683. Die Eintragungen enden mit der Ratssitzung vom 12. Dezember 1695.
Aus diesem Fundus mit insgesamt 381 Doppelseiten seien an dieser Stelle einige Inhalte vorgestellt, um so in das Leben der Marktbürger und die Alltagsprobleme vor über 300 Jahren einen Einblick zu erhalten. Wir wollen zunächst einige Vorgänge aus dem Jahr 1685 vorstellen. In der neuen Ortsgeschichte vom Jahr 2010 war das Jahr 1686 gewählt worden.
Der Sitzung vom 5. Juli 1685 standen vor der „Ambts Burger Maister“ Wolf(gang) Stephl, Wolf Sighart Altmann und Andre Hastreiter des Inneren Rats; dann Valentin Haidlfinger, Hans Fleischmann, Wolf Späth, der Jüngere und Peter Oswaldt als Mitglieder des Äußeren Rats.
Ein Thema unter vielen war die „Abstrafffung mit dem Stockh im Markhthaus“. Demnach hatte Stephan Mauser, „Baader Jung“ (Lehrling), gegenüber dem Wundarzt von Viechtach, Joachim Jung „unzimbliche Röden (Beleidigungen) ausgesprengt“. Dafür wurde er zur Strafe zu 12 Stunden in den Stock „condemnirt“ (bestraft). Demnach wurde der Sträfling meist von 12 Uhr mittags bis 6 Uhr abends in den Stock gespannt. Der Stock war entweder im Rathause selbst oder öffentlich davor auf Marktgrund aufgestellt. Jeder, der vorbeikam, konnte so den mit Füßen und Händen jeweils zwischen zwei Balkenriegeln eingespannten Delinquenten hänseln und verspotten.
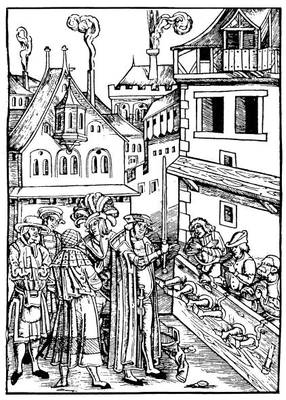 Bildtext: Diese Stockstrafe, wo ein oder gleichzeitig mehrere Delinquenten öffentlich in den „Stock“ gespannt waren, wurde in allen Kommunen, die über die >Niedere Gerichtsbarkeit< verfügten, in der Regel bei Ahndung von Beleidigungen und Raufhändeln angewendet. Vor den Verurteilten steht das Gericht mit dem Richter, der eben das Urteil verkündet und begründet. Als Symbol für Gerechtigkeit, aber auch als Zeichen für den Eintritt der Rechtskraft hält er ein großes Schwert in seiner rechten Hand.
Bildtext: Diese Stockstrafe, wo ein oder gleichzeitig mehrere Delinquenten öffentlich in den „Stock“ gespannt waren, wurde in allen Kommunen, die über die >Niedere Gerichtsbarkeit< verfügten, in der Regel bei Ahndung von Beleidigungen und Raufhändeln angewendet. Vor den Verurteilten steht das Gericht mit dem Richter, der eben das Urteil verkündet und begründet. Als Symbol für Gerechtigkeit, aber auch als Zeichen für den Eintritt der Rechtskraft hält er ein großes Schwert in seiner rechten Hand.
(Bildnachweis: Gefangene im Stock, aus Tenglers Laienspiegel, 15. Jahrhundert)
Ein neuer Kelch für den Gottesdienst
Auf Bitten des Pfarrers beschloss der Marktrat für das „St. Jakobi Gottshaus weillen solches zur Ehr Gottes geraicht“, für 30 bis 36 Gulden einen silbernen Kelch anfertigen zu lassen, der dann vergoldet wurde. Da im Dreißigjährigen Krieg, vor allem im Jahr 1634, Eschlkam von den Schweden gar arg heimgesucht worden war, konnte nun 50 Jahre später erst diese Investition für die Kirche getätigt werden.
Im gleichen Jahr erhielt Hans Zilkher, Schuster und Inwohner, die Erlaubnis auf einer vorhandenen „Prantstatt“ (Brandstätte wohl noch vom Schwedenkrieg her) eine bürgerliche Behausung zu erbauen. Die endgültige Genehmigung zog sich jedoch noch eine gewisse Zeit hin.
Rüge für Lehrer Wilhelm Hager
Dem Lehrer wird vorgeworfen, er verrichte seinen Schuldienst sehr nachlässig, so dass die Jugend „mit Lesen und Schreiben schlechtlich, mit dem Rechnen gar nit unterwissen worden“. Abhilfe wurde gefordert. In den Jahren 1670 und 1681 ist in Furth als „Schulmaister und Organist“ ein Ignatius Hager nachweisbar. Beide werden wohl zueinander verwandt gewesen sein, vielleicht waren sie sogar Brüder.
Zwei Jahre später, in der Sitzung vom 13. Januar 1687 fordern die Kufner Wolf Korherr und Georg Harpfinger in ihrer Eigenschaft als Viertelmeister, dass Andre Hastreiter als Bürgermeister sein „Schuehmacher Handtwerch würklich“ aufgebe. Widrigenfalls wolle die gesamte Bürgerschaft es dem Bürgermeister und den Markträten überlassen, ob sie Hastreiter ohne Verrichtung des Bürgermeisteramtes noch im sog. Innern Rat (die Geschworenen) belassen wollen. Hastreiter bittet, sein Handwerk erst in einem Vierteljahr aufgeben zu dürfen. Daher ersuchte er den bisherigen Bürgermeister Wolf Sighart Altmann (Besitzer eines Hoametrhofes-heute Penzkofer) bis dahin das Amt zu versehen.
Der „Schüzenmaister“ (der Name ist nicht genannt; Ausbilder für die Mitglieder der Grenzfahne am Ort) fordert, dass die Bürger Hans Hastreiter, Schuhmacher; Peter Lährnbecher, Weißbäcker; Wolf Zilkher, Schneider und Peter Thirankh, Weißbäcker obrigkeitlich angehalten werden, an den Schießübungen teilzunehmen. Es war damals hinreichend bekannt, dass die Bürger gerne oft die Exerzierstunden versäumten. Georg Vaist bittet, dass ihm zu seinem „Hauswurzgarten“ (Gemüsegarten) „noch ain Örtl (kleine Fläche) auf Gemainen Markhts Grundt“ gegeben werde. Nach vorgenommen Augenschein durch die Markträte wurde seine Bitte genehmigt.
Wiederaufnahme des „Preumaisters“
Hainrich Spätt, Bürger und Prauner Preumaister (im Kommunebrauhaus), bittet den Marktrat ihm künftig den „Preudienst widerumben zuüberlassen“. Die Bürgerschaft selbst hatte aber vorbringen lassen, dass sie aufgrund zahlreich eingegangener Beschwerden mit ihm „gar übel zufriden seint“. Nach längerer Aussprache dazu wurde er dann (wohl mangels geeigneten Ersatzes) doch wieder mit der Bierherstellung im Kommunebrauhaus beauftragt.
Am 27. August 1687 wurde der Inwohner Hans Vogl sechs Stunden im „Markhthaus condemniert“ (eingesperrt - Gefängnisraum im Rathaus), da „er sich fräventlich understandten“ ein Mutterschwein unter die „Herdt zetreiben“; auch hat er ein Schwein im Markt herumlaufen lassen. Außerdem wird ihm klar erklärt, dass er als Inwohner (nur Mieter – kein Hausbesitzer) kein Schwein austreiben dürfe.
Den „Würthen und Pierzäpflern“ (Inhaber der Taferngerechtsame) wird bei einer Strafe von 2 Reichstalern verboten, die Gäste noch nach 9 Uhr nachts – „er möge sein wehr er wolle“ – „zächen“ zu lassen. Ausgenommen wurden nur „Landtraisstige“ (durchreisende Personen).
Am 12. Dezember 1687 klagt der Inwohner Wolf(gang) Vogl den Bürger und Hufschmied Georg Altmann an, dieser habe sein „Söhnl auf dem veldt ohne gegebne Ursach mit ainen Stekhen dergestalten tractiert, das der Bueb als principal (nahezu gänzlich) ganz verschwollen gewesen“. Nach längerer Beweisaufnahme wurde Altmann, da er dem Buben „ainen Straich über den Kopf zuegefüget“ und es ihm nicht gebührt „selbst aigener Richter zu sein“ von 12 bis 4 Uhr im Rathaus eingesperrt.
Das sind nur einige Fälle, mit denen sich der Marktrat als Gerichtsbehörde zu befassen und dann abzuurteilen hatte.
Werner Perlinger
Die erneute Übergabe des „Schmirl“-Anwesens in Eschlkam
+Als „Austrägler“ mit der Kutsche gerne unterwegs
Berichteten wir im letzten Beitrag über den Besitzerwechsel des derzeitigen Gasthofes „zur Post“ im Jahr 1747, so stand gut 25 Jahre später erneut die „Übergab“ der gleichen „burgerlichen Gastgeber Behausung“ der Familie Schmirl an, seit 1955 im Besitz der Familie Penzkofer.
Aus dem Übergabevertrag lesen wir:
So übergeben „der Edl Veste und Wohlweise Herr Frantz Antoni Schmirl Burgermaister alhir zu Eschlkam“ und seine Frau Anna Maria am 10. Mai 1776 unter Beistandsleistung von Michael Grauvogl, „burgerlichen Baadern“, ihre am 6. Februar 1747 durch „obrigkeitlichen Ankonfts Titl an sye (sich) gebrachte … burgerliche Gastgebs Behausung“ ihrer „geliebten eheleiblichen Jungfrauen Tochter Maria Anna, noch ledig“. Genannt wird auch deren künftiger Ehemann Josef Weber, Sohn des Wolfgang Weber, „gewesten Bauern am Sternberg (der nach 1946 abgegangene große Sternhof bei Rothenbaum), Cameral Unterthan in Böhmen“ (steuerlich zur böhmischen Hofkammer in Prag gehörig).Weiter sind in der Niederschrift des Briefprotokolls aufgeführt die Stallung, Stadel, Wurz- und Grasgarten, Felder und Wiesengründe; ferner 4 Zugpferde, 24 Stück Rindvieh – „außer es ergebete sich eine sonderheitliche Vieh Seuche, welches Gott gnädlich verhindern wolle“. Zur Übergabe zählten noch zwei „Schweins Mütter“ (Muttersauen), 2 Dutzend zinnerne Teller, 1 Dutzend gleiche Schüsseln, „3 Gastbetter“ (für die Übernachtung von Reisenden) samt übrigen „Haus- und Paumanns Vahrnuß“ (häusliches Mobiliar und landwirtschaftliche Gerätschaften).
Erinnern wir uns unter welchen finanziellen Schwierigkeiten Franz Anton Schmirl den Besitz seiner Eltern im Jahr 1747 übernehmen musste, so kann bei jetziger Übergabe festgestellt werden, dass Schmirl in den knapp 30 Jahren überaus gut gewirtschaftet hatte. Der Wert der gesamten Immobilie mit Zubehör wurde nun auf stolze 8000 Gulden geschätzt. „Siglzeugen“ dieses Vertrages waren die Bürger des Marktes Thomas Stauber, Uhrmacher und Stefan Hastreiter, Schmied von Eschlkam.
Am gleichen Tag, dem 10. Mai, wurde für das Ehepaar Schmirl auch ein „Ausnahms Brief hierauf“ ausgefertigt. Darin versprach das junge Ehepaar den Schwiegereltern „ad dies vitae“ (zeitlebens) nachfolgenden Austrag:
- Den Bau einer „Ausnahmswohnung“ (entweder musste für die übergebenden Eltern im vorhandenen Hauskomplex als Altenteil eine Wohnung neu eingerichtet oder gar ein eigenes Ausnahmshaus erworben oder gebaut werden).
- An Getreide 4 Ell (1 Ell oder „oel“ entsprach als Getreidemaß ½ Scheffel=111 Liter oder ca. 1,5 Zentner) Weizen, 10 Ell Korn, 2 Ell Gerste, 6 Ell „Habern“ und 2 Viertl (= 1 Metzen=ca. 35 Liter) „Arbes“ (Erbsen)
- Jährlich 36 Köpf (1Köpf=3/4 Liter) Schmalz, an Milch vom 1. Mai an bis Jakobi täglich 2 „Maaß“ und von Jakobi bis wiederum 1. Mai täglich 1 Maß, und zwar vom „Stahl aus“ (frisch gemolken); ferner an Kraut 5 Schock (1 Schock=60 Stück) „Hauel“ (wohl Häupel); von beiden Gattungen Rüben 2 Ell, also 4; dann 4 Ell „Erdapfl“, 12 „Bischl Spän“ (Kienspäne für die Beleuchtung) und 15 Klafter Holz gratis und letztlich täglich 2 Maß „Pier“.
- Auch müssen die Übernehmer 3 Mutterschafe samt deren Lämmer mit den ihrigen füttern und auf die „Waid“ (Weideplatz) ein- und ausgehen lassen.
- Ferner dürfen die Übergebenden im „Wurzgarten“ den dritten Teil der Beete nützen. Auch erhalten sie vom Baumgarten den dritten Teil des geernteten Obstes. Gewährt wurde auch der freie Zutritt zum Brunnen (und die Nutzung des) Back = der „Köstloffen“ (Backofen, versehen zusätzlich mit einem seitlich eingebauten eisernen „Höllhafen“ zum Kochen von Kartoffeln). Zur Verfügung musste auch ein Krautbottich gestellt werden, ebenso ein Platz im Keller für die Rüben und Kartoffel; ebenso genügend Platz für die „aufhängung der Wesch“ und im „Hühner Stübl“ für die „hinterbringung des Gfliehs“ (Geflügel).
- Wollten die Austrägler eine Reise unternehmen, waren „ein Pferd und der Gutscher ohnentgeltlich“ zur Verfügung zu stellen.
Endbetrachtend kann gesagt werden, dass bereits damals der Kartoffelanbau im Hohenbogen-Winkel eingeführt war. Gerade dieser Umstand trug dazu bei, arge Hungersnöte wie beispielsweise in den Jahren 1771/72, ausgelöst durch klimabedingte Missernten bei Getreide, künftig auszuschalten. Nicht allein der mit 8000 Gulden hoch veranschlagte Wert des zu übergebenden Anwesens zeigt im damaligen Markt Eschlkam die ökonomisch gehobene Stellung der Familie Schmirl, vielmehr auch der Umstand, dass das Austragsehepaar – in dieser Zeit für den bäuerlichen Stand gewiss selten – gerne „ausfuhr“ und hierfür die besitznachfolgende Tochter stets eine Kutsche mit Pferd zur Verfügung stellen musste.
Werner Perlinger
Die Übergabe des späteren Gasthofs Penzkofer
+Die Übergabe eines großen Gutes in wirtschaftlich schwieriger Zeit
Handelte der letzte Beitrag von der Übergabe der sog. Penzenmühle am Ortseingang von Eschlkam, so sei – fortsetzend unsere Reihe über interessante Inhalte im Marktarchiv von Eschlkam – nun ein Besitzerwechsel des Gasthofes Penzkofer dargelegt, den vor über 250 Jahren die Familie Schmirl innehatte. Diese geräumige Hofanlage ist der im Markt topografisch höchstgelegene der sog. „Hoamater-Höfe“, die sich entlang der Straße nach Neukirchen b. Hl. Blut am Berg aneinanderreihen.
Im 13./14. Jahrhundert waren es nach Aussage des herzoglichen Urbars (Steuerbuch) im Markt Eschlkam zunächst zwei Altsiedel- oder Urhöfe, sog. Fron- oder Herrenhöfe auf Herzogs- und Königsgut. Die Silbe „vron“ oder „fron“ bedeutet in mittelhochdeutscher Sprache dem Herrn zugehörig. Sie waren dann ein Teil des „Aigen ze Eschenkambe“ in der markgräflichen Epoche und kamen schließlich nach dem Jahr 1204 in wittelsbachisch-herzoglichen Besitz.
Diese ursprünglich zwei Höfe dürfen im Markt derzeit mit vier Anwesen in Verbindung gebracht werden:
Gemeint sind damit die Anwesen Gasthaus zur Post (beim Obermeier-Xaver Penzkofer), Josef Pfeffer (Hoamater), Xaver Späth (beim Späth`n) und der „Brücklbäck“ (früher Elektro-Seiderer- jetzt Ernst und Stefan Fenzl). Die ersten drei liegen an der Straße nach Neukirchen in einer Reihe am Berg, der vierte leicht abseits an der den Markt durchquerenden Straße nach Neumark/Vseruby, das heutige Anwesen Fenzl. Diese vier Anwesen sind aufgrund besonderer Gegebenheiten aus den beiden in den Steuerbüchern des 14. Jahrhunderts genannten Altsiedelhöfen gewachsen. Die beiden Fronhöfe waren siedlungsgeschichtlich von Anfang an da. Daher rührt auch der sinngebende Hausname „Haimater“ oder „Hoamater“, dem die Begriffe „Heim“ bzw. „Heimat“ zugrunde liegen. Diese Güter besaßen auch die besten Grundstücke im landwirtschaftlichen Umgriff des Marktes.Im 18. Jahrhundert gehörte der damalige Gasthof mit ausreichender Ökonomie der Familie Schmirl. Nun stand im Jahr 1747 ein Besitzerwechsel an. Nach dem Ableben von Franz Paul Schmirl, „geweßter resignirter Burgermaister und Gastgeber“, stellten am 6. Februar der Bürgermeister und seine Markträte für den noch ledigen Sohn Franz Anton Schmirl einen sog. Ankunftsbrief (Urkunde über Besitzeinweisung, bzw. Besitztitel) für die Übernahme des Anwesens aus. Der Hof mit allen dazugehörenden Gründen wurde dabei auf 7742 Gulden geschätzt, ein damals in unserer Gegend sehr hoher Betrag. Auslöser für diese Maßnahme war ein am 27. Januar erlassener Befehl der kurfürstlichen Regierung in Straubing „zur Vermeydtung der vor Augen gestandtenen Gandt Formierung“, zugleich aber auch dafür, dass die Gläubiger ihre Ansprüche nicht verlören.
Das gesamte Erbgut wurde von verpflichteten „Schätzleiten“ begutachtet. Es waren dies die zwei „Haimbetern“ (Hoamater) Hans Preu und Hans Georg Schreiner (beide Nachbarn), ferner der Lederer Hans Paumbgartner und der Müller Josef Müller.
Ausgehend von einer Schätzsumme von 7742 Gulden musste der junge Schmirl allein an den Grafen Alexander von Lerchenfeldt auf Gebelkoven, den Hauptgläubiger der Familie, an „heyrige Ostern“ 1000 Gulden bar erlegen und im Folgejahr 1508 Gulden. (Die Herren von Lerchenfeld gehören zum altbayerischen Uradel. Wir treffen sie immer wieder als Inhaber hoher Ämter in den einzelnen bayerischen Regierungen. Zweige der Familie bestehen bis heute). Wieso Schmirl gegenüber dem Grafen so hohe Schulden hatte ist vorerst näher nicht erläutert. Die Gläubiger mit „klaineren Schuldtposten“ seien mit Grundstücken zu „contentiren“ (befriedigen). Letztliche Schulden mussten hypothekarisch abgesichert werden.
Es war für den jungen Schmirl, der 1752 Anna Maria Mauser heiratete, eine über längere Zeit hin schwere Bürde, die er aber im Laufe der nächsten Jahre zu meistern hatte.In einem Vertrag vom 1. Juli 1747 wird betont, dass die Familie Schmirl in den „jüngst verflossenen Kriegszeiten durch die viele zu prostieren gehabte Anlag (Kriegsanleihen) und Quartirs in eine solchen Schuldenlast verfallen“ sei. Gemeint sind die enormen Belastungen, die der Österreichische Erbfolgekrieg (1740-1742) infolge Einquartierungen und sonstiger Kriegsleistungen für die besitzenden Bürger im Hohenbogen-Winkel mit sich brachte. Die Kosten für die Einquartierung und Verpflegung von Soldaten wurden vom Staat meist nicht mehr ersetzt. In diesem gleichen Vertrag verpflichtete sich der Gutsübernehmer auch für seine drei Geschwister insgesamt 1050 Gulden auszuzahlen, verständlicherweise aber in kleinen Raten. Genannt werden der Bruder Johann Nepomuk, bedienstet beim Salzamt in Straubing, ferner seine Schwester Anna Catharina Späth, Frau des Wirts Veith Späth von Großaign (Wirtshans) und Theresia, Frau des Franz Bittig. Dieser war vorher Corporal bei den Graf Fuggerischen Dragonern. Laut Inhalt des Briefprotokolls vom gleichen Jahr war der junge Schmirl gezwungen, etliche Grundstücke zwangsweise zu verkaufen um sein Gut nicht zu verlieren. In den Besitz dieses Anwesens war der Vater Franz Paul Schmirl am 7. Juli 1715 durch Einheirat in die Familie Altmann gekommen. Diese Familie war lange im Besitz dieser Hofanlage.
Werner Perlinger
Als sich der Räuber Michael Heigl im Hohenbogen-Winkel herumtrieb
+Viele Bewohner des Hohenbogen-Winkels kennen so manche Begebenheit aus dem Leben des Räubers Michael Heigl vom Kaitersberg, denn oftmalen ist über ihn schon geschrieben worden. Geboren im Jahr 1816 in Beckendorf bei Kötzting, war der Sohn eines Tagelöhners zunächst Hütejunge bei einem Bauern und begann dann eine Ausbildung zum Schlosser in Furth bei dem Schlossermeister Peter Aunzinger, der 1830 aus Kötzting in die Grenzstadt zugezogen war. Als er im Further Pfarrhof das Schloss einer Truhe reparieren sollte, fand er darin einen stattlichen Beutel voll Geld, ließ seinen Meister in Stich und flüchtete damit aus der Stadt. Wegen dieser Tat und anderer Umtriebe stand Heigl seit 1841 unter Polizeiaufsicht. Nachdem er in Kötzting als fahrender Händler ohne Gewerbeschein verhaftet wurde, floh er 1843 aus einem Straubinger Gerichtssaal in den Bayerischen Wald. In den Folgejahren beging der Einzelgänger seine Raubzüge hauptsächlich in der Kötztinger und Viechtacher Gegend wie auch im Hohenbogen-Winkel und er kam bei seinen Streifzügen sogar bis in die Gegend von Landshut. Mehrere Jahre verbrachte Heigl auch im damaligen Ungarn (heute die Slowakei).
Als häufiger Aufenthaltsort und Versteck diente ihm die sogenannte Räuber-Heigl-Höhle auf dem Kaitersberg unterhalb des Kreuzfelsen. Da Heigl bei seinen Streifzügen vor allem reiche Bauern und auch Pfarrhöfe heimsuchte, erfreute er sich bei den ärmeren Volksschichten großer Sympathie und breiter Unterstützung. Doch durch den Verrat eines früheren Kumpanen entdeckte man sein Höhlenversteck. Am 18. Juni 1853 wurde er dort gefasst und 1854 in Straubing zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Nach einem Gnadengesuch wandelte König Max II. die Todesstrafe in eine lebenslange Kettenstrafe um. Wegen guter Führung wurde er nach einem Jahr vom Zuchthaus in Straubing nach München ins Gefängnis in der Au verlegt. Aufgrund seines vorbildlichen Verhaltens erhielt er 1856 dort eine Aufpasser-Stelle übertragen. Durch Kooperation mit dem Gefängnispersonal war er bei mehreren Mitgefangenen unbeliebt geworden. Deshalb erschlug ihn am 5. Januar 1857 ein Mithäftling mit der Kugel einer Fußkette, die diesem ein Zellengenosse überlassen hatte. Der Mörder und sein Mittäter wurden zum Tod verurteilt und im April 1857 in München mit dem Schafott hingerichtet. Heigl‘s Skelett bewahrte die Anatomie in München auf, wo es 1944 ein Bombenangriff zerstörte und so verloren ging. Soviel zur Person Heigls.
Tatsächlich beinhaltet auch das Marktarchiv Eschlkam Unterlagen, die sich mit der Person Heigl’s befassen. So wandte sich das Landgericht Kötzting am 19. November 1852 an die Marktbehörde in Sachen „Die flüchtigen Verbrecher Michael Heigl und Michael Reimer betreffend“. Eingehend auf das jüngst erst vorgekommene „Raubverbrechen zu Eckelshof und das so schauderhafte Verbrechen des Raubmordes zu Hinterhudlach (gelegen am Kaitersberg), seien dies ebenso traurige als lautsprechende Beweise von dem tieferschütterten Zustande der öffentlichen Sicherheit“, so der Landrichter Carl von Paur in Kötzting. „Wenn auch der Raubmörder der Bäuerin von Hinterhudlach bereits in den Händen der Justiz ist“, so seien auf freien Fuße noch „die Räuber Michael Heigl von Beckendorf und Michael Reimer von Ansdorf“, teilte die Behörde in dem Markt Eschlkam mit. „So lange diese beiden Verbrecher nicht aufgegriffen sind, ist es unerlässlich nothwendig, daß die bekannte Verordnung über die Nachtwachen, über die Dorfwachen an Sonn- und Feiertagen während des Gottesdienstes und über die Bewachung der Einöden durch Zuhausebleiben >wehrhafter Mannspersonen< erneuert und in strengen Vollzug gesetzt werde“. Beauftragt wurde der Bürgermeister von Eschlkam, diese Verordnung sofort bekannt zu machen. Geldstrafen wurden angedroht, sollte man nicht Folge leisten, und auch eine Belohnung wurde ausgesetzt für denjenigen, der über den Verbleib beider gesuchten Räuber verlässliche Auskunft geben könne. Anzunehmen ist, dass von den Pfarrern gerade das Zuhausebleiben von Familienmitgliedern während der Gottesdienste von der Kirche wohl nicht gerne gesehen wurde. Jedoch wurde die Vermeidung räuberischer Überfälle höher bewertet.
Erhalten ist auch ein Schreiben des Kötztinger Landrichters Carl von Paur vom 3. Juni 1853 mit dem Titel: Dem flüchtigen Heigl für Störung der öffentlichen Sicherheit betreffend; Demnach würden erfahrungsgemäß die Sommermonate Juni, Juli und August und September „von Michl Heigl, seinen Genossen und anderem Diebsgesindel zur Ausführung von Diebstählen und Raubverbrechen benutzt“. Gerade ein Diebstahl von 150 Gulden in Geld und Geldeswert in der Nacht des 1. Juni beweise dies. Insbesondere wurden im Juni 1847 von Heigl und seinen Genossen „7-8 Raubverbrechen“ verübt. Der Landrichter weist darauf hin, dass mehrere dieser Taten „an Sonntagen während der vormittägigen Gottesdienste verübt, wo nur Weibspersonen zu Haus gelassen wurden“, wie dies der Raub in Simmerleinöd am Kaitersberg beweise.
Landrichter von Paur appellierte an die Bevölkerung von Eschlkam dringlichst, „nächtlicher Weile die Hausthüren sorgfältig zu schließen und sich gegen einen allenfallsigen Überfall zu rüsten“. Ferner werden die Tag- und Nachtwachen „strengstens eingeschärft und die vielfach in dieser Beziehung erlassenen Verordnungen ernstens wieder ins Gedächtnis aller Gemeindemitglieder zurückgerufen“. Die Gendarmerie, das Gerichtsdienerpersonal und die Gemeindediener wurden auch in Eschlkam beauftragt, die Einhaltung dieser Verordnungen strengstens zu überwachen. Diese amtliche Bekanntmachung wurde am 15. Juni in Eschlkam sämtlichen „Gemeindegliedern vorgelesen“, was diese am Protokoll durch ihre eigenhändige Unterschrift bezeugten. Was der Landrichter noch nicht wusste, wenige Tage später, am 18. Juni wurde Heigl mit seiner Gefährtin nahe seiner Höhle am Kaitersberg gefasst und für immer in Gewahrsam genommen.
Ebenso wenige Tage vor der Festnahme von Michael Heigl wurde am 11. Juni 1853 eine Verordnung über den verbotenen „Hausierbrodhandel“ erlassen, denn man hatte festgestellt, dass der „flüchtige Verbrecher Michl Heigl von sogenannten Brodhändlerinnen Unterstützung erhielt“. Deshalb wurde „allen jenen unansässigen, obrigkeitlich mit einer Licenz zum Brodhandel nicht versehenen Personen ohne Ausnahme der Brodhandel“ verboten“. Dass diese „Hausiergeschäfte“ blühten beweist die Tatsache, dass „ganze Dorfschaften ohne Bäcker“ seien, so die amtliche Feststellung, und deshalb ihr Brot „von auswärts kommen lassen“ mussten. Auch war damals die Lage die, dass im Hohenbogen-Winkel viele Bewohner in den Einöden und die Häuselleute im Gegensatz zu den Bauern mangels der nötiger Grundmittel und auch geeigneter Backöfen nicht in der Lage waren ihr eigenes Brot zu backen.
In Eschlkam lebt bei manch älteren Mitbürgern noch die Überlieferung fort, dass Heigl bei einer Verfolgung durch die Gendarmerie in der Heuhofer Mühle sich unter dem drehenden Mühlrad verstecken und sich so vor dem Zugriff bewahren konnte.
Werner Perlinger
Als Anna Schneider in Eschlkam den Hebammendienst antrat
+Hebammen verrichteten sehr früh schon im Hohenbogen-Winkel ihren nicht leichten Dienst. Er war sehr verantwortungsvoll, da damals Frauen häufig im „Kindsbett“ verstarben. Ignatz Semmelweis, ein ungarisch-österreichischer Arzt, der den Umstand, dass Bakterien, ausgelöst durch ungereinigte medizinische Geräte, für die nahezu immer tödliche Erkrankung der Frauen verantwortlich waren, hatte gerade erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts diese Ursachen klar erkannt und auch in Fachkreisen veröffentlicht. Seine Erkenntnisse wurden lange Zeit nicht akzeptiert. Umso wichtiger waren in dieser Zeit für die Kleinstädte, Märkte und das Land gut ausgebildete Hebammen, die es verstanden, hygienisch sauber zu arbeiteten und den gebärenden Frauen in ihrer schweren Stunde Hilfe leisten konnten. Dazu vorerst noch ein Blick zurück.
Das frühe Hebammenwesen – weise Frauen helfen
Das Hebammenwesen ist alt. Sog. „weise Frauen“, die sich auf vielerlei Heilverfahren und medizinische Mittel dazu verstanden und vor allem eine entscheidende Hilfe bei Geburten geben konnten, gab es zu allen Zeiten. Sprachgeschichtlich alt ist daher auch der Begriff „Hebamme“. Ihm liegt die altgermanische Wortverbindung „heba amma“ zugrunde. Er entwickelte sich etwa seit dem 9. Jahrhundert aus dem althochdeutschen Wort „Hefihamma, Heuima, Heuammen“ für die Geburtshelferin. Das Wort wurde volksethymologisch an das geläufige Wort „Amme“ für die Nährmutter angelehnt, das seinerseits ursprünglich ein Lallwort der Kindersprache ist.
Die Geschichte der Geburtshilfe reicht weit zurück in die frühe Menschheitsgeschichte. Dem Ursprung nach ist Geburtshilfe eine solidarische Hilfe, die sich Frauen gegenseitig leisten. Bereits im Alten Testament wird unterschieden zwischen Hebammen, die für die eigentlichen Geburten verantwortlich waren und Ärzten, die die Komplikationen nach der Geburt behandelten. Mitte des Zwanzigsten Jahrhunderts gab es wohl den größten Wandel in der Geschichte der Geburtshilfe. Die Ursache dafür war die Verlagerung des Geburtsgeschehens in die Klinik und die Etablierung einer eigenständigen Geburtsmedizin.Beginnen die archivalischen Nachrichten über ein geordnetes Hebammenwesen im Markt Eschlkam erst vor der Mitte des 19. Jahrhundert, so scheint es die Einrichtung von Hebammen im Gemeindebereich schon weit früher gegeben zu haben.
Wir schreiben das Jahr 1841: Am 18. September berichtet ein Protokoll, dass die bisher im Markt tätige Hebamme Theres Pach – verwandt mit dem Kunstmaler Alois Bach – unlängst gestorben ist. Demnach wurden sämtliche Gemeindevorsteher des sog. Hebammen-Distrikts Eschlkam vorgeladen um über eine Wiederbesetzung des nun vakanten Distrikts zu beraten. Eine Lösung schien sich in der Person der Hebamme Katharina Überreiter abzuzeichnen. Diese stammte aus Neukirchen b. Hl. Blut, wo ihre sehr betagte Mutter ebenfalls noch als Hebamme tätig war. Das Landgericht Kötzting, eingeschaltet in die ganze Angelegenheit, hatte gegen die Aufnahme der Überreiter als Hebamme in Eschlkam keine „Erinnerung“ (Einwand), verwies jedoch auf die Tatsache, dass beim Tode der Mutter dem Markt Neukirchen ein Einberufungsrecht gegenüber der Überreiter zustehe. Letztlich ordnete die Behörde an, dass die Katharina Überreiter zur Verpflichtung in Eschlkam am 23. Oktober 1841 in Kötzting zu erscheinen habe.
Am 28. Juni 1842 berichtet der Magistrat Eschlkam, dass die Katharina Überreiter bereits am 18. September 1841 als Hebamme des „allhiesigen Distrikts“ aufgenommen worden sei, der Gemeinde Neukirchen wohl das „Einberufungsrecht zustehe“, diesem aber die neue Hebamme, würde ihre Mutter sterben, „förmlich des Distrikts entsagte.“ Vielmehr sollte den Neukirchner Bereich künftig ihre Schwester Anna Überreiter, auch eine ausgebildete Hebamme, übernehmen.
Einige Jahre später waren die Bewohner des Distrikts Eschlkam mit der Arbeit der Hebamme nicht mehr zufrieden und man suchte nach einer neuen Lösung, um die Überreiter los zu werden. Festgestellt wurde am 14. Juli 1845, dass sie in Eschlkam nur provisorisch aufgenommen worden sei, auch nütze sie wenig und die Bevölkerung hätte kein Vertrauen in sie. Vor allem wurde moniert, dass die „jetzige Hebamme Katharina Überreiter eine unzüchtige mit 3 unehelichen Kindern versehene Weibsperson ist“. Besser wäre es, sie täte ihren Dienst in ihrem Herkunftsort Neukirchen, da diese Gemeinde „ihrer Annahme nichts im Wege legt“. Dahinter steht selbstverständlich auch die Überlegung der Nachbargemeinde, dass sie deren Ausbildung finanziert habe, diese nun aber für Eschlkam zum Tragen komme.
Zugleich war für den Hebammen-Distrikt Eschlkam eine neue Situation entstanden. Der Magistrat wollte auf Dauer eine aus dem Marktbereich stammende Hebamme, und so bot sich nun eine Lösung in der Person von Anna Schneider an. Am gleichen Tag, den 14. Juli 1845 meldet der Magistrat an das Landgericht Kötzting: „Anna Schneider junge und ehrbare Burgers Tochter hat sich um den Hebammendistrikt Eschlkam als eintretende Hebamme bey der Magistratur Eschlkam angemeldet, indem die jetzige Hebamme Katharina Überreiter nur provisorisch aufgenommen und für die Marktgemeinde Neukirchen als eintretende Hebamme bestellt ist, worüber keine Widerrede nicht vorliegt. Der Anna Schneider ihre löblichen Zeugnisse, bestehend aus 6 Produkten, werden in Urschrift gehorsamst vorgelegt und selbe Bestands empfohlen.“
Offenbar genügte die Ausbildung der höheren Behörde noch nicht, denn am 23. Juli 1845 wird berichtet, dass die neue Hebamme Schneider „in die Lehre nach München geschickt wird.“ Für die „Erlernung dieser Kunst…schoß der Hebammen Distrikt Eschlkam 100 Gulden vor“. Diese mussten „gefälligst (sofort) an den Vorstand der Hebammen Schule in München“ überwiesen werden. Am 9. August musste „die Hebammskandidatin Anna Schneider, Bürgerstochter aus Eschlkam“, sich dem Landrichter in Kötzting vorstellen. Noch am 10. Januar 1846 musste der Markt 20 Gulden an die Schule in München nachzahlen. Ein weiteres Schulgeld in Höhe von 36 Gulden wurde als „Sustentations-Beitrag“ (Unterstützung) je nach wirtschaftlicher Lage als „Repartition“ (anteilsmäig) auf die Gemeinden Eschlkam, Schwarzenberg, Großaign, Stachesried, Warzenried und Kleinaign umgelegt. Grundlage dafür war das jeweilige Steueraufkommen, wobei Großaign mit einem Steueraufkommen von 688 Gulden (fl) mit 8 fl den höchsten Betrag lieferte, dahinter Schwarzenberg (637 fl zu 7 fl), Eschlkam (475 fl zu 5 fl) und Stachesried (420 fl zu 5 fl) und letztlich Warzenried (404 fl zu 4 fl) und Kleinaign (363 fl zu 4 fl).
Werner Perlinger
Großaign und Eschlkam im Streit um den Bau eines „Krankenhauses“
+Auch früher hatten die Gemeinden soziale Aufgaben zu erfüllen / Christliche Nächstenliebe auf dem Prüfstand !
„Gemeinde zu Großaigen gegen die von Kötzting wegen Aufrichtung eines Krankenhauses etc. de Annis 1688 – 1690 etc.“, so lautet der Titel eines Aktes. Was war geschehen, dass sich die Dorfgemeinde Großaign am 3. Dezember des Jahres 1688 ganz „underthenig, flechentlichsten bithen“ (mit flehentlichsten Bitten) ausdrücklich an ihren Landesherrn, den Kurfürsten Max Emanuel in München wandte. Dazu folgende Vorinformation: Der Dreißigjährige Krieg war gerade mal 40 Jahre vorbei. Dagegen war eine kriegerisch virulente Bedrohung des christlichen Europa durch die Türken Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg in hohem Maße gegeben. Im großen Türkenkrieg, der von 1683-1699 dauerte, wehrte Österreich und mit ihm das Abendland, teilweise mit reichs-, päpstlicher und polnischer Hilfe die Angriffe ab und ging selbst zum Angriff über. Gerade unser Land Bayern war in diese Kriege immer wieder stark eingebunden. Es war deshalb kein Wunder, dass auch der Hohenbogen-Winkel, durch dessen Territorium alte Fernwege verliefen, unmittelbar an der Grenze zu Böhmen davon indirekt betroffen war.So waren bereits 1687, im Jahr vor dem Sturm auf Belgrad, kranke Soldaten aus Ungarn beim Heimmarsch aus den Kriegsgebieten in das Dorf Großaign gebracht worden. Sie wurden zunächst in das gemeindeeigene Hüthaus gelegt, und der Dorfhirte musste sich vorerst eine andere Herberge suchen. Mittlerweile waren im Hüthaus fünf Soldaten verstorben
Ob dieser Vorgänge entstand Unruhe, die Bauern gerieten in große Sorge und lehnten den weiteren Verbleib kranker Soldaten in ihrem Dorfbereich kategorisch ab. So lasse sich das Hüthaus zu einem „Khrankhenhauss nit machen“, so die Begründung der Großaigener Bewohner. Mit dem deutlichen Hinweis, dass dagegen das Hüthaus des Marktes „Öschlcamb bei der Prukh“ für ein Krankenhaus einst gehalten worden sei, bittet am 3. Dezember 1688 die ganze „Dorfsgemain zum Grossaigen“, die kurfürstliche Durchlaucht möge dem Pfleggericht Kötzting befehlen, die kranken Soldaten nicht mehr zuzuführen, gleichwohl sollten für diese beim Markt „Öschlcamb (ein) Underhalt (eine Unterkunft) geschaffen werden“.
Sofort erging am 7. Dezember von der Regierung Straubing an das Pfleggericht Kötzting der Befehl, dass, sollten wieder neue kranke Soldaten „ankhommen“, dafür das „Khranckhenhaus zu Eschlcamb bey der pruckhen aufgericht werden solle“, um sie dort einzulegen. Damit war es aber nicht getan: Die Eschlkamer widersprachen vehement, dass es im Marktbereich je ein Krankenhaus gegeben habe. „So würde doch dies ihrer...Peurischen einbiltung (der Großaigener Bauern) nach dahin nit zu applizieren (möglich) sein, die aus Ungarn ankommenden und mit gefährlichen Krankheiten behafften Soldaten aufzunehmen“. Der Markt wehrte sich entschlossen gegen den Vorschlag der Großaigner, ein eigenes, wenn auch sehr bescheidenes „Krankenhaus“ zu bauen.
In dem von der Regierung zu diesem Thema eingeforderten Bericht vom 28. März 1689 erwähnt der Pfleger von Kötzting, Johann Jakob Poyssl zu Loifling nach Anfrage bei der Dorfgemeinde Großaign, ob „bey der Pruckhen vor dem Markht Eschlcamb“ einst ein Krankenhaus des Marktes gestanden sei, die Dorfgemeinde gebe einhellig vor, mittels alter Bürger von Eschlkam selbst zu beweisen, dass früher dort ein Krankernhaus gestanden und vom Markte erbaut und unterhalten worden sei. Deshalb erwarte er dazu die weitere Entscheidung der Regierung, was zu tun sei.
Grundsätzliche Frage war nämlich, ob das Krankenhaus bei der Brücke allein nur für die Bürger des Marktes, oder auch beispielsweise für die aus Ungarn, oder „anderen Ländern mit ankhlebigen (ansteckenden, gefährlichen) Khrankheiten behafft gewesene...fremde Persohnen angesehen, und erpauth gewesen seye“ Alle befragten Bürger sagten aus, es sei bei der Brücke (wohl an der Seite auf Eschlkam zu) einst ein kleines Heusl, gestanden, zerstört aber im Schwedenkrieg. Zwei alte Leute hätten dort gewohnt. Niemals aber seien damals Bürger noch kranke Soldaten in diesem Haus untergebracht gewesen. Auch habe eine Nachschau in den Marktrechnungen aus dieser Zeit dafür keinen einzigen Hinweis erbracht. Daraufhin forderte am 2. Juni die Regierung vom Pfleger in Kötzting und von den Großaignern in dieser Sache einen weiteren Bericht.
Die Angelegenheit zog sich hin. Erst am 11. August 1690 berichtet Pfleger Poyssl, dass er die „aydliche“ Erfahrung eingeholt habe. Voraussetzung für die Auswahl der zu befragenden Personen war, dass diese einen „ehrlichen Leimueth“ (guten Leumund) hatten.
Die „aidliche erfahrung“Als erste Persohnn wurde Georg Spätt, Burger und Gastgeb zu Eschlcamb, über 80 Jahre alt, vernommen. Demnach sei vor 60 Jahren innerhalb der „Pruckhen zu Eschlcamb ein Armes Haus“ (Armenhaus) gestanden und eine Arme, das „Stelzenweib“ genannt, habe dort gelebt. Damals habe es weder kranke Soldaten noch andere kranke Leute gegeben. Daher wisse er nicht, ob es für die Kranken erbaut worden sei. Auch wisse er nicht, welches Haus im Schwedenkrieg abgebrannt und seither nicht mehr aufgebaut worden sei. Die inhaltlich gleiche Aussage machten der 75 Jahre alte Bürger und Schreiner Wolf Zilckher und der Schuhmacher Hans Preu, 83 Jahre alt.
Wolf Pongraz von Stachesried, 70 Jahre alt, bestätigte, dass innerhalb der Brücke bei Eschlkam ein „Heusl“, genannt das „Pruckh Heusl“, gestanden sei. Darin hätten damals ein armes Weib und der „Todtengraber“ gewohnt. Der (schwedische) Feind habe es niedergebrannt. Den früheren Zweck des Hauses kenne er nicht.
Als fünfte Persohn sagte Wolf Pongratz aus, 72 Jahre alt. Er erinnerte sich an das kleine Häusl innerhalb der Brücke. Darin hätten die Armen und „Petlleith“ gewohnt, „die man hin.: und wider gefihrt, hinein gelegt“. Damals war es wie andernorts auch üblich, wandernde Bettelleute, denen ein längerer Aufenthalt in der Gemeinde nicht erlaubt wurde, im sog. Armenhaus für kurze Zeit, oft nur einen Tag, unterzubringen. Aber eine Nutzung für kranke Personen wisse er nicht. Der über 70 Jahre alte Paulus Prändl von Großaign erinnerte sich an das ehemalige Stelzenweib und auch an die sogenannten „Pruckhmädl als arme . 2 . Weiber (die sich dort) aufgehalten, auch an die Petlleith, wanns von ainem Orth zum andern geführt worden, seien diese in dieses Haus gebracht worden, was auch die meisten Bettler wünschten, da sie dort von dem Pruckkmedl oder (der) Margarethin, welches gar ein fleissiges Weib gewest, gefihrt werden khönnen“. Ob aber diese Einrichtung damals als ein Krankenhaus genutzt worden sei, wisse er nicht, sondern nur die Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg.
Mit diesen Ausführungen schließt unvermittelt die Akte. Wahrscheinlich verzichtete die Regierung darauf, diese Angelegenheit weiter zu verfolgen. Offenbar endete bald auch die Belastung der Dorfgemeinde Großaign mit durchziehenden, kranken Soldaten aus dem Türkenkrieg.
Resümee
An die 320 Jahre sind diese Vorkommnisse her. Zwei Parteien haben wir vor uns: Einmal die Bauernschaft von Großaign, dann die Bürger des Marktes Eschlkam. Früher war es üblich, dass die einzelnen Gemeinden aus dem christlichen Gebot der Nächstenliebe heraus den Ortsarmen, auch kranken Personen ohne Ansehen der Person eine Wohnung und auch eine soweit wie mögliche Verpflegung wenigstens für eine kurze Zeit zu gewähren hatten. Die Ortsarmen, die damals keine Gemeinde gerne haben wollte, mussten aus der Kommunalkasse unterhalten werden. Verstarb dann ein Bettler oder eine der Gemeinde zugewiesene völlig mittellose Person, so hatte die Gemeinde letztlich auch für eine Grabstelle und ein einfaches christliches Begräbnis zu sorgen.Werner Perlinger
Übergabe der Penzkofer-Mühle 1747
+Das Archiv des Marktes Eschlkam darf sich eines reichen Fundus an Urkunden, Akten und auch Protokollen aus früher Zeit erfreuen. Daraus sollen in dieser und den folgenden Abhandlungen verschiedentliche Inhalte dem Leser angeboten werden, die in der 2010 vom Verfasser erstellten Geschichte des Marktes allein aus Platzgründen nicht berücksichtigt werden konnten.
Zunächst einige einleitende Ausführungen zum Markt Eschlkam selbst: Eine zentrale und gehobene Stellung im Markt hatte neben dem Bürgermeister der jeweilige Marktschreiber, der meist eine für die Zeit herkömmliche, ja teils juristische Ausbildung genossen hatte. Mit ihm, der sämtliche Ratssitzungen protokollierte, fungierte die Führung des Marktes auch als Urkundebehörde und erledigte so die Aufgaben der heutigen Notariate. Sämtliche Kaufverträge und Übergaben der Häuser und Grundstücke, Heiratsverträge und Testamente, Bürgschaften und Leihverträge wurden vom Marktschreiber abgefasst, niedergeschrieben und gesiegelt. Mit dem Siegel des Marktes erlangten sie die amtliche Gültigkeit. Überliefert sind uns diese vielen zivilrechtlichen Verfügungen in den sog. Briefprotokollen. Von Eschlkam sind sie uns ab dem Jahr 1719 mit Unterbrechungen bis 1807 erhalten.Vorgestellt werden zunächst in Briefprotokollen des 18. Jahrhunderts niedergeschriebene Übergaben einzelner für den Markt bedeutender Gebäude. Wir beginnen zunächst mit einer Mühle.
Zu den ältesten Gewerben, ausgeübt seit jeher im Marktbereich, zählt das Handwerk der Getreidemüller. Sie haben in der sozialen Struktur des Marktes einen festen Platz und einen bedeutenden Stellenwert.
Als erster Fall sei die Übergabe der sog. Penzenmühle behandelt. Dazu einige Nennungen von Namen dieser Einrichtung in den letzten Jahrhunderten. So heißt sie im Jahr 1659 auf der „Palbersdorfermil“; 1686 „Druckhen- oder anietzo Lährnbecher Mihl“; 1688 „Truckhenmüll...DruckhenMihl“; 1694 „Pentzkhoverische Mill“; 1695 „Hannsen Pentzkhover Millern uf der Truckhenmill“; 1739 „auf der Penzkhofermihl“; 1747 „Penzenmill“; 1780 „Andrae Penzkofer Mühler auf der Truckenmihl“; 1840 „Pratzmühle, Penzenmühle“.
Das Bestimmungswort des Erstbelegs gehört zum Familiennamen „Balbersdorfer“; dieser zum Ort Balbersdorf bei Waffenbrunn. Die Bezeichnung „Truckenmühle“ (mundartlich „drucka“-trocken steht im Gegensatz zum Namen „Naßmühle“ – der unweit gelegenen Bäckermühle). Lernbecher ist der Name einer damaligen Bürgerfamilie in Eschlkam. Nicht behaupten konnte sich der Name „Pratzmühle“ (zu mundartlich „brods“ für Frosch). Seit 1694 erscheint der Familienname Penzkofer als Bestandteil des Mühlennamens wobei „Penz/Benz“ dazu eine Kurzform darstellt.
Nun einzelne Inhalte aus der Übergabe der Mühle am 11. September 1747:
Um den Steuerwert der Mühle und damit auch die sog. Notariatskosten berechnen zu können wurde sie damals mit allem Zubehör und den dazu gehörenden Gründen auf 1745 Gulden geschätzt. Im Vergleich zu anderen Anwesensübergaben eine hohe Summe; kostete doch nur Jahrzehnte später ein Kalb ca. 6-7 Gulden, ein Scheffel (222 Liter) Weizen etwa 20 bis 24 Gulden. So hatte „Maria Lährnbecherin, burgerliche Wittib (Witwe) und Müllerin auf der sog. Truckhmüll des alhiesigen Churfürstlichen Pannmarkhts Eschlcamb so aber Alter- und Leibszerbrechligkeit halber…nit selbst erscheinen können“. (Unter dem Begriff „Bannmarkt“ ist ein Markt mit eigenem Magistrat und eigener Jurisdiktion innerhalb des Burgfriedens zu verstehen, wobei der Burgfrieden hier den fest umgrenzten Gemeindebereich bedeutet).Vertreten wurde sie, ausgerüstet mit aller Vollmacht, von dem „Beyständter“ Caspar Penzkhofer. So übergibt sie ihre am 19. Oktober 1734 „ihr allein haimbgefallene (wohl durch den Tod des Mannes) sogenandte Trukhmühl mit den 3 Mahlgängen samt dem sehr zusambgefallenen Haus, Stadl, Stallung, Wurzgärtl item der halben Altwisen aufn untern Pernfurhrt, die Wiese vom Hausstadel bis an die Straß zwischen dem Alt- und Müllbach entlegen; dann das Feld neben dem Staudtenweyer und dem Wisl daneben, item das sog. Peimblfeld nebst dem Spättschen Gärtl“. Zur Übergabe gehörten auch die „Haus- und Paumannsfahrnis“ (letztere sind sämtliche Geräte für den Betrieb der Landwirtschaft), das sämtlich vorhandene Vieh und das Mihlwerchzeig“ (Gerätschaften für den Müller) ihrem geliebten Tochtermann (Schwiegersohn) Wolfgang Schmaus des Rats und derzeit Ambts Burgermaister und seiner Ehefrau Catharina, ihrer Tochter“.
Eigens wurde auch „die Ausnamb hierauf protokolliert“. Demnach erhielt die übergebende Mutter Maria Lährenbecherin „ad dies vite“ (zeitlebens) die Herberg auf der Stuben“, (im Stall) „ein Pläzl für eine Khue und dem erforderlichen Ohrt zur Huetterey“ (Wiesengrund als Weide für die Kuh). Sollten sich die Parteien miteinander nicht vertragen können, so wäre der Schmaus „obligirt (verpflichtet) der Ausnemberin, dann (für die) Stallung und (den) Huetterplaz jährlich 4 Gulden Zins an dessen statt zu veraichen“; außerdem erhielt sie noch 4 Klafter (12 Ster) Holz für die Heizung ihres Ofens im Stübl. Zuletzt wird darauf verwiesen, dass die „Schmaus’schen Eheleutth“ verpflichtet sind, ihrer Mutter „alles das jenige zu verraichen“, was punktuell in dem Übergabebrief vom 19. Oktober 1734 bereits vereinbart wurde. Diese notarielle Niederschrift ist nicht vorhanden.
Im Vergleich zu den heutigen Lebensverhältnissen erscheint die „Ausnamb“ der Maria Lährnbecher zunächst eher ärmlich. Sie darf aber wegen der durch die infolge vorangegangenen Kriege bedingten schweren Zeiten noch als gut vertretbar gelten. Auch sollten angesichts des baulich ruinösen Zustands der Mühle die Nachfolger wohl wirtschaftlich nicht zu sehr belastet werden. (Quellen und Literatur beim Verfasser vorbehalten)Werner Perlinger

